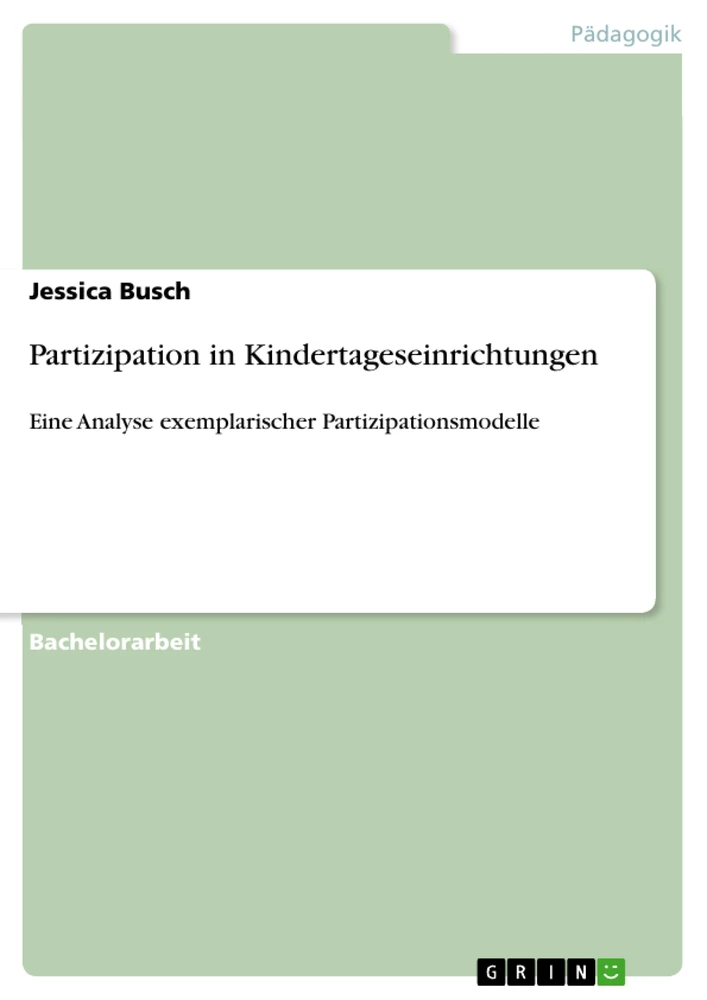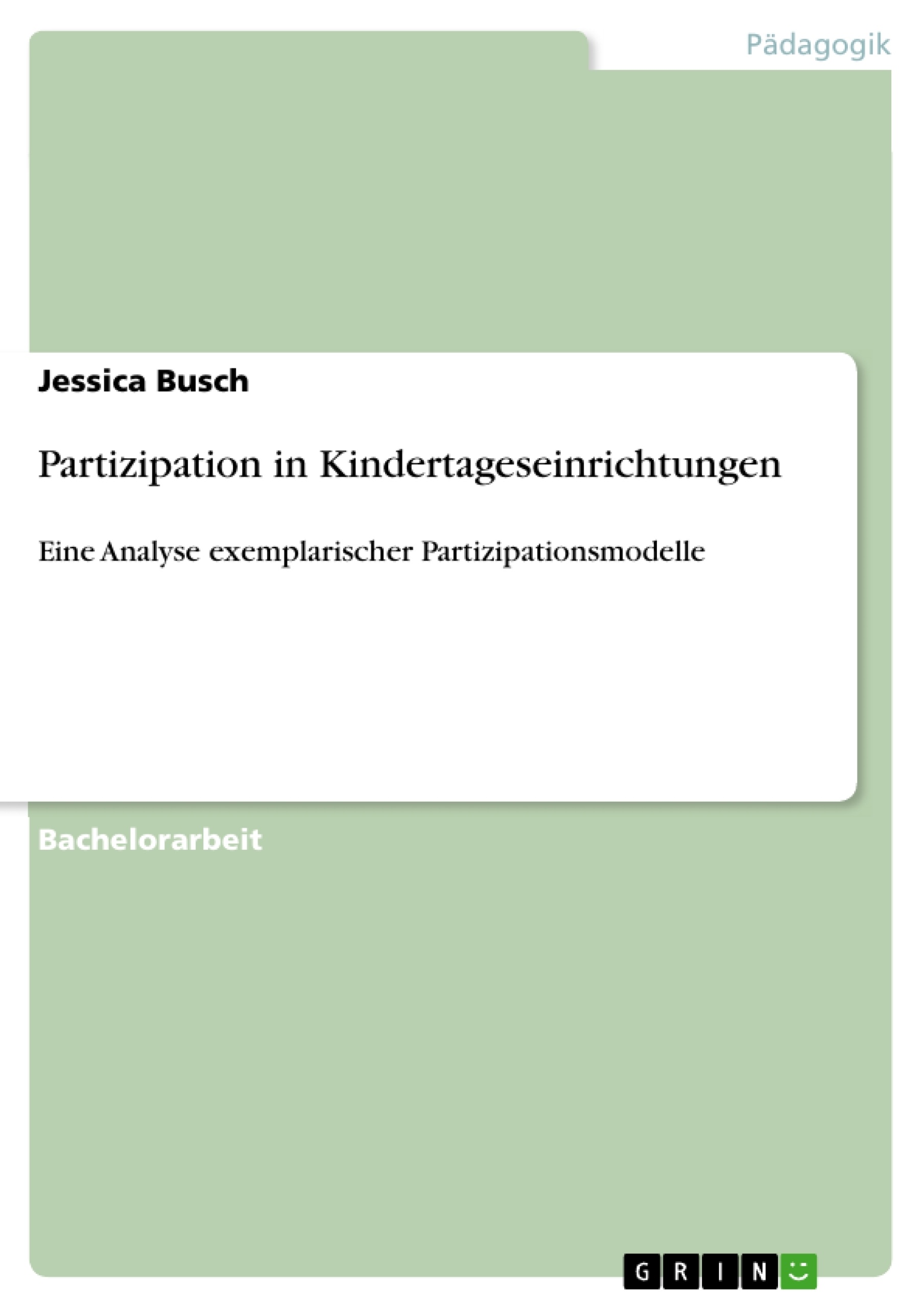Diese Arbeit analysiert und vergleicht zwei Partizipationsmodelle. "Partizipation in Kindertageseinrichtungen. So gelingt Demokratiebildung mit Kindern!" von Hansen/Knauer/Sturzenhecker und das Partizipationskonzept, das aus dem Bayerischen Bildungsplan deutlich wird.
Beide Bücher basieren auf oder lehnen sich in den Ausführungen zu Partizipation an das Modellprojekt „die Kinderstube der Demokratie“ an. Zudem werden diese Bücher als exemplarische Beispiele von Kulturprodukten im Sinne der Cultural Studies ausgewählt, um im Kontext der thematisierten Frage auf Partizipationsverständnisse der Beteiligungsmodelle und folgend auf gesellschaftliche Vorstellungen dieser zu schließen.
Zu diesem Zweck wurden die Fragestellungen wie folgt definiert: „Welche Vorstellungen zu der Umsetzung von Partizipation zeigen sich in den beschriebenen Partizipationsmodellen der Bücher? Lässt sich durch diese auf Vorstellungen von Partizipation schließen? Wenn ja, auf welche?“.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
1.1. Presentation des Themas und der Fragestellungen
1.2. Aufbau der Arbeit
2. Problemaufriss
3. Theoretische Vorannahmen
3.1. Begriffserlauterung: „Partizipation“
3.2. Begriffserlauterungen: „Partizipationsmodell“, „Kindertages- einrichtungen“, „exemplarisch“
3.3. Eigenbezeichnung der analysierten Bucher
3.4. Die Bucher als „Kulturprodukte“ im Sinne der Cultural Studies
4. Forschungsmethoden und Vorgehen
5. Textanalysen
5.1. Titel der Bucher
5.1.1. Das Buch „Partizipation in Kindertageseinrichtungen.
So gelingt Demokratiebildung mit Kindern!“
5.1.2. „Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan fur
Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung“
5.1.3. Vergleich
5.2. Formulierungsweisen in den Buchern
5.2.1. Das Buch „Partizipation in Kindertageseinrichtungen.
So gelingt Demokratiebildung mit Kindern!“
5.2.2. „Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan fur
Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung“
5.2.3. Vergleich
5.3. Begrundungen fur Partizipation
5.3.1. Das Buch „Partizipation in Kindertageseinrichtungen.
So gelingt Demokratiebildung mit Kindern!“
5.3.1.1. Die Rechte der Kinder
5.3.1.2. Bildungsforderung
5.3.1.3. Demokratiebildung
5.3.2. „Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan fur
Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung“
5.3.2.1. Kinderrechte, Bildung und Demokratie
5.3.2.2. Bildungs- und Erziehungsziele
5.3.3. Vergleich
6. Ergebnisse der Analyse
7. Diskussion der Ergebnisse
7.1. Die Bedeutung der Ergebnisse fur den aktuellen wissenschaftlichen Diskurs
7.2. Die Beantwortung der Forschungsfragen
8. Fazit
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
1.1. Presentation des Themas und der Fragestellungen
"Die verfassungsmaBigen Rechte der Kinder einschlieBlich ihres Rechts auf Entwicklung zu eigenverantwortlichen Personlichkeiten sind zu achten und zu schutzen. Das Wohl des Kindes ist angemessen zu berucksichtigen. Der verfassungsrechtliche Anspruch von Kindern auf recht- liches Gehor ist zu wahren. Die Erstverantwortung der Eltern bleibt unberuhrt."1
Die online Nachrichtenplattform der Tagesschau zitiert am 11.01.2021 den aktuellen Formu- lierungskompromiss der Bundesregierung bezuglich des Entschlusses die Kinderrechte in das Grundgesetz aufzunehmen. Auf diesen wurde sich nach Angaben der Nachrichtenplattform im Dezember 2020 geeinigt, die Information daruber am 11.01.2021 dem Bundestag weitergege- ben. Die Diskussion ob und wie die Kinderrechte in die Verfassung mitaufgenommen werden sollen, wird bereits seit einigen Jahren gefuhrt, wie die Tagesschau berichtet.[1]
Der Professor fur internationale Kinderrechte, Jorg Mayring beschreibt die UN-Kinderrechts- konventionen als ausfuhrliche Rechtsbeschreibungen bezuglich der Kinderrechte in Deutschland, die zwar international geltend sind, im deutschen Recht allerdings den Rang eines Bun- desgesetzes einnehmen (vgl. Maywald 2016, S.18; Verweis auf den Teil der Autor*innen hin- ten? ). Folglich bedeutet das, dass die Verfassung der Kinderrechtskonvention gegenuber vor- rangig ist (vgl. ebd., S.18). Wahrend in der UN-Kinderrechtskonvention unter anderem die Be- teiligungsrechte der Kinder festgelegt sind, fehlt eine solche Verankerung in den Grundgeset- zen bisher (vgl. ebd., S.16ff.). Auch die erste Reaktion auf den aktuellen Gesetzentwurf fiel kritisch aus, wie die Tagesschau berichtet[1]. Besonderer Fokus in den Argumentationen der Kritiker*innen liegt auf dem Wortlaut „Das Wohl des Kindes ist angemessen zu berucksichtigen.", das nach den Ausfuhrungen der Nachrichtenredaktion rechtlich lediglich als eine Be- rucksichtigung des Kindeswohls abhangig der Situation zu interpretieren ist[1]. Auch Maywald hat in seinen Ausfuhrungen im Jahr 2016 bereits angemerkt, dass eine Aufnahme der Kinder- rechte in die Verfassung, sowohl den Aspekt des Kindeswohlvorrangs als auch Partizipation umfassen muss (vgl. Maywald 2016, S.19). Er bezeichnet Partizipation als „fundamentales Kinderrecht" (ebd., S.16) und erklart: „Als unmittelbarer Ausdruck der jedem Menschen inne- wohnenden Wurde sind Kinder von Beginn an Trager unverauBerlicher Menschenrechte." (ebd., S.16). Durch die Forderung einer Einbindung der Kinderrechte in die Verfassung als Erganzung zu den Menschenrechten, die folglich die Beteiligungsrechte der Kinder umfassen sollen, wird der Zusammenhang zwischen Partizipation und den Menschenrechten der Kinder deutlich. Auch Sabine Fischer bekraftigt dies mit dem Vergleich der Kinder als „(...) Objekte von Erziehung, Fursorge und Schutz (...)." (Fischer 2017, S.74, Auslassung J.B.), wenn ihnen keine Moglichkeiten der Beteiligung gegeben werden (vgl. ebd., S.74).
Es zeigt sich, dass Kinderbeteiligung als ein Teil der Wurde der Kinder unabdingbar ist, was die Bedeutung von Partizipation in Kindertagesstatten verdeutlicht.
Nach Prengel wurde die Bedeutung von Beteiligungsmoglichkeiten der Kinder bereits in re- formpadagogischen Ansatzen aufgegriffen (vgl. Prengel 2016, S.46). Sowohl die Reggio- und Montessoripadagogik beinhalten laut der Autorin jeweils verschiedene partizipatorische Ele- mente (vgl. ebd., S.46f.). Wahrend sich diese bei dem Reggio-Ansatz als unter anderem die starke Gewichtung auf das eigenstandige Handeln der Kinder, die kindorientierte Projektarbeit und die Fachkraft als Begleiter*innen, zeigt (vgl. ebd., S.46). Druckt sich der partizipative As- pekt in der Montessoripadagogik als die eigenstandige Auswahl vorbereiteter Materialien aus (vgl. ebd., S.47). Aber auch die Kinderladenbewegung wird in Prengels Ausfuhrungen auf- grund der groBen Bedeutung einer Selbstbestimmtheit der Kinder, als richtungsweisend fur heutige partizipative Prozesse in Kindertageseinrichtungen gesehen (vgl. ebd., S.27). AuBer dieser, werden noch weitere padagogische Ansatze ausgefuhrt, die ebenfalls die Unterschiede der jeweiligen Beteiligungsintensitat und des Verstandnisses der Umsetzung zeigen (vgl. ebd., S.25ff., S.46ff.).
Auch in dem aktuellen Diskurs werden Unterschiede in der Partizipationsintensitat, dem Ver- standnis von Partizipation und der Ansicht der Umsetzungen dieser deutlich. Sie werden in den Kapiteln „Problemaufriss“ und „Theoretische Vorannahmen“ naher erlautert. Grund fur solche Differenzen im Beteiligungskontext sind laut Teresa Lehmann unterschiedliche Vorstel- lungen von grundlegenden Ausdrucken wie Demokratie oder Partizipation (vgl. Lehmann 2020, S.2), was die Relevanz einer Analyse dieser bestatigt und in Verbindung mit den Aus- fuhrungen uber die Beteiligungsrechte der Kinder zugleich das Thema dieser Arbeit bestarkt.
Um dieses weiter zu konkretisieren werden in der folgenden Arbeit der „Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan fur Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung“ und das Buch „Partizipation in Kindertageseinrichtungen. So gelingt Demokratiebildung mit Kindern!“ auf die dort implizierten Ansichten zu der Umsetzung von Partizipation untersucht. Beide Bucher basieren auf oder lehnen sich in den Ausfuhrungen zu Partizipation an das Modellprojekt „die Kinderstube der Demokratie“ an. Die Herausgeber des Bayerischen Bildungs- und Erzie- hungsplans sind das Bayerische Staatministerium fur Familie, Arbeit und Soziales und das Staatsinstitut fur Fruhpadagogik in Munchen. Das Buch „Partizipation in Kindertageseinrich- tungen. So gelingt Demokratiebildung mit Kindern!“ wurde von Rudiger Hansen, Raingard Knauer und Benedikt Sturzenhecker verfasst. Folgend wird auf diese Partizipationsmodelle entsprechend der Autor*innen und der Herausgeber verwiesen.
Zudem werden diese Bucher als exemplarische Beispiele von Kulturprodukten im Sinne der Cultural Studies ausgewahlt, um im Kontext der thematisierten Frage auf Partizipationsver- standnisse der Beteiligungsmodelle und folgend auf gesellschaftliche Vorstellungen dieser zu schlieBen.
Zu diesem Zweck wurden die Fragestellungen wie folgt definiert: „Welche Vorstellungen zu der Umsetzung von Partizipation zeigen sich in den beschriebenen Partizipationsmodellen der Bucher? Lasst sich durch diese, auf Vorstellungen von Partizipation schlieBen? Wenn ja, auf welche?“.
Fur eine Zusammenfassung, wie diese Fragen bearbeitet wurden folgt eine Ubersicht der Struktur der Arbeit.
1.2. Aufbau der Arbeit
In dem ersten Kapitel dieser Arbeit werden Beispiele des aktuellen Forschungsstands zu Par- tizipation erlautert, um zu zeigen inwiefern die Forschungsfrage dieser Arbeit an den aktuellen Diskurs anknupft und ihn erweitert. Die thematisierten Untersuchungen basieren, wie die ana- lysierten Partizipationsmodelle dieser Forschung auf den Uberlegungen und Ergebnissen des Modellversuchs „die Kinderstube der Demokratie“ und zeigen die Differenzen auf der Ebene der Umsetzung von Partizipation. Dafur wird zum einen die Forschung von Teresa Lehmann bezuglich der Ritualisierung demokratischer Beteiligungspraktiken naher erlautert. Und zum anderen wird die Untersuchung von Elisabeth Richter, Teresa Lehmann und Benedikt Sturzen- hecker, die den Zusammenhang zwischen der Einfuhrung demokratischer Strukturen nach der Kinderstube der Demokratie und den Potenzialen demokratischer Bildung thematisieren, aus- gefuhrt. Die Forschung dieser Arbeit erweitert den fachlichen Diskurs insoweit, dass sie sich nicht auf der Ebene der Umsetzung, sondern auf der der Vorstellungen und fachlichen Ansich- ten bewegt.
In dem darauffolgenden Kapitel, den theoretischen Vorannahmen werden die Verstandnisse aller Begriffe, die in dieser Arbeit als grundlegend gelten geklart. Das wird fur den Partizipati- onsbegriff durch eine Ubersicht unterschiedlicher Felder und Schwerpunkte, die in der Fachli- teratur zu finden sind, ausgefuhrt. Es wird von einer Unterteilung Sabine Fischers in die zwei Dimensionen einer sozialen und einer gesellschaftlichen Partizipationsdefinition auf weitere Felder ubergeleitet. Mit dem Bereich der Politik und der sozialen Arbeit werden Erwachsene und Jugendliche mit in die Definitionsvielfalt aufgenommen, um auf den Bereich der fruhkind- lichen Bildung und der Kindertagesstatten uberzuleiten. In den Erlauterungen zu Partizipati- onsdefinitionen mit unterschiedlichen Schwerpunkten werden die Haltung der Fachkrafte im Partizipationsprozess, der Einfluss den Einrichtungsstrukturen auf Partizipation haben konnen und die „Demokratiewerkstatt“ von Christian Buttner, als Beispiele genannt. AnschlieBend wird das Partizipationsverstandnis dieser Arbeit aus den dargelegten Untersuchen geschlossen. Weitere Ausdrucke, deren Verstandnis in diesem Kapitel geklart werden ist der Bezeichnung „Partizipationsmodell" und die Bezeichnung der analysierten Bucher als Handbuch und Bil- dungsplan. AuBerdem wird er Begriff der „Cultural Studies" kurz erlautert und in Zusammen- hang mit den analysierten Buchern gebracht, die in diesem Kontext und somit in dieser Arbeit als Kulturprodukte gesehen werden.
Das darauffolgende Kapitel der Methode stellt die Vorgehensweise in dieser Literaturfor- schung dar und benennt dafur Hans-Joachim Fischer, der fur qualitative Forschungen eine methodische Haltung vorschlagt, die zwischen einer pathischen und gnostischen Haltung wechselt, um einen induktiven Forschungsprozess zu ermoglichen. AuBerdem wird die Doku- mentarische Methode naher erlautert und deren Perspektivwechsel von der Frage „Was" zu „Wie". In den anschlieBenden Beschreibungen der Analyse werden verschiedene Aspekte, die hier als Kategorien bezeichnet werden untersucht. Darunter fallen die jeweiligen Titel der un- tersuchten Bucher, die Art der Formulierungen der Beschreibungen und die Begrundungen, die fur die Umsetzung von Partizipation in den Buchern erlautert werden. Nach den Ausfuh- rungen zu diesen Aspekten, werden die Ergebnisse der Analyse in dem Kapitel der Darstellung der Ergebnisse zusammengefasst und untereinander in Zusammenhang gebracht. Nach diesen Beschreibungen werden sie in dem Kapitel der „Diskussion der Ergebnisse" in den aktu- ellen fachlichen Diskurs eingeordnet, um die Relevanz dieser Arbeit zu verdeutlichen. Nach einem Uberblick der ausgewahlten Forschungen werden die Fragstellungen beantwortet und mit gesellschaftlichen Prozessen und Ansichten verknupft.
In den folgenden Beschreibungen werden fur eine bessere Lesbarkeit die vollen Titel der Schriftstucke nicht an jeder Stelle genannt. Auf diese werden durch die Bezeichnung „Bucher", durch eine Verknupfung mit den Autor*innen oder den ersten Teil des Titels hingewiesen. Au- Berdem wird der „Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan fur Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung" in Teilen als „Bildungsplan" abgekurzt und auf das Buch „Partizipation in Kindertageseinrichtungen. So gelingt Demokratiebildung mit Kindern!" als „Handbuch" verwie- sen.
2. Problemaufriss
Bei der Recherche zu Partizipation und Partizipationskonzepten fallt auf, dass das Konzept der „Kinderstube der Demokratie" auf dem das Buch „Partizipation in Kindertageseinrichtun- gen" basiert (vgl. Hansen et.al. 2015, S.11) und dessen Erkenntnisse „(.) maBgeblich und teils wortwortlich (...)" (Bayerisches Staatsministerium fur Familie, Arbeit und Soziales/Staats- institut fur Fruhpadagogik 2019, S.389, Auslassung J.B.) in das Kapitel eingeflossen ist, das Partizipation in Kindertageseinrichtungen im Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan the- matisiert, haufig zitiert und ebenso in Kindertagesstatten umgesetzt wird2. Folgend sollen zwei Beispiele, die die Umsetzung des Konzepts „Kinderstube der Demokratie“ auf jeweils unterschiedliche Weise und mit verschiedenen Schwerpunkten untersuchen, vorgestellt werden. Obwohl sich die in den Untersuchungen thematisierten Kindertagesstatten nach dem gleichen Konzept richten, gibt es bei der Umsetzung Unterschiede, was im Folgenden aufgezeigt werden soll.
Das erste Forschungsprojekt, das an dieser Stelle vorgestellt werden soll, ist von Teresa Lehmann. Sie hat in einer einzelnen Kindertagesstatte, das nach Angabe der Leitung nach dem Konzept der „Kinderstube der Demokratie“ arbeitet, die Umsetzung ritueller Partizipationsprak- tiken erforscht.
Das Konzept der „Kinderstube der Demokratie“ wird hier als Methode beschrieben, um bei Kindern durch Beteiligung Demokratiebildung zu fordern (vgl. Lehmann 2020, S.15). Hierbei wird bei den Fachkraften als Verantwortliche fur die Erziehung in Kindertagesstatten angesetzt und deren Aufgabe beschrieben, die Einrichtungen so zu gestalten, damit ein eigener demo- kratischer Bildungsprozess der Kinder ermoglicht wird (vgl. ebd., S.16). Diese Verantwortung fur das Wohlergehen und der Sicherstellung partizipativer Moglichkeiten der Kinder, wird von Lehmann als eine Seite des Machtgefalles zwischen Fachkraften und Kindern erlautert (vgl. ebd., S.16). Das Gegenstuck dazu ist die Gefahr des Missbrauchs dieses unausgewogenen Verhaltnisses auf Seiten der Fachkrafte. Daraus wird die Schlussfolgerung gezogen, dass die padagogischen Fachkrafte Macht abgeben, die Verantwortung allerdings behalten mussen (vgl. ebd., S.16). Daraufhin wird die Bedeutung der Einfuhrung einer Verfassung in den Kin- dertagesstatten fur die Festlegung der Beteiligungsrechte der Kinder, die Klarung welche Gre- mien und Verfahren genutzt werden und die Erklarung des Umgangs mit Regeln, verdeutlicht (vgl. ebd., S.16). AnschlieBend wird das Demokratieverstandnis des Konzepts in zwei unter- schiedliche Demokratieformen unterteilt: Als Lebens- und als Regierungsform (vgl. ebd., S.16). Im Kontext demokratischer Partizipation nach dem Vorbild der „Kinderstube der Demokratie“ stellt sich der Anspruch, beide Formen umzusetzen (vgl. ebd., S.16). In Bezug auf die For- schung fragt sich die Autorin, inwieweit eine Ritualisierung demokratischer Beteiligungsprakti- ken in Kindertageseinrichtungen auf Dauer erhalten werden kann und dennoch offen fur eine Ausweitung bleiben (vgl. ebd., S.97). AuBerdem kamen die Fragen auf, wie und wodurch sich ritualisierende Demokratiepraktiken im Lauf der Zeit andern, was die Akteur*innen in rituali- sierten Demokratiepraktiken lernen und welche Ordnung in den Ritualen der Demokratiebil- dung aufgefuhrt und folglich (re)produziert werden (vgl. ebd., S.97). Die letzten Aspekte, die Lehmann in ihrer Forschung erfragt, thematisieren ob und wie Demokratierituale in Kinderta- geseinrichtungen disziplinieren und was, auf welche Weise in diesen Ritualen „transzendiert“ wird (vgl. ebd., S.97).
Die gewahlte Forschungsmethode der Autorin, um diese Fragen zu bearbeiten ist die Ethno- grafie (vgl. ebd., S.98). Durch unter anderem teilnehmende Beobachtungen in den Vollver- sammlungen der Einrichtung schlieBt Lehmann auf ihre Ergebnisse: Formal wird Partizipation im Sinne der Demokratiebildung nach den Anspruchen des Konzepts der „Kinderstube der Demokratie“, mit der Existenz einer Verfassung, dem Durchfuhren regelmaBiger Vollversamm- lungen, mit jeweils einer Tagesordnung und dem dortigen Erstellen von Protokollen, erfullt (vgl. ebd., S.294). Allerdings verhindert die Methode des Aufnehmens der Vorschlage der Kinder deren tatsachliche Beteiligung (vgl. ebd., S.294). Es entsteht eine Abhangigkeit der Kinder von den Fachkraften bei dem Notieren ihrer Beitrage, da dies nur durch die Hilfe eines Erwachse- nen moglich ist (vgl. ebd., S.294). AuBerdem gibt Lehmann an, dass sowohl dieses Verfahren als auch die Ritualisierung der Vollversammlung selbst, den Fachkraften ein Argument gibt, den Kindern nicht zuzuhoren (vgl. ebd., S.294). Dies wird mit der Einhaltung der Form als Voraussetzung fur Beteiligung begrundet (vgl. ebd., S.294). Folgend wird auf die Umsetzung auf der Ebene der Interaktionen zwischen Fachkraften und Kindern eingegangen, die zwar im Alltag im Sinne der Selbstbestimmungsmoglichkeiten umgesetzt wird, im Kontext der Vollver- sammlung allerdings nicht (vgl. ebd., S.294f.). Dies wird mit der Einhaltung der padagogischen Ordnung begrundet (vgl. ebd., S.295). Die Ausfuhrungen legen die unterschiedliche Umset- zung von Partizipation innerhalb einer Einrichtung dar, wobei nicht die einzelnen Fachkrafte den auschlaggebenden Faktor darstellen, sondern die Situation der Zusammenkunft in einem Gremium im Sinne der „Kinderstube der Demokratie“.
Die zweite Forschung wurde von Elisabeth Richter, Teresa Lehmann und Benedikt Sturzen- hecker durchgefuhrt und hat den Titel „Demokratiebildung in Kindertageseinrichtungen“ (vgl. Richter et.al. 2017, S.10). Es wird der Zusammenhang zwischen der Einfuhrung demokrati- scher Strukturen nach dem Konzept der „Kinderstube der Demokratie“ und den Potenzialen demokratischer Bildung im Bereich fruhkindlicher Padagogik untersucht (vgl. ebd., S.52). Das Konzept erlautern die Autor*innen zunachst durch die Erklarung der konzeptionellen Grund- annahmen (vgl. Hansen/Knauer 2017, S.16). Hierfur wird zunachst die Notwendigkeit des Er- lernens und somit auch die Erziehung zu Demokratie erlautert (vgl. ebd., S.16), um anschlie- Bend auf die Kindertagesstatte als erste Institution einzugehen, in der Kinder fur gewohnlich zum einen das erste Mal erleben, wie sich eine Gemeinschaft auBerhalb der Familie struktu- riert und zum anderen verschiedene Demokratieformen erleben und aktiv daran teilhaben kon- nen (vgl. ebd., S.17). Folgend wird auf den Zusammenhang demokratischer Partizipation und den Bildungsprozessen der Kinder eingegangen (vgl. ebd., S.18). Partizipation wird hier eine „Doppelfunktion“ zugeschrieben, die einerseits den Fachkraften Zugang zu den Themen der Kinder gibt und ihnen andererseits ermoglicht die Kinder als „Bildungsassistent*innen“ in ihrem individuellen Bildungsprozess zu unterstutzen (vgl. ebd., S.18). In diesem Kontext wird Partizipation ebenfalls als Erziehungsziel bezeichnet, das die Entwicklung einer eigenverantwortli- chen und gemeinschaftsfahigen Personlichkeit umfasst und die Machtverhaltnisse in Kinder- tagesstatten aufweicht (vgl. ebd., S.18). Im nachsten Kapitel werden, die zur Partizipation- sumsetzung benotigten Bildungsprozesse beschrieben (vgl. ebd., S.18f.). Die Fachkrafte wer- den herausgefordert, sich mit ihrem eigenen demokratischen Verhalten auseinanderzusetzen und weiterzuentwickeln (vgl. ebd., S.18f.). AuBerdem sind spezifische fachliche Kompetenzen notwendig, um Demokratiebildung in Kindertageseinrichtungen zu fordern, die zumeist erst entwickelt werden mussen (vgl. ebd., S.19). Nach einer weiteren Beschreibung des Konzepts, auf dem die hier thematisierte Forschung beruht, werden die Fragestellungen dieser vorge- stellt. Im Fokus der Untersuchung steht, wie demokratische Partizipation in Kindertagesein- richtungen mit Verfassung hergestellt wird, ob die Kinder in den jeweiligen Einrichtungen deliberative Demokratie konnen und wie zufrieden die Kinder mit der demokratischen Praxis sind (vgl. Richter et.al. 2017, S.53f.). Die Ergebnisse zu diesen Fragen zeigen eine Differenz in den Umsetzungen des Konzeptes in den einzelnen Einrichtungen: Wahrend sich alle Einrichtungen bezuglich der Herstellung einer Demokratie als Lebensform an die Trennung zwischen Selbst- bestimmung und der Beteiligung mithilfe von Gremien halten, werden in der Gewichtung der jeweiligen Formen groBe Unterschiede festgestellt (vgl. ebd., S.260). Bezuglich der Frage, ob Kinder Demokratie konnen wurde festgestellt, dass sie sowohl auf der kognitiven, praktischen und moralischen Ebene demokratische Kompetenzen aufweisen (vgl. ebd., S.263). Auch der befragte Aspekt der Zufriedenheit der Kinder wird hier in Zusammenhang mit einem hohen Engagement als positiv bewertet (vgl. ebd., S.264). Auch in dieser Studie zeigt sich bereits unter wenigen Kindertagesstatten als Forschungsfeld eine Differenz in der jeweiligen Umset- zung von Partizipation nach der „Kinderstube der Demokratie".
Diese Beispiele verdeutlichen, dass sich in der Umsetzung von Partizipation in Kindertages- statten nach dem gleichen Partizipationskonzept Unterschiede und „Fehler" zeigen. Bezuglich der zweiten Beispielforschung ist auBerdem zu erwahnen, dass es sich bei der Wahl der Kin- dertagesstatten fur die Untersuchung um „Best-Practice" Projekte handelt (vgl. ebd., S.55). Das lasst vermuten, dass die Einrichtungen, die ebenfalls nach dem Konzept der „Kinderstube der Demokratie" arbeiten, es aber nicht auf die Liste der Best-Practice geschafft haben, Parti- zipation ebenfalls anders als das Originalkonzept es vorsieht, umsetzen, wenn es nicht sogar zu groBen Unterschieden oder „Schein-Partizipation" kommt. Mogliche Grunde sind auf eine Situations- oder Einrichtungsabhangigkeit zuruckzufuhren, wie die dargelegten Forschungen beweisen. AuBerdem kommen weitere Grunde, wie beispielsweise Unstimmigkeiten bezuglich der Partizipationsintensitat im Team oder individuelle Vorstellungen der Umsetzungsweisen der unterschiedlichen Fachkrafte in Frage . Auch die jeweiligen Beschreibungen des Konzepts „die Kinderstube der Demokratie" verdeutlichen die Unterschiede in dem Verstandnis und der Fokusse des grundlegenden Partizipationsmodells. Lehmann bestatigt diese Annahme und nennt den Grund fur verschiedene Umsetzungsweisen sind unterschiedliche Vorstellungen was unter Partizipation verstanden wird (vgl. Lehmann 2020, S.2).
Deshalb wird die vorliegende Arbeit sich auf die Ebene der Ansichten und Verstandnisse fo- kussieren. Es wird zunachst der Frage nachgegangen, welche Vorstellungen sich in den je- weiligen Buchern bezuglich der Umsetzung von Partizipation zeigen, um darauf basierend in der Diskussion auf die jeweilige Auffassung zu Partizipation zu schlieBen.
3. Theoretische Vorannahmen
Fur eine Ubersicht, von welchen Begrifflichkeiten in dieser Arbeit ausgegangen wird und fur die Bestatigung der in der Fragestellung formulierten Annahme, dass es unterschiedliche Vor- stellungen von Partizipation gibt, werden folgend verschiedene Begriffsdefinitionen erlautert, um schlieBlich auf die jeweiligen Begriffsverstandnisse dieser Arbeit, uberzuleiten.
3.1. Begriffserlauterung: „Partizipation“
Bei der Recherche moglicher Partizipationsdefinitionen ist aufgefallen, dass dieser Begriff in auBerst vielfaltigen Zusammenhangen, Schwerpunkten und (Berufs-)Feldern zu finden ist. Sabine Fischer geht auf diese Vielfaltigkeit ein und bezeichnet Partizipation als einen unscharfen Begriff, der vielfaltige Bedeutungen hat (vgl. ebd., S.65). In ihren folgenden Erlauterungen geht sie zunachst auf die lateinische Wortbestimmung von Partizipation ein, die sie anschlieBend mit der Frage nach Macht und Herrschaft verknupft (vgl. ebd., S.65). AnschlieBend stellt Fischer die Bedeutung der Begriffe Teilhabe, Teilnahme und Beteiligung, die im allgemeinen wissenschaftlichen Diskurs um Partizipation in der Regel in den meisten Definitionen genutzt werden, dar (vgl. ebd., S.66). Teilhabe wird hier als „(...) die Art und Weise, in der Menschen Zugang zu Prozessen, Institutionen, Gutern und Leistungen einer Gesellschaft haben (...).“ (ebd., S.66) definiert und damit von den Begriffen Teilhabe und Beteiligung abgegrenzt wird, die mit der Art und Weise verknupft werden, wie der freie Wille ausgedruckt oder Entscheidun- gen getroffen werden (vgl. ebd., S.66). Im Anschluss geht die Autorin naher auf die gesell- schaftliche und auf die soziale Dimension von Kinderbeteiligung ein und zeigt zum einen den Zusammenhang zwischen gesellschaftlichen In- und Exklusionsfaktoren und den jeweiligen Beteiligungsmoglichkeiten und zitiert zum anderen Richard Schroder fur eine soziale Partizi- pationsdefinition (vgl. ebd., S.66). Dieser legt in seiner Begriffsbestimmung Wert auf gemein- same Entscheidungsfindung und Problemlosung (vgl. ebd., S.66). Laut Fischer fuhrt Schroder weiterhin demokratische Kompetenzen, wie unter anderem Verantwortungsbewusstsein und Entscheidungsfahigkeit als Voraussetzungen fur das Gelingen von Partizipation nach dieser Vorstellung auf (vgl. ebd., S.66). AnschlieBend zieht sie einen Vergleich der beiden Definitio- nen und legt als Gemeinsamkeit das Verstandnis von Partizipation als „(...) ein[en] auf der Aktivitat des Individuums basierende[n] Prozess (...).“ (ebd., S.66, Auslassung J.B., Einfugung J.B.) fest und setzt diesen in Abhangigkeit individueller Voraussetzungen von Partizipation und des Kontextes der jeweiligen Situation (vgl. ebd., S.66). Fischer schlieBt daraus, dass Partizi- pation immer in einem Spannungsfeld zwischen Individuum und Gesellschaft liegt (vgl. ebd., S.66) . Im nachsten Absatz wird zwischen enger Partizipation, als die Beteiligung im offentli- chen und politischen Leben und weitreichender Partizipation, als Lebensform im Alltag unter- schieden, um folgend auf einschrankende Beteiligungsperspektiven hinzuweisen (vgl. ebd., S.66) . Die Partizipationsmoglichkeiten der Kinder werden hier laut der Autorin durch spezifi- sche Besonderheiten beschrankt und dabei als „Vorform“ oder „symbolische Form“ bezeich- net, die von Erwachsenen zu Lernzwecken konzipiert werden (vgl. ebd., S.66f.). In diesem Zusammenhang warnt Fischer vor missbrauchlicher Instrumentalisierung von Partizipation fur die Zwecke Erwachsener (vgl. ebd., S.67).
AuBer die bei Fischer erlauterten gesellschaftlichen und sozialen Bereiche von Partizipation, konnten bei der Recherche noch weitere festgestellt werden, die beispielsweise die Disziplin der Politik. Die Bundeszentrale fur politische Bildung definiert Partizipation wie folgt: „In demo- kratischen Staaten die freiwillige Beteiligung der Burgerinnen und Burger am politischen Leben im weitesten Sinne, um dadurch Einfluss auf Entscheidungen zu nehmen.“ (Bundeszentrale fur politische Bildung).
Ein weiteres Feld von Partizipation ist die soziale Arbeit, genauer die Hilfen zur Erziehung, in der im Kontext von Partizipation die Erwachsenen oder altere Jugendliche als Betroffene an- gesprochen werden, was aus den Beschreibungen der beidseitigen Aufgaben im Partizipati- onsprozess geschlossen werden kann. Heinz Messmer, der den thematisierten Beitrag ver- fasst hat, geht zunachst auf Partizipation als Prozess ein und spezifiziert diesen als bilateralen Prozess, indem er auf die Notwendigkeit zweier Akteure hinweist (vgl. Messmer 2018, S.5). Durch das Einraumen von Einfluss des einen und die Nutzung des Einflusses des anderen Akteurs, wird verdeutlicht, dass Partizipation im Idealfall ein wechselseitiges Verhaltnis wider- spiegelt (vgl. ebd., S.5f.). Daraufhin stellt der Autor „nicht ideale“ (vgl. ebd., S.6) Konstellatio- nen vor, die vorkommen, wenn Einflussmoglichkeiten entweder nicht eingeraumt oder nicht genutzt werden (vgl. ebd., S.6). AnschlieBend wird auf die unterschiedlichen Stufen von Par- tizipationsqualitat verwiesen und damit in Zusammenhang Leit- und Stufenmodelle naher dar- gelegt, die die Partizipationsintensitat in verschiedene Ebenen einteilt und damit bewertet (vgl. ebd., S.6). Der Autor nutzt die von ihm verwendete Darstellung der unterschiedlichen Ebenen von Florence Fritz, um zu verdeutlichen, dass in dem Bereich der Hilfen zur Erziehung die Aufgaben von Partizipation auf beiden Seiten gesehen werden: Einerseits muss Beteiligungs- fahigkeit gefordert und hergestellt werden, durch beispielsweise die Bereitschaft Informationen zu geben oder Standpunkte zu erfragen und anderseits muss Beteiligungsfahigkeit auch ge- nutzt werden, beispielsweise durch die Bereitschaft, sich informieren zu lassen oder sich selbst Informationen einzuholen (vgl. ebd., S.6f.). Die Wahrscheinlichkeit realer Partizipationspro- zesse wird hier in Abhangigkeit dieser Wechselwirkung gestellt (vgl. ebd., S.7). Der Autor kommt zu dem Schluss, dass sich Partizipation in einem „Spannungsfeld der Aneignung und des Loslassens von Entscheidungsmachtigkeit auf unterschiedlichen Teilhabestufen" bewegt (vgl. ebd., S.7). Um von der Beteiligung Erwachsener und Jugendlicher auf Jugendliche und altere Kinder uberzuleiten, wird folgend die Studie der Bertelsmann Stiftung aufgegriffen.
Die Bertelsmann Stiftung hat fur diese Untersuchung uber die Partizipation von Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 18 Jahren die Bereiche der Familie, der Schule und der Kommune erforscht (vgl. Bertelsmanns Stiftung 2008, S.5). Partizipation wurde in die- sem Zusammenhang als die Mitgestaltung, Mitwirkung, Mitentscheidung und Verantwortungs- ubernahme bezeichnet, wobei ebenfalls Kinder und Jugendliche angesprochen werden (vgl. ebd., S.7). Ahnlich wie Fischer verweisen die Autoren auch hier auf die Vielzahl der Definiti- onsmoglichkeiten, die auch in der Fachliteratur zu finden sind und folgern daraus die Notwen- digkeit der Auseinandersetzung mit diesem Begriff, den sie mit der sprachlichen Herkunft ein- leiten (vgl. ebd., S.7). Um mit einem Verweis auf weitere Onlinequellen auf den Bereich der Kinder- und Jugendpartizipation uberzuleiten (vgl. ebd., S.7). Hier findet sich eine erste Definition als „einen Teil der Verfugungsgewalt uber die eigene Lebensgestaltung an sich zu neh- men." (ebd., S.7). Folgend wird auf die in diesem Kapitel bereits angesprochenen Modelle zu der Partizipationsintensitat naher eingegangen und schlieBlich anhand der Auseinanderset- zung mit diesen eine fur die Autor*innen „endgultige" Definition festgelegt: „Kinder [sic!] und Jugendpartizipation ist das aktive und nachhaltige Mitwirken und Mitbestimmen von Kindern und Jugendlichen an Planungen und Entscheidungen, die ihre Lebenswelt betreffen, sowie an deren Verwirklichungen." (ebd., S.12)
Mit den Definitionen in den Bereichen der Politik, der sozialen Arbeit und der Kinder- und Ju- gendforschung wurde sich dem Bereich der Kinder im fruhen Alter genahert und somit auch dem Begriff der Kinderbeteiligung - der Partizipation von Kindern. Folgend soll auf fruhkindli- che Partizipation im Rahmen von Kindertagesstatten eingegangen werden. Dafur wird auf Jorg Maywald zuruckgegriffen. In seinem Beitrag „Das Recht gehort zu werden. Beteiligung als Grundrecht jedes Kindes." beschreibt er im Detail die Beteiligungsrechte der Kinder und setzt diese schlieBlich in den Kontext der (fruh)padagogischen Arbeit (vgl. ebd., S.24). In diesem Zusammenhang werden Anforderungen an die Beteiligungsprozesse von Kindern, die der UN- Ausschuss zu Artikel 12 der UN-Kinderrechtskonvention verfasst hat, von dem Autor erlautert (vgl. Maywald 2016, S.27). Zum ersten wird fur den Beteiligungsprozess der Anspruch gestellt, in diesem transparent und informativ vorzugehen: Die Kinder mussen ihrem Alter entspre- chend vollstandig informiert werden (vgl. ebd., S.27). Das beinhaltet das Wissen um deren Rechte der MeinungsauBerung und deren Beachtung, sowie relevante Informationen uber die Beteiligung selbst (vgl. ebd., S.27). Zum zweiten geht Maywald auf die Freiwilligkeit der Kinder in den Partizipationsprozessen ein, der niemals erzwungen werden darf: Die Kinder haben die Wahl, ob sie sich beteiligen wollen und sie sollten daruber informiert sein, dass sie ihre Betei- ligung jederzeit abbrechen konnen (vgl. ebd., S.27). Im dritten Punkt wird ein respektvoller Umgang mit den Meinungen der Kinder betont und darauf hingewiesen, dass diese die Gele- genheit bekommen sollen, eigene Ideen und Handlungen einzubringen (vgl. ebd., S.27). Des Weiteren wird die Notwendigkeit einer Bedeutsamkeit der Themen fur die Kinder angespro- chen: Sie sollen fur das Kind von Belang sein und die Moglichkeit bieten auf sein Wissen und Kompetenzen zuruckzugreifen. AuBerdem soll fur die Kinder die Gelegenheit bestehen, wich- tige Themen anzusprechen (vgl. ebd., S.27). Als „kinderfreundlich“ (vgl. ebd., S.27) werden die Anpassung der Umgebung und der Methoden an die Kinder bezeichnet (vgl. ebd., S.27). Hierzu werden genugend Ressourcen, wie Zeit und Mittel und die Berucksichtigung verschie- dener Unterstutzungs- und Beteiligungsformen gezahlt (vgl. ebd., S.27f.). Eine gelingende Partizipation wird an dieser Stelle mit einer inklusiven Denk- und Handlungsweise verknupft, die den Anspruch erhebt, Kinder nicht als homogene Gruppe wahrzunehmen, sondern ihnen kultursensibel zu begegnen und allen Kindern die gleichen Gelegenheiten zu Partizipation zu bieten (vgl. ebd., S.28). Der darauffolgende Punkt „Unterstutzung durch BildungsmaBnahmen“ (ebd., S.28) spricht die Notwendigkeit von Vorbereitung und Unterstutzung der Fachkrafte an, die ihnen die Beteiligung der Kinder erleichtern (vgl. ebd., S.28). Darunter wird beispielsweise das Zuhoren und mit Kindern zusammenarbeiten, verstanden (vgl. ebd., S.28). AnschlieBend wird die Verantwortung der Fachkrafte fur die Sicherheit der Kinder thematisiert und zu der Erarbeitung einer „Kinderschutz-Strategie“ aufgefordert (vgl. ebd., S.28). Diesbezuglich sollten die Kinder daruber informiert werden, dass sie ein Recht auf Schutz vor Schaden haben und die Notwendigkeit wird betont, dass sie wissen wo sie Hilfe erhalten (vgl. ebd., S.28). Als letzte Anforderung wird die Rechenschaftspflichtigkeit der Fachkrafte angesprochen: Die Beteili- gungsprozesse mussen reflektiert und die Kinder uber das Verstehen und die Nutzung ihrer Meinungen informiert werden (vgl. ebd., S.28). Sie sollten die Moglichkeit bekommen, die ge- troffenen Schlussfolgerungen zu hinterfragen und sich an Evaluationsvorgangen zu beteiligen (vgl. ebd., S.28).
Nach dieser Zusammenfassung unterschiedlicher Partizipationsverstandnisse in unterschied- lichen (beruflichen/professionellen) Feldern, werden nun verschiedene Schwerpunkte von Partizipation erlautert.
Rudiger Hansen legt in seiner Definition verschiedene Schwerpunkte. Einer dieser ist Partizi- pation als Bestandteil der alltaglichen Beziehungen zwischen den Fachkraften und Kindern (vgl. Hansen 2003). Hansen beschreibt hier, dass fur eine erfolgreiche Beteiligung eine Haltung notwendig ist, die sich durch Authentizitat, Ehrlichkeit und ohne padagogische Hinterge- danken in der taglichen Begegnung der Kinder auszeichnet (vgl. ebd.). Kinder sollen als gleich- wertige Partner*innen angesehen werden, anstatt ihnen Denken und Verantwortung abzuneh- men (vgl. ebd.). Als nachsten Schwerpunkt nennt Hansen die Beeinflussung von Einrichtungs- strukturen auf den Partizipationsprozess (vgl. ebd.). Hier stellt der Autor Fragen zur Selbstuberprufung wie unter anderem: Welche Moglichkeiten die Kinder haben zu wahlen, womit und wie frei sie ihre Spielgerate wahlen durfen, ob sie die Moglichkeit haben, Funkti- onsraume ohne Erwachsene zu nutzen oder ob die Kinder selbst entscheiden durfen, wann sie etwas essen wollen (vgl. ebd.). Als nachster Punkt wird eine strukturelle Verankerung als grundlegend fur die Sicherung der Rechte der Kinder auf Beteiligung und deren Details, be- schrieben. AnschlieBend wird die Bedeutsamkeit einer Partizipation auf politisch-administrati- ver Ebene erlautert, um auf die Einbeziehung der Eltern und des Teams uberzuleiten (vgl. ebd.).
Folgend wird auf Christian Buttner eingegangen, der mit der Grundung von Demokratiewerk- statten als besonderen Schwerpunkt den Fokus auf die Entwicklung demokratischer Kompe- tenzen legt (Buttner 2006, S.6). Die Kinder sollen dort „(.) verantwortungsvolles Bewusstsein fur ihre Partizipationsmoglichkeiten in einer demokratischen Gesellschaft (...) (ebd., S.6, Aus- lassung J.B.) lernen (vgl. ebd., S.6). AuBerdem soll den Kindern bewusst werden, dass sie die Moglichkeit haben, ihr Umfeld aktiv mitzugestalten und sie nicht in eine passiven Akzeptanz fallen (vgl. ebd., S.6). Als ein weiteres Ziel wird die „Vermittlung“ (vgl. ebd., S.68) kommunika- tiver Fahigkeiten zur Nutzung in demokratischen Prozessen und Debatten festgelegt (vgl. ebd., S.68). Durch aktives Erarbeiten demokratischer Verfahren, das Debattieren, Wahlen und das Verdeutlichen relevanter Rollen fur eine Demokratie, sollen die Kinder auf demokratische Pro- zesse vorbereitet werden (vgl. ebd., S.68). Weitere Ziele der Demokratiewerkstatt beziehen sich auf „Massendemokratie“ und auf das Erkennen und Entgegenwirken von Intransparenz politischer Entscheidungen und von Machtmissbrauch (vgl. ebd., S.69).
Diese Ubersicht der unterschiedlichen Definitionen fur Partizipation zeigen die Komplexitat des Begriffes und die groBen Unterschiede der jeweiligen Verstandnisse, die in der vorliegenden Arbeit ebenfalls thematisiert werden.
Aus dieser Literaturzusammenstellung und aus der Recherche ergibt sich fur diese Arbeit ein Partizipationsverstandnis, das von einer respektvollen und wertschatzenden Haltung im Alltag den Kindern gegenuber gekennzeichnet ist, die mit einer standigen Reflexion der Fachkrafte einhergeht (vgl. Hansen 2003, vgl. Hansen/Knauer 2016, S.65). Den Kindern muss in diesem Kontext Selbstbestimmung, sowohl bei alltaglichen Entscheidungen als auch in der Gestaltung ihrer Bildungsprozesse und Mitbestimmung im Sinne Schroders, der unter anderem von Sabine Fischer zitiert wird, ermoglicht werden (vgl. Fischer 2017, S.66). Dafur ist die Abgabe von Macht der Erwachsenen an die Kinder unbedingt notwendig und stellt zugleich eine bevor- mundende Haltung den Kindern gegenuber in Frage (vgl. Fischer 2017, S.67, vgl. Maywald 2016, S.16, 22). Das zentrale Motiv wahrend dem partizipativen Umgang der Erwachsenen mit den Kindern sollten einzig die Rechte und das Wohl des Kindes sein. Wird aus Motiven der Erwachsenen heraus Partizipation beispielsweise fur die Durchsetzung ihrer eigenen Vor- stellungen oder zur Erreichung padagogischer oder politischer Ziele genutzt, findet eine In- strumentalisierung von Partizipation und somit ein Machtmissbrauch statt (vgl. Fischer 2017, S.67) . Jegliche positive „Nebenwirkungen" von Partizipation sind als komplementare Zugabe zu sehen, durfen aber nicht der Grund fur die Umsetzung sein. Maywald bestatigt das und schreibt: „Erwachsene haben die Pflicht, ihre Macht3 nicht fur eigene Zwecke, sondern aus- schlieBlich an den besten Interessen des Kindes (Kindeswohl) orientiert zu gebrauchen." (Ma- ywald 2016, S.21)
3.2. Begriffserleuterungen: „Partizipationsmodell“, „Kindertageseinrichtungen“, „exemplarisch“
Fur die Definition eines „Partizipationsmodells" wurde auf den Duden zuruckgegriffen, um den Prozess der Themenfindung und damit auch die Begriffsauswahl und -verstandnisse moglichst authentisch widergeben zu konnen. Es wurde an dieser Stelle als Definitionsquelle kein erzie- hungswissenschaftlicher Kontext gewahlt, da die Bedeutungsvorstellung eines „Modells" nicht durch die Ausbildung und der naheren Beschaftigung im fruhkindlichen Bereich entwickelt wurde, sondern bereits fruher in einem impliziten, subjektiven gesellschaftlichen Kontext. Der Duden bietet fur diese Arbeit im Kontext fruhkindlicher Bildung und Erziehung zwei mogliche Definitionen: „etwas, was (durch den Grad seiner Perfektion, Vorbildlichkeit o.A.) fur anderes oder fur andere Vorbild, Beispiel, Muster sein kann" oder „als Muster gedachter Entwurf" („Mo- dell" Duden online). Bezogen auf diese Arbeit bedeutet das, dass ein Modell etwas ist, „dass durch den Grad seiner Vorbildlichkeit" (hier im Sinne des nachweislichen „Erfolgs") „fur andere ein Vorbild" (hier im Sinne einer Orientierungshilfe) sein kann. Auch die zweite Definition deutet durch die Formulierung des „Musters" auf eine Vorbildfunktion hin. Diese „Vorbildfunktion" wird im Kontext der ausgewahlten Bucher, wie bereits angesprochen, im Sinne einer Handlungs- orientierung fur Fachkrafte in Bezug auf die Umsetzung von Partizipation gesehen. Auch die Verwendungen des Begriffs „Modell" in der Fachliteratur deutet auf ein ahnliches Verstandnis hin.
[...]
1 Tagesschau vom 11.01.2021. [Online] unter : https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/kinder- rechte-grundgesetz-107.html (zul. abgerufen: 16.01.2021)
2 Stand 2017: Bundesweit in mehr als 200 Einrichtungen (vgl. Lehmann 2020, S.15.)
3 Macht wird hier als die Asymmetrie in der Beziehung zwischen Kind und FK beschrieben, die sich durch die Verantwortung gegenuber dem Kind ergibt, ihnen ihre Rechte zu ermoglichen bzw. sie zu ihrem Recht kommen zu lassen (vgl. Maywald 2016, S.21)
- Quote paper
- Jessica Busch (Author), 2021, Partizipation in Kindertageseinrichtungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1249841