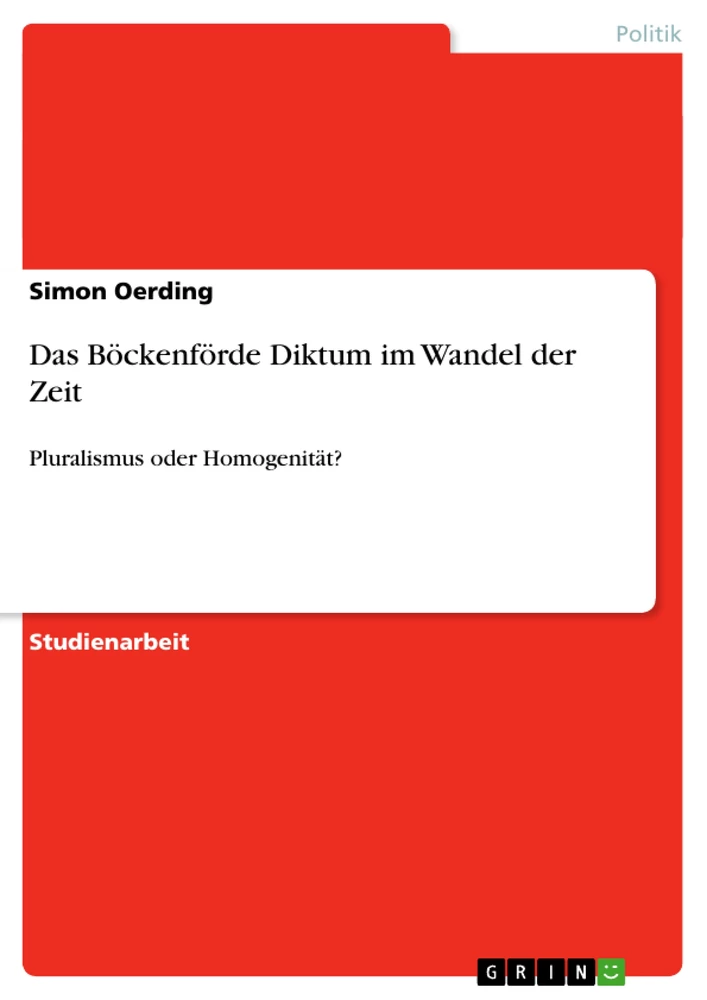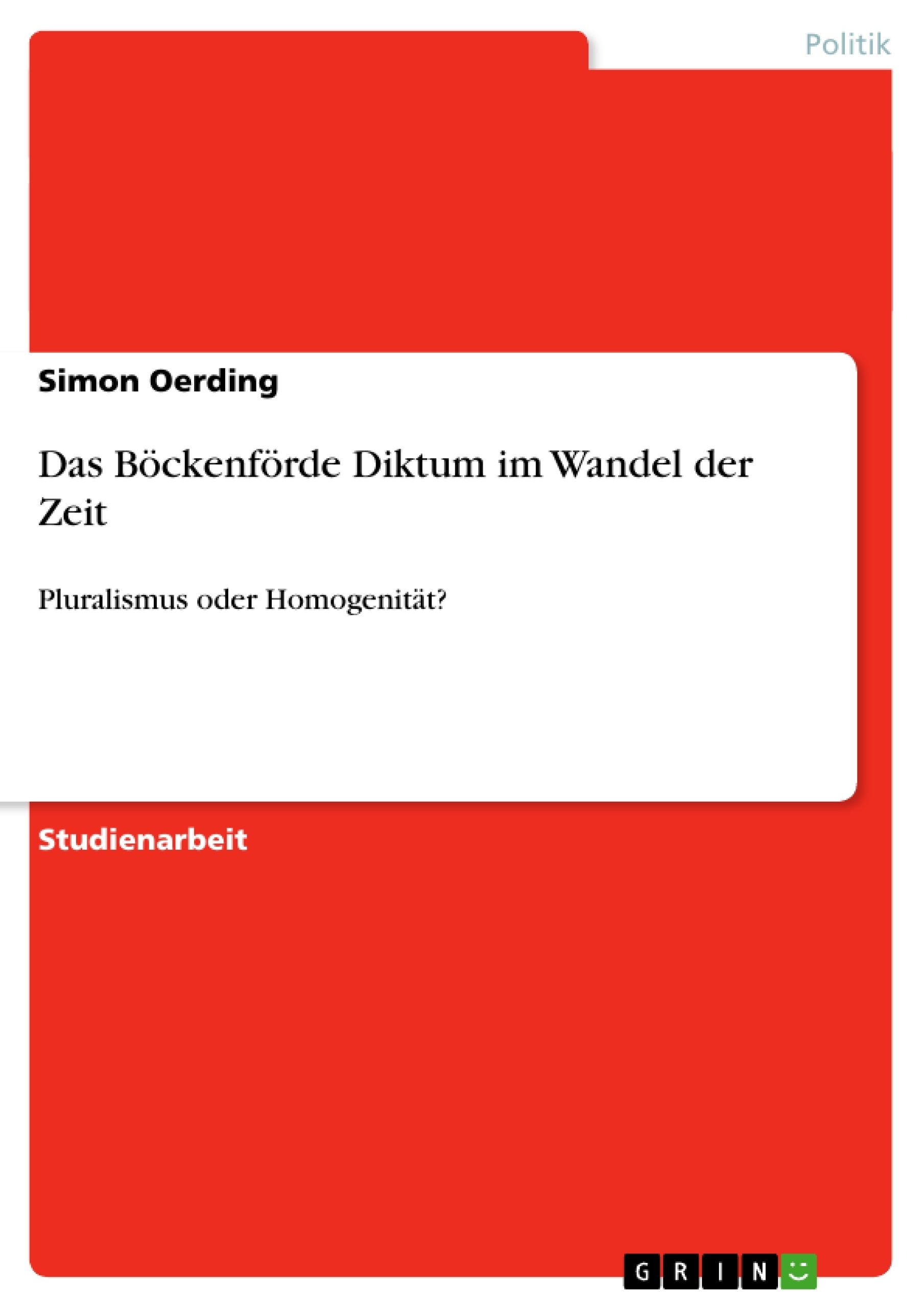Als einer der einflussreichsten heutigen Staatstheoretiker genießt Ernst-Wolfgang Böckenförde
unter Juristen, Philosophen und Staatskirchenrechtlern ein hohes Ansehen.
Begründen tut sich die Prominenz Böckenfördes nicht zuletzt durch das mittlerweile
zum geflügelten Wort erhobene Diktum, welches er im Jahre 1967 formulierte: „Der
freiheitliche säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren
kann.“ (Böckenförde 1967: 112) Seit 1967 hat sich nicht nur der Diskurs um die
vorpolitischen Grundlagen des Staates verändert, deutlich heben sich auch die Lebensumständen
und die Struktur innerhalb der heutigen Gesellschaft von der Zeit der späten
60er Jahre ab. Diese Feststellung allein hindert nicht daran, die These Böckenfördes
weiterhin als Element der staatsphilosophischen Allgemeinbildung zu verstehen.
Dabei erscheint es angezeigt, das Böckenförde-Diktum und die ihm innewohnenden
Komponenten einem Test an der sich verändernden Realität zu unterziehen. Inzwischen
stellt auch Böckenförde fest, dass ein Verlass einzig auf die Religion als Kitt der staatlichen
Ordnung heutzutage an Wunschdenken grenzen würde. Kommt es daher folgerichtig
im Zuge der gesellschaftlichen Veränderungsprozesse zu einer Neuausrichtung der
These? Sollte dies nicht so sein, warum bleibt Böckenförde auch im Angesicht des
strukturellen Wandels der Gesellschaft seiner These treu und welche Probleme birgt
dies für die Einschätzung der vorpolitischer Grundlagen des Staates?
Um diese Fragen zu erörtern, wird im Folgenden zunächst ein kurzer Überblick über die
argumentative Struktur des Böckenförde-Diktums gegeben, der unter anderem eine
Auseinandersetzung mit der Böckenförde leitenden staatsrechtlichen Konzeption Carl
Schmitts einschließt. Es kristallisieren sich dabei im Wesentlichen zwei Faktoren heraus,
welche für eine Analyse des Diktums in Bezug auf gesellschaftliche Wandlungsprozesse
relevant erscheinen: die relative Homogenität des Volkes als vorpolitische
Grundlage des Staates und die Religion als hauptsächliche Vermittlungsinstanz derselben.
Im Abgleich mit den, für Böckenfördes These relevanten, Veränderungen der heutigen
Gesellschaft im Vergleich zu 1967 werden diese beiden Aspekte auf eine argumentative
Evolution hin untersucht, die als Anpassungsprozess verstanden werden
könnte. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Böckenförde-Diktum im kurzen Aufriss
- Die Homogenität als vorpolitische Grundlage - Böckenförde und Carl Schmitt
- Die veränderte gesellschaftliche Ausgangslage für Böckenfördes Diktum
- Relative Homogenität im Wandel der Gesellschaft
- Wandel der Vermittlungsinstanzen vorpolitischer Voraussetzungen
- Homogenität oder Pluralismus
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Aktualität des Böckenförde-Diktums ("Der freiheitliche säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann") im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen seit 1967. Sie analysiert, inwieweit die ursprünglichen Argumentationslinien Böckenfördes angesichts von Pluralisierung und Wandel der Vermittlungsinstanzen noch haltbar sind.
- Das Böckenförde-Diktum und seine argumentative Struktur
- Die Rolle der relativen Homogenität als vorpolitische Grundlage des Staates
- Der Wandel der Vermittlungsinstanzen (z.B. Religion) und ihre Bedeutung für die staatliche Ordnung
- Die Herausforderungen des Pluralismus für die These Böckenfördes
- Potenzielle Schwächen des Begründungsmodells Böckenfördes in der heutigen Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage nach der Aktualität des Böckenförde-Diktums in den Mittelpunkt. Kapitel 2 bietet einen Überblick über die Argumentationsstruktur des Diktums und die Rolle von Carl Schmitts staatsrechtlicher Konzeption. Es werden zwei zentrale Aspekte herausgearbeitet: die relative Homogenität der Gesellschaft und die Religion als Vermittlungsinstanz. Kapitel 3 analysiert die veränderte gesellschaftliche Ausgangslage im Vergleich zu 1967, wobei die Aspekte der relativen Homogenität und der Wandel der Vermittlungsinstanzen im Detail untersucht werden.
Schlüsselwörter
Böckenförde-Diktum, Säkularisierung, Homogenität, Pluralismus, Vermittlungsinstanzen, Religion, Staat, freiheitlicher Staat, Carl Schmitt, gesellschaftlicher Wandel.
- Quote paper
- BA Simon Oerding (Author), 2008, Das Böckenförde Diktum im Wandel der Zeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/124903