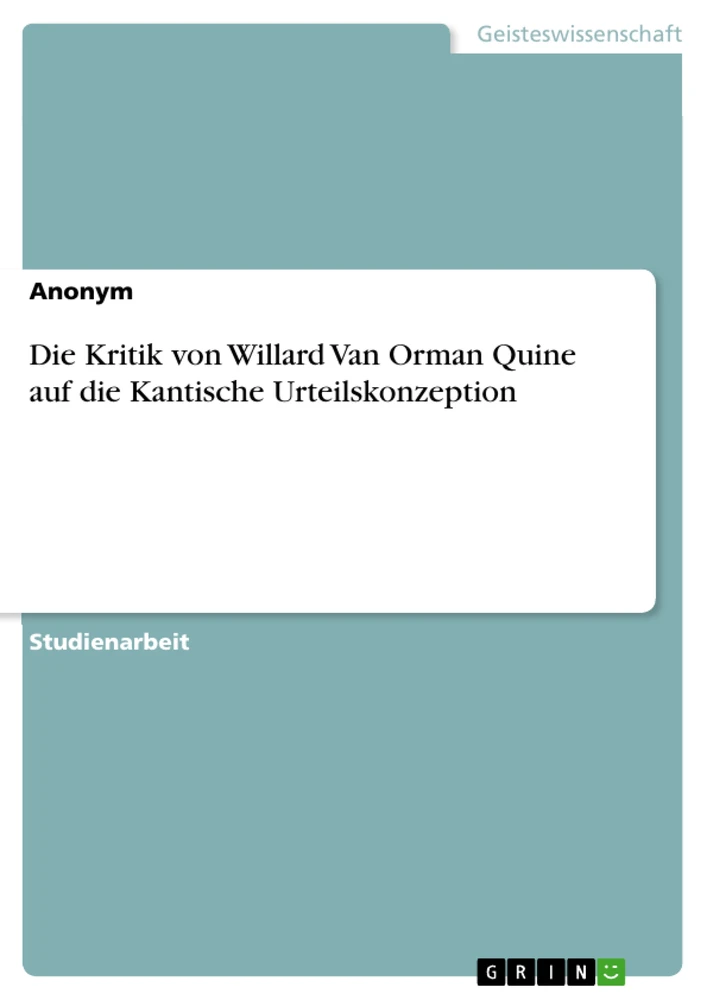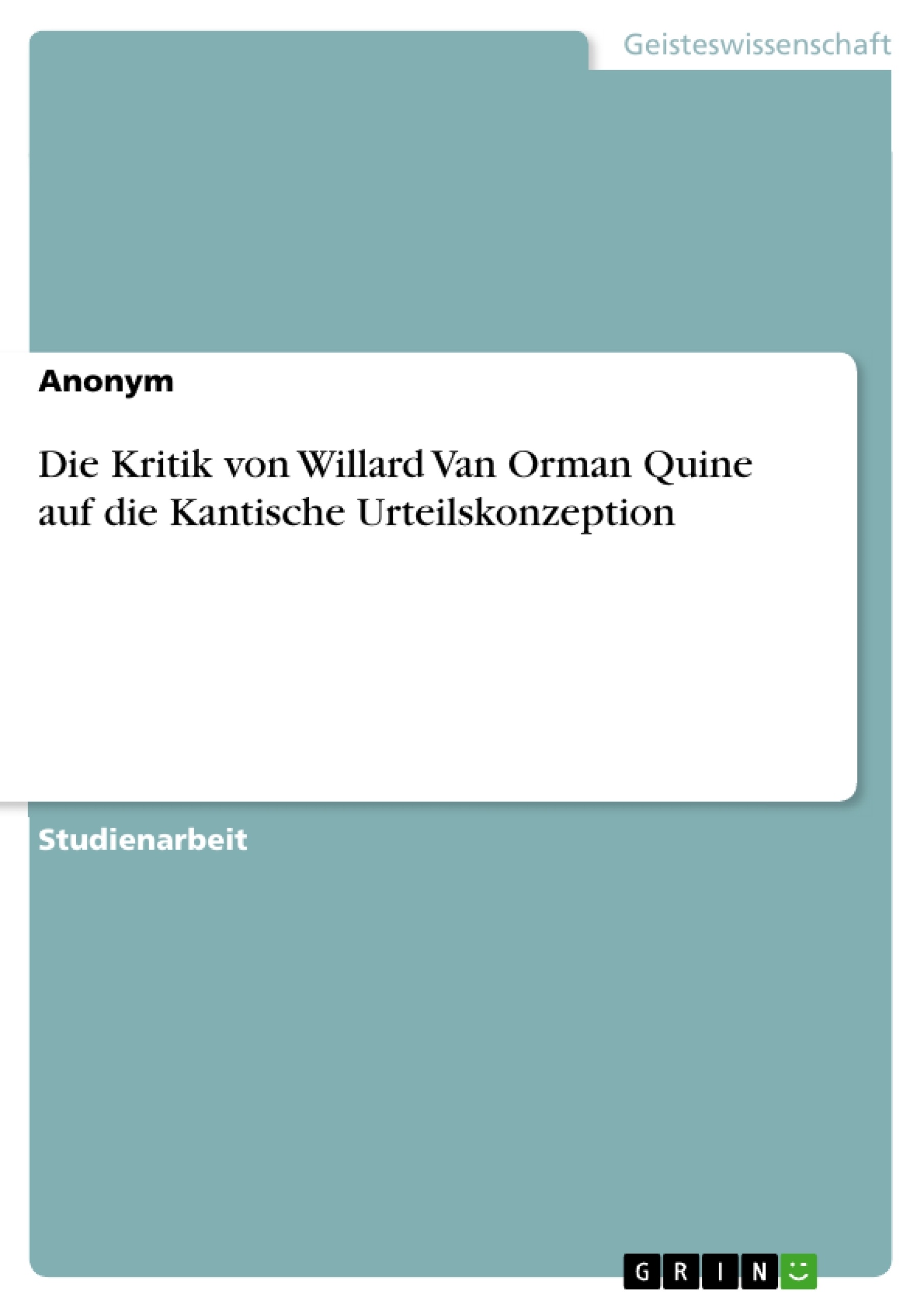In der Arbeit thematisiere ich die von Kant getroffene Unterscheidung in analytische und synthetische Urteile. Anhand der folgenden zwei Kapitel stelle ich die Bestimmungen beider Urteilsformen aus der Kritik der reinen Vernunft dar. Im Ersten entfalten sich zwei unterschiedliche Bestimmungen für analytische Urteile: eine eher metaphysische und eine formallogische. Im Zweiten ist neben der Bestimmung synthetischer Urteile auch deren von Kant postulierte mögliche Apriorizität herausgestellt. Das dritte Kapitel handelt von Quines Einwand auf diese duale Unterscheidung im Allgemeinen und die Schwierigkeit der Definition analytischer Urteile im Besonderen, die er vor allem in seinem Aufsatz „Zwei Dogmen des Empirismus“ abhandelt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Begriff des analytischen Urteils
- Der Begriff des synthetischen Urteils
- Quines Einwand auf die Konzeption beiderlei Urteilsbegriffe
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Kants Unterscheidung zwischen analytischen und synthetischen Urteilen und analysiert Quines Kritik an dieser Konzeption. Das Ziel ist es, Kants Definitionen beider Urteilsformen darzustellen und Quines Einwände, insbesondere seine Argumentation in "Zwei Dogmen des Empirismus", zu erläutern.
- Kants Definition analytischer Urteile
- Kants Definition synthetischer Urteile
- Quines Kritik an der analytisch-synthetischen Unterscheidung
- Die Rolle des Satzes vom Widerspruch bei Kant
- Apriorität und Aposteriorität von Urteilen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Fokus der Arbeit: die Darstellung von Kants Unterscheidung zwischen analytischen und synthetischen Urteilen und die Kritik daran durch Quine. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit mit der Erläuterung beider Urteilsformen in zwei separaten Kapiteln und der anschließenden Analyse von Quines Einwand.
Der Begriff des analytischen Urteils: Dieses Kapitel erläutert Kants Definition analytischer Urteile. Es werden zwei Aspekte beleuchtet: eine metaphysische Bestimmung, in der das Prädikat bereits im Subjekt enthalten ist, und eine formallogische Bestimmung, die sich auf den Satz vom Widerspruch stützt. Kant argumentiert, dass analytische Urteile a priori sind, da ihre Wahrheit durch die Analyse des Subjektbegriffs erkennbar ist. Das Kapitel illustriert dies anhand von Beispielen wie "Alle Körper sind ausgedehnt" und "Ein Dreieck ist dreiseitig", wobei letzteres durch eine detaillierte logische Analyse im Bezug auf den Satz vom Widerspruch veranschaulicht wird. Die Analyse zeigt, wie die Negation des Prädikats zu einem Widerspruch führt, was die Wahrheit des analytischen Urteils bestätigt.
Der Begriff des synthetischen Urteils: In diesem Kapitel wird Kants Verständnis synthetischer Urteile dargestellt. Im Gegensatz zu analytischen Urteilen wird hier das Prädikat dem Subjekt hinzugefügt, es ist nicht bereits im Subjektbegriff enthalten. Synthetische Urteile sind daher a posteriori und beruhen auf Erfahrung. Kant illustriert dies mit dem Beispiel "Alle Körper sind schwer". Das Kapitel betont, dass synthetische Urteile im Gegensatz zu analytischen Urteilen nicht a priori sind, sondern auf empirischer Erfahrung basieren. Die Verbindung zwischen Subjekt und Prädikat ist zwar möglich, aber nicht notwendig, da sie sich aus der Erfahrung ergibt. Das Kapitel verdeutlicht, wie die Erfahrung den Subjektbegriff erweitert und synthetische Urteile somit als "Erweiterungsurteile" bezeichnet werden können.
Schlüsselwörter
Analytische Urteile, Synthetische Urteile, Kant, Quine, Zwei Dogmen des Empirismus, Satz vom Widerspruch, A priori, A posteriori, Erfahrung, Begriffsanalyse, Metaphysik, Formallogik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Kant, Quine und die Analytisch-Synthetische Unterscheidung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht Immanuel Kants Unterscheidung zwischen analytischen und synthetischen Urteilen und analysiert die Kritik daran, die Willard Van Orman Quine in seinem Werk "Zwei Dogmen des Empirismus" vorgebracht hat. Der Fokus liegt auf der Darstellung von Kants Definitionen beider Urteilsformen und der Erläuterung von Quines Einwänden.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Kants Definitionen analytischer und synthetischer Urteile, Quines Kritik an der analytisch-synthetischen Unterscheidung, die Rolle des Satzes vom Widerspruch bei Kant, sowie die Konzepte der Apriorität und Aposteriorität von Urteilen. Es werden Beispiele analysiert, um die jeweiligen Urteilsformen zu veranschaulichen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Fokus und den Aufbau der Arbeit beschreibt. Es folgen Kapitel, die sich jeweils mit Kants Begriff des analytischen Urteils, Kants Begriff des synthetischen Urteils und schließlich Quines Kritik an beiden auseinandersetzen. Die Arbeit schließt mit einem Fazit ab.
Was sind analytische Urteile nach Kant?
Laut Kant sind analytische Urteile solche, bei denen das Prädikat bereits im Subjektbegriff enthalten ist. Ihre Wahrheit lässt sich durch logische Analyse des Subjekts, oft unter Rückgriff auf den Satz vom Widerspruch, erkennen. Sie sind a priori, d.h. unabhängig von Erfahrung wahr.
Was sind synthetische Urteile nach Kant?
Synthetische Urteile erweitern den Subjektbegriff um neue Informationen, die nicht schon im Subjektbegriff enthalten sind. Ihr Wahrheitsgehalt beruht auf empirischer Erfahrung und ist somit a posteriori. Sie sind nicht durch logische Analyse allein begründbar.
Welche Kritik übt Quine an der analytisch-synthetischen Unterscheidung?
Die Arbeit erläutert Quines Einwände gegen Kants Unterscheidung zwischen analytischen und synthetischen Urteilen, wie sie in "Zwei Dogmen des Empirismus" dargelegt werden. Die genaue Natur dieser Kritik wird detailliert im entsprechenden Kapitel der Arbeit dargestellt.
Welche Rolle spielt der Satz vom Widerspruch?
Der Satz vom Widerspruch spielt eine zentrale Rolle bei Kants Definition analytischer Urteile. Die Unmöglichkeit, gleichzeitig ein Urteil und seine Negation für wahr zu halten, dient als Kriterium für die Wahrheit analytischer Urteile.
Was bedeuten A priori und A posteriori?
„A priori“ bezeichnet Wissen, das unabhängig von Erfahrung gewonnen wird, während „a posteriori“ Wissen beschreibt, das auf Erfahrung basiert.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Analytische Urteile, Synthetische Urteile, Kant, Quine, Zwei Dogmen des Empirismus, Satz vom Widerspruch, A priori, A posteriori, Erfahrung, Begriffsanalyse, Metaphysik, Formallogik.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2018, Die Kritik von Willard Van Orman Quine auf die Kantische Urteilskonzeption, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1247763