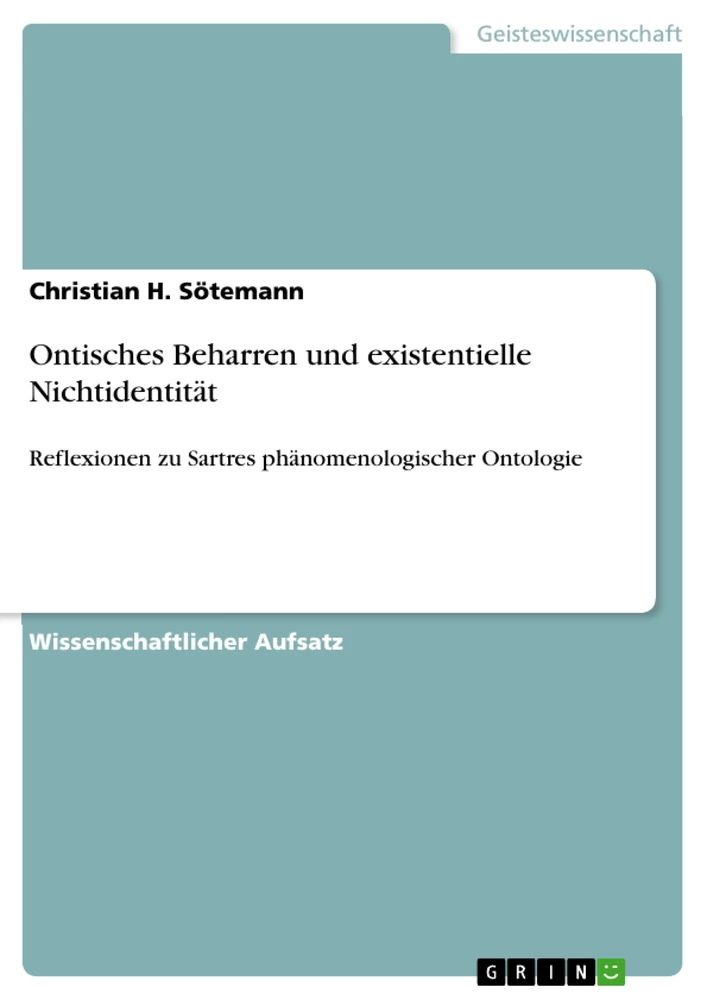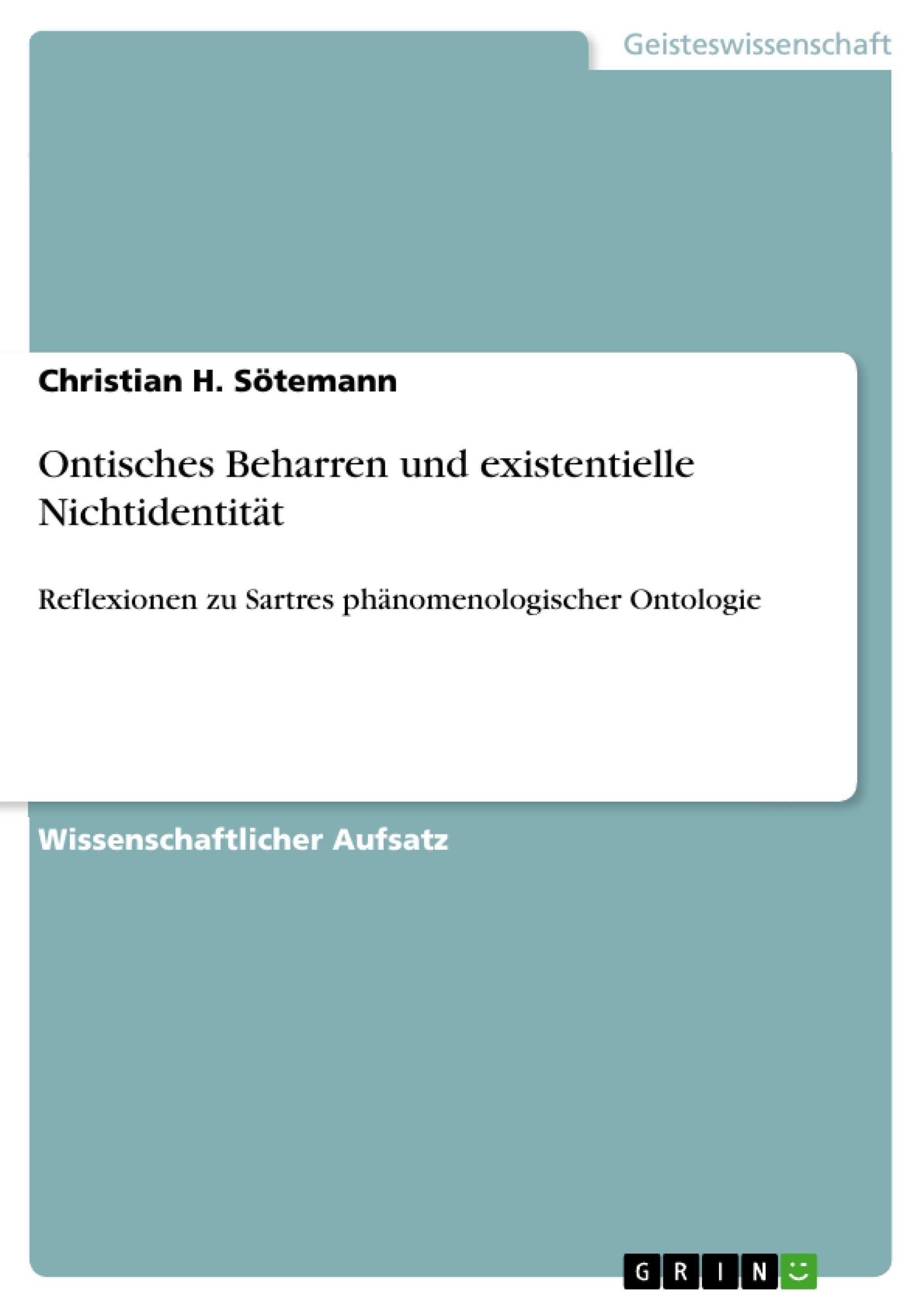Der Text leitet von der Selbstverständlichkeit der Alltagswelt und ihrer Hinterfragung ausgehend über zu Jean-Paul Sartres v. a. in „Das Sein und das Nichts” ausgearbeiteten phänomenologischen Ontologie. Diese wird in ihren Grundzügen erörtert, wobei unterschieden wird zwischen einer ontologischen Ebene, die in diesem Fall die Seinskategorien des An-sich-seins und des Für-sich-seins beschreibt, und weiterhin einer ontischen Ebene, die sich auf das bloße Vorhandensein, auf die Faktizität des wie auch immer gearteten Seins beschränkt. Es wird anhand der Untersuchung von Phänomenen wie Zerstörung und Nichtidentität illustriert, wie bei aller Differenz der beiden ontologischen Kategorien Sartres auf der ontischen Ebene sowohl An-sich als auch Für-sich gleichermaßen vorhanden sind, etwas sind. Insbesondere wird gezeigt, daß der Terminus des „Nichts” bei Sartre sich nicht auf ein absolutes, meontisches, sondern ein weltbezogenes, im Sein befindliches ontologisches „Nichts” bezieht. Anschließend wird die „Ontik” in ihren Hauptpunkten skizziert, die die Allgegenwart und Unvergänglichkeit des schlichten Vorhandenseins in jedweder Variation des „Welt”-Verständnisses ausdrücken, bei allen Vagheiten, Widersprüchlichkeiten und Unklarheiten. Zudem wird versucht, einige psychologische Implikationen der Ontik anzudeuten, mit Verweisen auf einen tiefenpsychologischen oder existentiell-psychotherapeutischen Kontext, sowie Überlegungen zur psychologischen Bedeutung (ontischer) philosophischer Gewißheiten.
Inhaltsverzeichnis
- Von der Selbstverständlichkeit der Alltagswelt zur phänomenologischen Ontik und Ontologie
- Grundzüge von Sartres phänomenologischer Ontologie
- Die Monotonie des Vorhandenseins - Skizze der Ontik
- Psychologische Implikationen der ontischen Betrachtungsweise
- Schluß – Der Widerspruch ist das Sein des Widerspruchs
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Sartres phänomenologische Ontologie, insbesondere die ontische Ebene und die menschliche Existenz im Spannungsfeld von Beharren und Vergänglichkeit. Sie analysiert Sartres Verständnis des Bewusstseins und seine Unterscheidung zwischen An-sich-Sein und Für-sich-Sein.
- Sartres phänomenologische Ontologie und der Bewusstseinsbegriff
- Die Unterscheidung zwischen An-sich-Sein und Für-sich-Sein
- Die ontische Ebene und das Vorhandensein
- Beharren und Vergänglichkeit in Sartres Philosophie
- Psychologische Implikationen der ontischen Betrachtungsweise
Zusammenfassung der Kapitel
1. Von der Selbstverständlichkeit der Alltagswelt zur phänomenologischen Ontik und Ontologie: Der Text beginnt mit der „naiven Realismus“ des Alltags, der die Existenz der Welt als selbstverständlich annimmt. Er stellt die philosophische Tradition des Hinterfragens dieser Selbstverständlichkeit dar, beginnend mit den Vorsokratikern und ihren Fragen nach dem „Urstoff“ der Welt. Der Text warnt vor der Gefahr der Verewigung und Generalisierung von Eigenschaften, die oft politische Hintergründe haben. Gleichzeitig betont er, dass die Annahme von etwas Beharrendem nicht automatisch reaktionär ist, da permanenter Wandel auch etwas Beharrendes impliziert. Die Arbeit führt in die existenzialistisch-phänomenologische Perspektive ein, die die konkrete, individuelle Existenz des Menschen in den Mittelpunkt rückt und die Fragen nach dem Gegebensein der Welt stellt, wie sie Jean-Paul Sartre in seinem Werk "Das Sein und das Nichts" behandelt. Der Text führt den Begriff der "ontischen Ebene" ein, die sich auf das Vorhandensein von etwas bezieht, unabhängig von qualitativen Eigenschaften.
2. Grundzüge von Sartres phänomenologischer Ontologie: Dieses Kapitel beschreibt Sartres Verständnis des Bewusstseins, das sich deutlich von der traditionellen Auffassung unterscheidet. Sartre verneint die Vorstellung des Bewusstseins als "psychischer Behälter". Stattdessen betont er die Intentionalität des Bewusstseins als auf die Welt gerichtete Struktur. Diese Intentionalität impliziert zwei Seinsbereiche: das Bewusstsein selbst (Für-sich-Sein) und das Sein, auf das sich das Bewusstsein richtet (An-sich-Sein). Sartre weist damit sowohl solipsistische als auch idealistische Positionen zurück und vermeidet zugleich naiven Realismus. Er postuliert die Existenz eines transphänomenalen Seins, das das Erscheinen der Objekte ermöglicht. Das Kapitel legt die Grundlagen für die Unterscheidung zwischen An-sich-Sein und Für-sich-Sein und deren ontische Fundierung.
Schlüsselwörter
Phänomenologische Ontologie, Jean-Paul Sartre, An-sich-Sein, Für-sich-Sein, Ontik, Existenz, Bewusstsein, Intentionalität, Beharren, Vergänglichkeit, Existentialismus.
Häufig gestellte Fragen zu Sartres phänomenologischer Ontologie
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Jean-Paul Sartres phänomenologische Ontologie, insbesondere die ontische Ebene und die menschliche Existenz im Spannungsfeld von Beharren und Vergänglichkeit. Ein Schwerpunkt liegt auf Sartres Verständnis des Bewusstseins und seiner Unterscheidung zwischen An-sich-Sein und Für-sich-Sein.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Sartres phänomenologische Ontologie, den Bewusstseinsbegriff, die Unterscheidung zwischen An-sich-Sein und Für-sich-Sein, die ontische Ebene und das Vorhandensein, Beharren und Vergänglichkeit in Sartres Philosophie sowie die psychologischen Implikationen der ontischen Betrachtungsweise. Sie untersucht den Übergang vom naiven Realismus des Alltags zur phänomenologischen Perspektive.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel, die von der Selbstverständlichkeit der Alltagswelt zur phänomenologischen Ontik und Ontologie überleiten, die Grundzüge von Sartres phänomenologischer Ontologie erläutern, die Monotonie des Vorhandenseins skizzieren, die psychologischen Implikationen der ontischen Betrachtungsweise beleuchten und schließlich mit einem Fazit zum Widerspruch als Sein des Widerspruchs abschließen.
Was ist die Kernaussage des ersten Kapitels?
Das erste Kapitel beginnt mit der Kritik am naiven Realismus und führt in die existenzialistisch-phänomenologische Perspektive ein. Es untersucht die philosophische Tradition der Hinterfragung der Selbstverständlichkeit der Welt und den Begriff der "ontischen Ebene", die sich auf das Vorhandensein von etwas bezieht, unabhängig von qualitativen Eigenschaften.
Was ist im zweiten Kapitel beschrieben?
Das zweite Kapitel beschreibt Sartres Verständnis des Bewusstseins als intentional und auf die Welt gerichtet. Es erklärt die Unterscheidung zwischen An-sich-Sein und Für-sich-Sein und deren ontische Fundierung, wobei sowohl solipsistische als auch idealistische Positionen zurückgewiesen werden.
Welche Schlüsselbegriffe werden verwendet?
Schlüsselbegriffe sind: Phänomenologische Ontologie, Jean-Paul Sartre, An-sich-Sein, Für-sich-Sein, Ontik, Existenz, Bewusstsein, Intentionalität, Beharren, Vergänglichkeit und Existentialismus.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für Leser gedacht, die sich für Sartres Philosophie, phänomenologische Ontologie und existenzialistische Themen interessieren. Sie eignet sich insbesondere für akademische Zwecke und die Analyse philosophischer Themen.
- Citar trabajo
- Dr. Christian H. Sötemann (Autor), 2009, Ontisches Beharren und existentielle Nichtidentität, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/124765