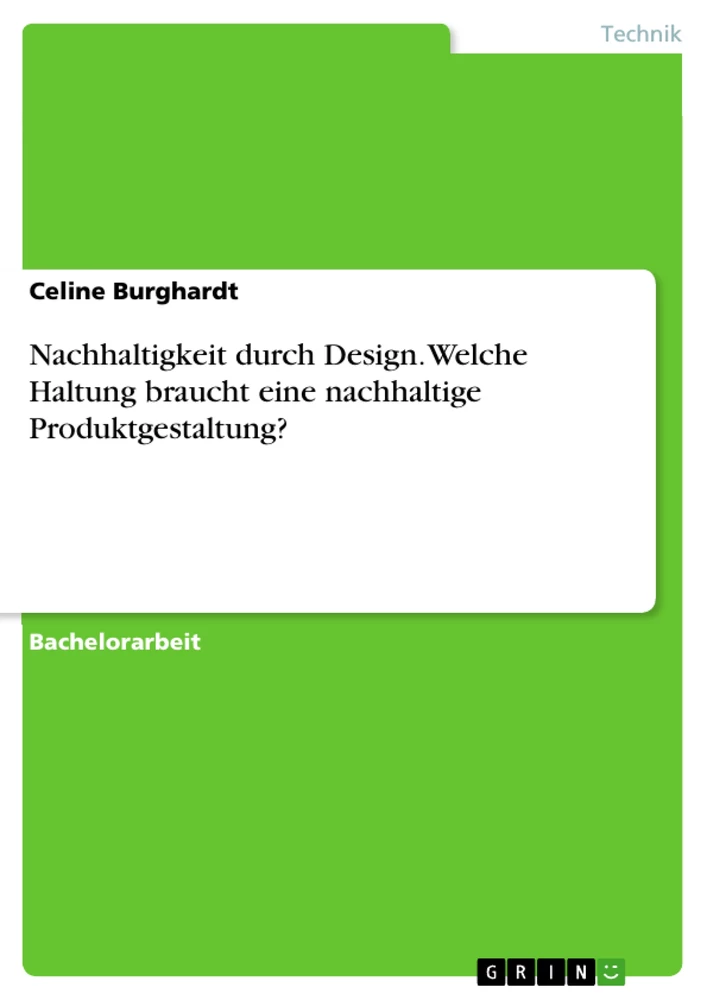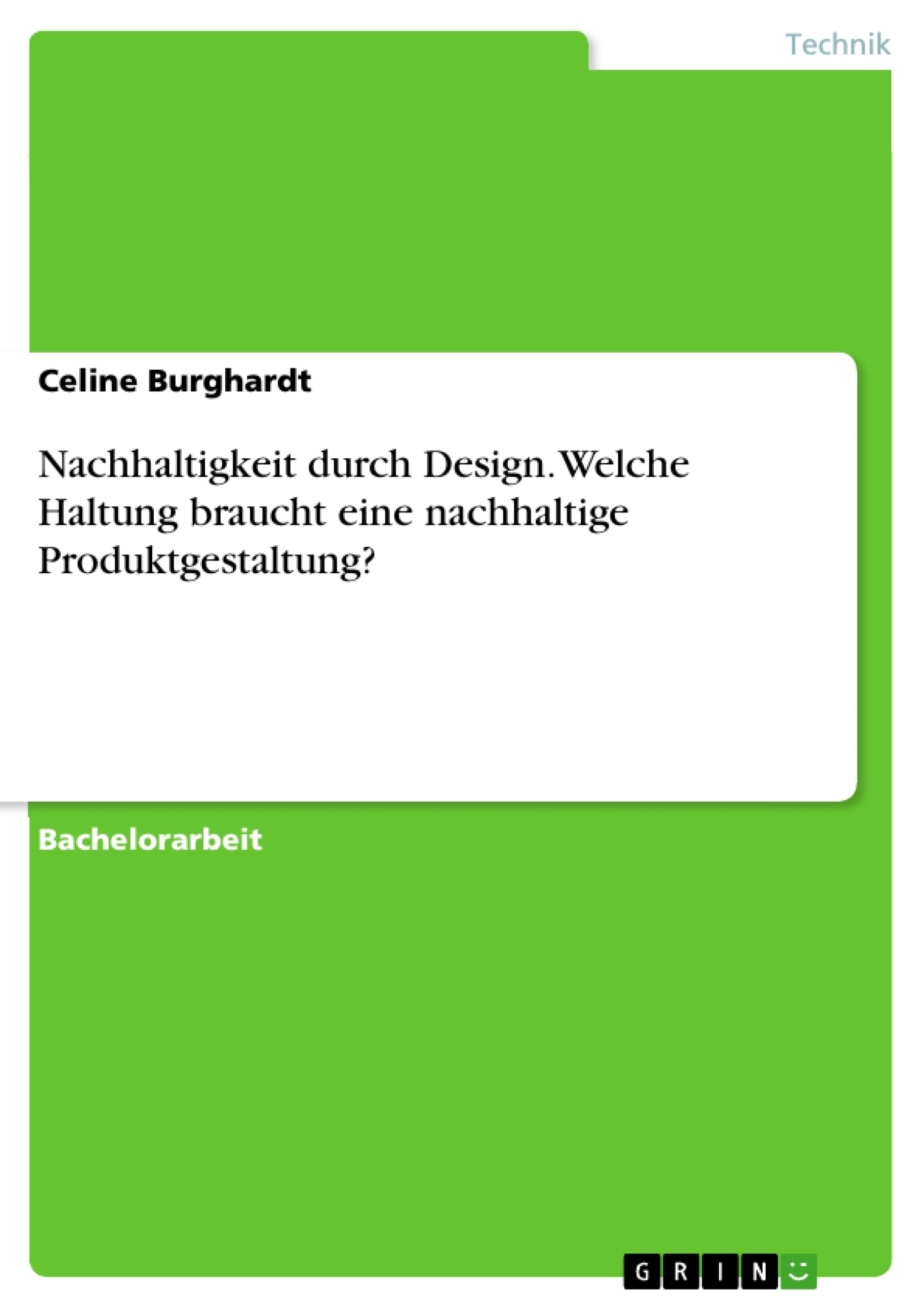Globale Krisen zwingen die Menschheit zum Handeln. Dass ein Wandel notwendig ist, steht fest. Wie ein Wandel Richtung Nachhaltigkeit jedoch aussehen muss, ist sowohl in der Gesellschaft auch als der Wirtschaftspolitik umstritten. Die Realität ist, dass Umweltverschmutzung, Ressourcenverschwendung, Krankheiten und Klimawandel auf den Konsum und dem damit verbunden Wirtschaftswachstum zurückzuführen sind. Das Design kann hier eine entscheidende Rolle spielen, denn Design hat einen maßgeblichen Einfluss auf seine soziale und ökologische Umwelt.
Zuerst ist es essentiell, den Begriff »Nachhaltigkeit« zu konkretisieren, um mit diesem arbeiten zu können. Hier wird eine recht umfangreiche historische Einordnung des Begriffes vorgenommen. Anschließend werden die Paradigmen
und Kernelemente der Nachhaltigkeit herausgearbeitet. Dadurch werden Entwicklungen, Handlungsbedarf, Relevanz und Problematiken greifbar.
Im zweiten Schritt wird ein Verständnis für das globale Wirtschaftswachstum entwickelt. Das Wachstum als Paradigma der Weltwirtschaft ist ein Element, das bei einer nachhaltigen Entwicklung zwingend zu betrachten ist. Nachhaltigkeit
und Wirtschaft stehen in einer direkten Verbindung zueinander stehen und bedingen sich im ganzen System.
Im nächsten Schritt wird ein Verständnis für den Begriff »Design« gewonnen. Auch hier wird der Begriff von seiner Entstehung bis heute beleuchtet, um seine Dynamik, Entwicklung und seine Beziehung zur Wirtschaft und zur Nachhaltigkeit fassbar zu machen.
Im folgenden Schritt wird die Rolle, die Verantwortung und der Einfluss des Designs in Form des »Nachhaltigen Design« dargelegt. Die Anforderungen, welche die zwei Designer Victor Papanek und Dieter Rams an ein verantwortungsvolles Design stellen, werden aufgezeigt. Der Begriff wird konkretisiert und seine Umsetzungsmöglichkeiten werden aufgeführt. Anhand der gewonnenen Erkenntnisse werden 12 Leitregeln für ein nachhaltiges
Design festgelegt.
Zum Schluss folgt ein Fazit, welches thematisiert, inwieweit ein »Nachhaltiges Design« eine nachhaltige Entwicklung ermöglichen kann. Die Handlungsfelder, die sich aus den Kapiteln herausgebildet haben, werden zusammengefasst und
es folgt ein Ausblick über zukünftige mögliche Entwicklungen.
Inhaltsverzeichnis
Kurzfassung
Abstract
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Vorwort
1 Überblick
1.1 Ziele und Vorgehen
1.2 Forschungsstand
2 Nachhaltigkeit
2.1 Historische Einordnung des Verständnisses von »Nachhaltigkeit«
2.1.1 Forstwirtschaft
2.1.2 Industrielle Revolution
2.1.3 Einzug in die Politik
2.2 Definition »Nachhaltigkeit«
2.2.1 Inter- und Intragenerationale Gerechtigkeit
2.2.2 Dimensionen nachhaltiger Entwicklung
2.2.3 Starke und schwache Nachhaltigkeit
2.2.4 Strategien zur Realisierung nachhaltiger Entwicklung
2.3 Fazit
3 Wirtschaftswachstum
3.1 Wachstum das Paradigma der Weltwirtschaft
3.2 Grünes Wachstum?
3.3 Wachstumsalternativen
3.4 Fazit
4 Design
4.1 Historische Einordung
4.2 Begriff »Design«
4.3 Verantwortung Design
4.4 Fazit
5 Nachhaltige Entwicklung durch Design
5.1 Anforderungen an Design nach Dieter Rams und Victor Papanek
5.1.1 Anforderungen an Design nach Dieter Rams
5.1.2 Anforderungen nach Victor Papanek
5.2 Nachhaltiges Design
5.3 Nachhaltiges Design realisiert durch Suffizienz, Konsistenz und Effizienz
5.3.1 Suffizienz
5.3.2 Konsistenz
5.3.3 Effizienz
5.4 Tools
6 Leitregeln
7 Fazit
7.1 Ausblick
Nachwort
Literaturverzeichnis
Kurzfassung
Globale Krisen zwingen die Menschheit zum Handeln. Dass ein Wandel notwendig ist, steht fest. Wie ein Wandel, Richtung Nachhaltigkeit, jedoch aussehen muss ist sowohl in der Gesellschaft auch als der Wirtschaftspolitik umstritten. Die Realität ist, dass Umweltverschmutzung, Ressourcenverschwendung, Krankheiten und Klimawandel auf den Konsum und dem damit verbunden Wirtschaftswachstum zurückzuführen sind. Das Design kann hier eine entscheidende Rolle spielen, denn Design hat einen maßgeblichen Einfluss auf seine soziale und ökologische Umwelt. Um die Zusammenhänge zwischen Nachhaltigkeit, Wirtschaft und Design zu erkennen, wird eine umfassende Literaturrecherche zu diesen Thematiken durchgeführt. Anschließend werden Leitregeln erstellt, die ein nachhaltiges Design realisieren sollen. Die Ergebnisse der Ausarbeitung zeigen, dass es eine Reformation des Wirtschaftssystems braucht. Es bestätigt sich aber auch, dass die Gestaltung der Produkte von großer Bedeutung ist, wenn es darum geht, einen Wandel zu vollziehen. Aktuell beeinflusst die Wirtschaft das Design, lässt sich das Design von den Prinzipien der Nachhaltigkeit leiten kann eine Wende eingeleitet werden.
Schlagwörter: Nachhaltigkeit, Wirtschaftssystem, Wachstum, Krisen, Klimawandel, Design, Produktgestaltung, Nachhaltiges Design, Transformationsdesign, Wandel, Veränderung
Abstract
Global crises are forcing humanity to act. It is clear that change is necessary. However, what form change towards sustainability should take is a matter of debate in both society and economic policy. The reality is that pollution, waste of resources, diseases and climate change are due to consumption and the associated economic growth. Design can play a critical role here because design has a significant impact on its social and environmental surroundings. To identify the connections between sustainability, economics, and design, a comprehensive literature review on these topics is conducted. Then, guiding rules are created to realize sustainable design. The results of the elaboration show that a reformation of the economic system is needed. However, it also confirms that the design of products is of great importance when it comes to making a change. Currently, the economy influences the design, if the design is guided by the principles of sustainability, a change can be initiated.
Keywords: sustainability, economic system, growth, crises, climate change, design, product design, sustainable design, transformation design, change
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Die 17 Entwicklungsziele der Agenda 2030 (Welthungerhilfe, 2020)
Abbildung 2: Ziele der unterschiedlichen Nachhaltigkeitsdimensionen (Kopfmüller et al., 2001, S. 172)
Abbildung 3: Modelle der Nachhaltigkeitsdimensionen (Pufe, 2016)
Abbildung 4: Wachstumssprirale Binswanger (H. C. Binswanger, 2009a)
Abbildung 5: Dieter Rams Regalsystem 606 (Archtitonic, o. D.), Dieter Rams Radio-Phono-Kombination TP1 (Vitsoe, 2021) und Dieter Rams Sesselprogramm 620 (Vitsoe, 2021a)
Abbildung 6: Living Cubes - Relaxation und Work (Papanek, 1971)
Abbildung 7: Funktionskomplex Design von Papanek (Papanek, 2019b; S.21)
Abbildung 8: Designbegriffe Abstufung (B. Dusch, 2016; S.16)
Abbildung 9: Übergang der Utopie in die Realität (Stork Reschke, 2017; S.41)
Abbildung 10: Toolkarten »Design with Intent« (Lockton et al., 2010)
Abbildung 11: Cradle to Cradle Kreisläufe (Griefahn & Janßen, 2020)
Abbildung 12: Tools Nachhaltiges Design (Tischner& Moser, 2015a; S.56)
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Vorwort
Dieser Arbeitstitel ergibt sich durch die Dringlichkeit, der Dringlichkeit zu hinterfragen, zu handeln und nach Lösungswegen zu suchen. Die aktuelle Lage, in der sich der Mensch und die Umwelt befindet, lässt sich bedauerlicherweise nicht, auch nicht in meiner unmittelbaren Umgebung leugnen. Mir ist es daher ein Anliegen meine Zeit und mein Wissen in eine Thematik zu investieren, welche mir sinnvoll erscheint und möglicherweise einen Beitrag leisten kann. Ein besonderer Dank gilt meinen Freunden und meiner Familie für das offene Ohr und die Akzeptanz meiner Unerreichbarkeit. Sowie meiner Professorin Frau Tabel welche hier als eine inspirierende Unterstützung fungierte.
Die vorgelegte Arbeit folgt den APA Zitierrichtlinien. Um eine angenehme Lesbarkeit zu ermöglichen, werden die indirekten Zitate als Referenz in der Fußnote aufgeführt. Direkte Zitate werden direkt hinter dem Zitat in Klammern belegt. Zudem umfasst diese Thesis rund 66 Seiten Textinhalt. Beides wurde einvernehmlich mit der Erstprüferin Prof. Bettina Tabel abgesprochen.
1 Überblick
Starten wir mit einem Gedanken-Experiment. Betrachten wir unsere unmittelbare Umwelt. Gehen wir gedanklich durch die Straßen in unserer Stadt, durch unser Zuhause und an unseren Arbeitsplatz. Legen wir nun den Fokus auf die Produkte und Objekte, die wir dort sehen. Die Produkte in den Geschäften und Läden, in unserer Wohnung oder unserem Haus und an unserem Arbeitsplatz. Stellen wir uns nun die folgenden Fragen, während wir explizit die Dinge betrachten, die in unserem Besitz sind.
- Wie viele Produkte besitzen wir ungefähr?
- Wie viele dieser Produkte nutzen wir regelmäßig?
- Besitzen wir Produkte, die wir nie wirklich benutzen?
Wir werden feststellen, dass wir eine Fülle an Gegenständen und Dingen besitzen. Dieser Besitz ist in den letzten 50 Jahren exponentiell angestiegen. Während ein durchschnittlicher Haushalt in Deutschland vor 110 Jahren mit rund 180 Gegenständen auskam, sind es laut dem Statistischen Bundesamt mittlerweile etwa 10.000, die der Durchschnitt der Deutschen in seinem Besitz hat.Abgesehen davon werden wir feststellen, dass wir unter dieser Summe an Produkten, auch viele Gegenstände finden werden, die wir kaum, und sicherlich auch welche, die wir nie benutzen. So gaben 40,2 % der Deutschen in einer Umfrage an innerhalb eines Jahres Dinge gekauft zu haben, die kaum bis nie in Nutzung waren. Ganz oben auf der Liste stehen hier vor allem Kleidung, Accessoires, Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik, Sportausstattung und Inneneinrichtung.12
Machen wir uns erneut Gedanken über unseren materiellen Besitz an Produkten. Werfen wir nun sowohl einen Blick in die Vergangenheit als auch in die Zukunft. Und stellen uns nun die folgenden Fragen:
- Wie lange benutzen wir die unterschiedlichen Produkte?
- Haben wir Produkte, die bis an das Ende unseres Lebens halten?
Was hier klar werden wird, ist, dass, die wenigsten Produkte mehr als ein Jahrzehnt halten und dass es nur sehr wenige Gegenstände gibt, die über unser Leben dauern. Besonders technische Produkte haben eine kurze Lebensdauer. Einer Umfrage des Bildungsministeriums zufolge hat ein Mobiltelefon bei deutschen Verbraucherinnen nach durchschnittlich 1,5 bis 2 Jahren ausgedient3, Laptops und Computer nach 3 Jahren.4 Auch Kleidung, Möbel und Küchengeräte besitzen einen immer kürzeren Lebenszyklus. Hat beispielsweise ein Schrank damals ein Leben lang seinen Zweck erfüllt, behauptet sich ein Ikea Möbelstück heute nur noch einige Jahre. Diese verkürzte Lebensdauer wird durch eine technische, werkstoffliche, psychologische und ökonomische Obsoleszenz verursacht.5
Führen wir uns nun dieses Nutzungsverhalten unter dem Aspekt vor Augen, dass unsere Ressourcen knapp sind und immer knapper werden, wird ein riesiger Missstand deutlich. Der »Earth Overshoot Day«, der angibt, an welchem Datum die Menschheit alle natürlichen Ressourcen verbraucht hat, welche die Erde innerhalb eines Jahres wiederherstellen kann, tritt seit 1961 immer früher ein. Im Jahr 2021 ist unsere Erde bereits am 29. Juli erschöpft.6 Bei fortlaufender Entwicklung wird der Mensch also in wenigen Jahren seine natürliche Lebensgrundlage zerstören und damit auch sein Überleben auf der Erde in Gefahr bringen.7 Während die Umwelt also immer ressourcenärmer wird, produzieren, konsumieren und besitzen wir immer mehr und vor allem über unsere Verhältnisse. Der vermeintliche Gewinn: Produkte und Dinge, die wir nicht lange in Gebrauch haben oder nicht einmal benötigen.
Eine weitere unglückliche Entwicklung kristallisiert sich zudem in den letzten Jahren heraus: Immer mehr Menschen werden krank und leiden unter Depressionen. Vor allem die Menschen in Ländern mit hohem Durchschnittseinkommen sind davon betroffen. Bis 2030 wird laut der WHO die Depression, die am meisten verbreitete Krankheit weltweit werden.8 Das zeigt deutlich, dass grenzenloser Konsum und Besitz nicht zwingend Glück bringen. Möglicherweise kann hier sogar eine Quelle der Unzufriedenheit liegen. Wird dem Menschen stets vermittelt Produkte zu benötigen oder zu wollen, geraten einerseits gesundheitliche, soziale und emotionale Bedürfnisse aus dem Fokus. Andererseits suggeriert dies, dass der Mensch sich nicht über sich selbst, sondern über seinen materiellen Besitz definiert.
Produkte können damit zu einem Ballast für uns und unsere Umwelt werden und stillen dafür lediglich einen kurzzeitigen, von Unternehmen erzeugten Kaufanreiz. Dieser Kaufanreiz bedient sich an einem entscheidenden Werkzeug - dem Design. Design gestaltet, formt, stylt, wertet auf, lädt emotional auf, setzt Trends und stimuliert damit den Konsum. Die Gestaltung ist der maßgebliche Faktor, wenn es um Kaufanreize geht und spielt daher eine entscheidende Rolle. Es stellt sich daher die Frage, welche Eigenschaften ein Design haben muss, welches nicht nur im Sinne der Konsumsteigerung gestaltet, sondern im Sinne des Bedürfnisses? Im Sinne der Nachhaltigkeit? Welche Haltung braucht eine nachhaltige Gestaltung?
1.1 Ziele und Vorgehen
»Der Anfang liegt in der Erkenntnis der Zusammenhänge. Immer mehr wird man sehen können, dass es keine „speziellen“ Fragen gibt, die isoliert erkannt oder gelöst werden können, da alles schließlich ineinandergreift und voneinander abhängig ist. Die Fortsetzung des Anfangs ist: weitere Zusammenhänge zu entdecken und sie für die wichtigste Aufgabe des Menschen auszunützen - für die Entwicklung.«9 (Kandinsky, Essays über Kunst und Künstler, 1973; S. 107)
Kandinsky stellte fest, dass der Anfang in der Erkenntnis der Zusammenhänge liegt und dass es essenziell ist, diese aufzudecken und zu verstehen, um eine Entwicklung zu ermöglichen. Dies ist auch das primäre Ziel der vorliegenden Arbeit. Weitere Ziele sind:
- ein Verständnis für das Fundament der Nachhaltigkeit zu bilden
- die Unabdingbarkeit einer Reform des Wirtschaftssystems zu begreifen
- ein Bewusstsein dafür zu erschaffen, dass es einen gesamtgesellschaftlichen Wandel benötigt
- den Einfluss des Designs auf die Gesellschaft aufzuzeigen
- herauszuarbeiten was ein »Nachhaltiges Design« ist, welche Rolle es spielen kann und welche Haltung es mitbringen muss.
Die Einheiten Nachhaltigkeit, Wirtschaft und Design werden im kompletten System beleuchtet, um so ein Verständnis dafür zu gewinnen, wie die einzelnen Bereiche aufeinander wirken und sich bedingen. Durch diese Erkenntnisse wird deutlich ob und wie eine Transformation in ein nachhaltiges Design möglich ist.
Es wird dabei folgendermaßen vorgegangen:
1. Zuerst ist es essenziell den Begriff »Nachhaltigkeit« zu konkretisieren, um mit diesem arbeiten zu können. Hier wird eine recht umfangreiche historische Einordnung des Begriffes vorgenommen. Anschließend werden die Paradigmen und Kernelemente der Nachhaltigkeit herausgearbeitet. Dadurch werden Entwicklungen, Handlungsbedarf, Relevanz und Problematiken greifbar.
2. Im zweiten Schritt wird ein Verständnis für das globale Wirtschaftswachstum entwickelt. Das Wachstum als Paradigma der Weltwirtschaft ist ein Element, das bei einer nachhaltigen Entwicklung zwingend zu betrachten ist. Nachhaltigkeit und Wirtschaft stehen in einer direkten Verbindung zueinanderstehen und bedingen sich im ganzen System.
3. Im nächsten Schritt wird ein Verständnis für den Begriff »Design« gewonnen. Auch hier wird der Begriff von seiner Entstehung bis heute beleuchtet, um seine Dynamik, Entwicklung und seine Beziehung zur Wirtschaft und zur Nachhaltigkeit fassbar zu machen.
4. Im folgenden Schritt wird die Rolle, die Verantwortung und der Einfluss des Designs in Form des »Nachhaltigen Design« dargelegt. Die Anforderungen, welche die zwei Designer Victor Papanek und Dieter Rams an ein verantwortungsvolles Design stellen, werden aufgezeigt. Der Begriff wird konkretisiert und seine Umsetzungsmöglichkeiten werden aufgeführt.
5. Anhand der gewonnenen Erkenntnisse werden 12 Leitregeln für ein nachhaltiges Design festgelegt.
6. Zum Schluss folgt ein Fazit, welches thematisiert, inwieweit ein »Nachhaltiges Design« eine nachhaltige Entwicklung ermöglichen kann. Die Handlungsfelder, die sich aus den Kapiteln herausgebildet haben, werden zusammengefasst und es folgt ein Ausblick über zukünftige mögliche Entwicklungen.
Es wird bewusst ein recht umfangreicher historischer Einblick der drei Begriffe geboten, da notwendig ist Ursprünge und Entwicklungen aufzuzeigen, um hieraus einen Handlungsbedarf zu entwickeln. Durch die Einordnung in die Vergangenheit zeigt sich, welche Entscheidungen im Laufe der Zeit getroffen wurden und welche Konsequenzen diese mit sich brachten. Aus diesen Erkenntnissen lässt sich eine Fülle an Wissen ziehen, welches die Weichen für künftige Entwicklungen bilden kann. Da die vorliegende Thesis verschiedene Themenkomplexe umfasst, findet sich an einigen Stellen ein vorläufiges Fazit, welches die Weiterarbeit erleichtert. Diese vorläufigen Resultate, werden in diesem Umfang nicht erneut im abschließenden Fazit aufgeführt. Es werden in der vorliegenden Arbeit einige mehrere systemische Gegebenheiten kritisch beleuchtet, zudem wird nicht im Sinne der Wirtschaftlichkeit gearbeitet.
1.2 Forschungsstand
Im Bereich der Nachhaltigkeit gibt es viele aktuelle Ansätze und Forschungen. Die Idee »Leitregeln für ein verantwortungsvolles Design« zu finden, zeigt sich jedoch nur einige wenige Male in der Designgeschichte. Hier sind der Designphilosoph Victor Papanek mit seiner Publikation »Design for the real world« (1971) und Dieter Rams mit seinen »Zehn Thesen für gutes Design« (1971) Vorreiter. Stefan Dietz, deutscher Industriedesigner veröffentliche zwar 2020 die »Circular Design Guidelines« für ein nachhaltiges Design, jedoch sind diese sehr ähnlich zu Rams Thesen. Weitere ähnliche Leitregeln aus aktuellerer Zeit für ein nachhaltiges Design sind kaum zu finden. Es lassen sich zwar viele Guides, Tools, Checklisten und Bilanzen finden, welche als Hilfestellung für ein nachhaltiges Design dienen sollen, allerdings sind diese oft komplex und betrachten lediglich ei- nige Aspekte des Nachhaltigkeitsparadigmas. Überwiegend findet sich Forschung im Bereich zu einem nachhaltigen Design in England. Unter dem Begriff »Sustainable Design« findet man hier wesentlich mehr Literatur. Vor allem die Idee »Social Design« und »Transformation Design« stehen hier im engen Kontext zum nachhaltigen Design. Die durchgeführte Recherche bestätigt das Ziel, Leitregeln für ein nachhaltiges Design zusammenzufassen.
2 Nachhaltigkeit
Um die Hypothese »Nachhaltigkeit durch Design« untersuchen zu können, ist es wichtig zunächst den Begriff der »Nachhaltigkeit« zu beleuchten. Daher wird im folgenden Kapitel eine ausführliche historische Einordnung des Verständnisses von »Nachhaltigkeit« vorgelegt. Im Rahmen dieser Einordnung wird untersucht, welche internationale Relevanz und aktuelle Notwendigkeit der Begriff erreicht hat und in welche wirtschaftspolitischen Ebenen er greift. Anschließend werden in einer Untersuchung der Bedeutungsvielfalt des Begriffes »Nachhaltigkeit«, oder besser »nachhaltige Entwicklung«, die grundlegenden Kernelemente aufgezeigt und grundlegende Prämissen zusammengefasst. Hinzuzufügen ist, dass »Nachhaltigkeit« zwar im allgemeinen Sprachgebrauch überwiegend verwendet wird, jedoch der Begriff »Nachhaltige Entwicklung« eigentlich den gemeinten Prozess gesellschaftlicher Veränderung beschreibt und »Nachhaltigkeit« nur einen Ist-Zustand, also das Ende eines Prozesses.9 In der vorliegenden Arbeit werden die Begriffe zugunsten der sprachlichen Abwechslung synonym für den Prozess gesellschaftlicher Veränderung stehen. Es wird sich in dem Kapital »Nachhaltigkeit« überwiegend aus Erkenntnissen der Literatur von Prof. Dr. Armin Grunwald, Prof. Dr. von Hauff, Dipl. -Volkswirt Jürgen Kopfmüller und Dr. Iris Pufe bedient.
2.1 Historische Einordnung des Verständnisses von »Nachhaltigkeit«
Seit Aufzeichnung der Menschheit finden sich in der Literatur immer wieder verschiedene Hinweise zu nachhaltigem Gedankengut. So steht beispielsweise in der Bibel geschrieben »Aber im siebten Jahr soll das Land dem Herrn einen feierlichen Sabbat halten; da sollst du dein Feld nicht besäen noch deinen Weinberg beschneiden« (Bibel, 600 v. Chr., Lev 25,4). Ein Verweis auf den pflegsamen bzw. »nachhaltigen« Umgang mit der Natur. Und auch in der Antike lassen sich Belege für nachhaltiges Gedankengut finden: »Nichts im Übermaß« »Alles in Maßen« (Orakel von Deli, 500 v. Chr., Apollon und die Weisen). Grober äußert sich zum Ursprung der Leitidee der Nachhaltigkeit wie folgt »Die Idee der Nachhaltigkeit ist weder eine Kopfgeburt moderner Technokraten noch ein Geistesblitz von Ökofreaks der Generation Woodstock. Sie ist unser ursprünglichstes Weltkulturerbe« (Grober, 2010, S.13). Es zeigt sich, dass nachhaltige Gedanken seit geraumer Zeit Wurzeln in verschiedenen Kulturen und Religion haben.10
2.1.1 Forstwirtschaft
In der Literatur tauchte der Begriff der »Nachhaltigkeit« erstmals Ende des 18. Jahrhunderts in der Wald- und Forstwirtschaft auf.11 Hans Carl von Carlowitz, Freiberger Oberberghauptmann, veröffentliche 1713 seine Publikation »Sylvicultura Oeconomica«. Hintergrund der Überlegungen, in seiner Abhandlung, war die Übernutzung der Wälder, welche durch landwirtschaftliche Aktivitäten und den zunehmenden industriellen Holzbedarf, für Bergbau und Verhüttung, hervorgerufen wurde. Folge der Übernutzung war eine Entwaldung rund um die Bergbaugebiete und ein damit steigender Holzpreis. Eine Holzverknappung drohte und erste Grundsteine zur Debatte die »Grenzen des Wachstums« wurden gelegt.12 Carlowitz bewertete die Lage wie folgt »Denn je mehr Jahr vergehen, in welchem nichts gepflanzet und gesaet wird, je langsamer hat man den Nutzen zugewarten, und um so viel tausend leidet man von Zeit zu Zeit Schaden, ja um so viel mehr geschickt weitere Verwüstung, daß endlich die annoch vorhandenen Gehöltze angegriffen, vollends consumiret und sich je mehr und mehr vermindern müssen.« (von Carlowitz, Sylvicultura Oeconomica, 1713, S.105) Er forderte daraus resultierend »eine kontinuierliche und beständig nachhaltende Nutzung« und stellte fest, dass ökonomisches Handeln mit den Anforderungen der Natur in Einklang zu bringen sei. Seine Überlegung war, dass pro Jahr nicht mehr Bäume gefällt werden, als auch Bäume nachwachsen, sodass ein kontinuierlicher Holzertrag, auch für die Nachwelt, gesichert ist.13 Es sollte also ein Gleichgewicht zwischen ökonomischen Zielen (Abholzung) und ökologischen Zielen (Aufforstung) herrschen, damit der dauerhafte Erhalt einer Ressource (hier: Holz) gewährleistet werden kann.
Carlowitz ging es in seinem Werk jedoch vielmehr um eine Geisteshaltung, welche den Respekt und dein Einklang des Menschen mit der Natur innehatte, als um eine wirtschaftliche Regel.14 So bezeichnete er sich selbst auch nicht als Wissenschaftler, sondern brachte stets philosophische Betrachtungen und Lebensweisheiten in sein Werk mit ein.15
Die damaligen Erkenntnisse sind Wegbereiter für zukünftige Nachhaltigkeitsüberlegungen, zudem wurden erste Grundsteine für Gedanken zum „Grenzen des Wachstums“ gelegt.16
2.1.2 Industrielle Revolution
Mit dem Aufkommen der industriellen Revolution gab es in der Literatur immer wieder kritische Stimmen über das Verhalten des Menschen zu seiner Umwelt.
William Wordswoth (1770-1850), britischer Dichter und Denker, erlebt den Beginn der industriellen Revolution und einem neuen ökonomischen Zeitgeist, er beobachtet die Veränderungen und Auswirkungen. »I have lived to mark/ A new and unforeseen creation rise/ From out the labours of a peaceful Land/ Wielding her potent enginery to frame/ And to produce, with appetite as keen/ As that of war, which rests not night or day, / Industrious to destroy! « (Wordsworth, Excursion, 1814, S. 87-94) Wordsworth charakterisiert die Wirtschaft seiner Zeit mit Gier, Geschwindigkeit, Dynamik und einer Zerstörungsmacht.17 18 Charles Dickens (1812-1870), englischer Schriftsteller,16 schrieb 1840 über die Naturzerstörung »Gartenland, wo Kohlenstaub und Fabrikrauch die kümmerlichen Blätter und derben Blumen schwärzten, wo die kämpfende Pflanzenwelt kränkelnd unter dem heißen Atem von Kalk- und Hochofen dahinsank.« (Klingender, Kunst und industrielle Revolution 1976, S. 114)
Die Industrialisierung brachte technische Innovationen in den Bereichen der Medizin und der Mobilität mit sich, jedoch wuchs auch mit fortschreitender Industrialisierung die Belastung der Umwelt an. Belastungen waren: Luftverschmutzung durch Kohleverbrennung, Waldsterben durch giftige Schwefeldioxide in der Luft, Wasserverseuchung durch verschiedene giftige Chemikalien und Bodenbelastung durch verschiedene Gifte wie Blei.19 Auch neuartige Infektionskrankheiten und Krankheitsbilder, unter anderem die Nervenkrankheit »Neurasthenie«, eine Art »Burnout« der industriellen Revolution, breitete sich aus.20 Außerdem entsandt eine Art Klassengesellschaft und die Schere zwischen Armut und Reichtum vergrößerte sich. Vor diesem Hintergrund wurde vermehrt »Industriekritik« geäußert, die sich aber erst später zu einer ökologischen Kritik transformierte und den Begriff der Nachhaltigkeit innehatte.21 Wachsende Aufmerksamkeit erregte die Diskussion, über die Auswirkungen auf die Umwelt durch die aktuelle Wirtschaftsweise, erst Ende der 1960er-Jahre. Es kamen vermehrt bekannte Ökonomen wie, John Galbraith (1908-2006), Edward Mishan (1917- 2014) und Kenneth Boulding (1910-1993) zu Wort, die aufmerksam auf die, durch Wachstum generierten, Umweltschäden machten.22 Galbraith prägte durch sein Buch »Gesellschaft im Überfluss« (1958) den Begriff der »Überflussgesellschaft«23, Mishan hat 1967 mit seinem Buch »The costs of economic growth« (1967)24 für eine bedeutende Kritik gesorgt und Boulding äußerte »Jeder, der glaubt, exponentielles Wachstum kann andauernd weitergehen in einer endlichen Welt, ist entweder ein Verrückter oder ein Ökonom.« (Boulding, Energy reorganization act, 1973, S. 248). Der Fortschrittsoptimismus schwand angesichts der negativen Begleiterscheinungen. Die Erkenntnis, dass der Mensch durch seinen Lebensstil und sein Wirtschaften die natürlichen Grundlagen der Erde zerstört, auf die er eigentlich in hohem Maße angewiesen ist, schockierte zu dieser Zeit viele.25
1968 gründeten Wissenschaftler, Politiker und Ökonomen aus 53 verschiedenen Ländern auf Anregung des italienischen Industriellen Aurelio Peccei (1908-1984) ein Netzwerk namens »Club of Rome«. Der »Club of Rome« hatte es zum Ziel die Probleme der Menschheit wie z.B. Umweltzerstörung, Bevölkerungswachstum und Rohstoffverbrauch für die Bevölkerung durschaubarer zu machen.26 1972 publizierten Dennis & Donella Maedows unter Auftrag der Vereinigung den Bericht »Die Grenzen des Wachstums«.27 28 Die Studie wurde in 30 verschiedene Sprachen übersetzt und wurde circa 30 Millionen Mal verkauft.26
Die Botschaft des Berichtes war, dass durch eine unverminderte Fortschreitung der damals aktuellen Trends, hinsichtlich der Zunahme der Weltbevölkerung, der Industrialisierung, der Umweltverschmutzung, der Nahrungsmittelproduktion und dem Ressourcenverbrauch, die Wachstumsgrenzen auf der Erde im Laufe der nächsten hundert Jahre erreicht werden und dies somit zu einem ökologischen und wirtschaftlichen Kollaps führt.29 Der Bericht erhielt große Aufmerksamkeit, war Katalysator für Umweltbewegungen und löste bis heute aktuelle Debatten über die Kausalität von exponentiellem Wirtschaftswachstum und endlichen Ressourcen aus.
2.1.3 Einzug in die Politik
Zunehmende Umweltprobleme wie Luft- und Gewässerverschmutzung trugen dazu bei, dass ökologische Aspekte nun auch in Politik und Medien thematisiert wurden.30 1972 fand in Stockholm die erste Konferenz der vereinten Nationen über »die Umwelt des Menschen« statt. Auf der Konferenz wurde das »United Nations Environment Programme« (UNEP) gegründet. UNEP ist bis heute die einzige Einrichtung der Vereinten Nationen, die sich ausschließlich mit der Thematik Umwelt befasst und hat somit die führende Rolle im weltweiten Umweltschutz.31 Viele andere Länder nahmen sich dieses Treffen zum Vorbild und richteten selbst eigenständige Umweltministerien ein. 1980 gründete die »International Union for the Conservation of Nature« (IUCN), auch Weltnaturschutzunion, zusammen mit unterschiedlichen UN-Organisationen, unter anderem zusammen mit UNEP, die »world conservation strategy«. Das Ergebnis dieser Strategie lautete: Eine dauerhafte ökonomische Entwicklung ist abhängig vom Erhalt der Ressourcen und der Funktionsfähigkeit der Ökosysteme. Der Begriff »sustainable Development« fiel erstmals in einem größeren Zusammenhang.32
In den Achtzigerjahren gerieten neue Komplexitäten in den Fokus. Unter anderem zählt hierzu die Rolle der Umwelt als Deponie für Abfälle und Emissionen. Das Niveau der Emissionen darf nicht höher als die Assimilationskapazität sein, da die Umwelt begrenzte Aufnahme-, Verarbeitungs- und Regenerationsfähigkeiten hat.33 Es wurde klar, dass die Produktion und Nutzung von Produkten die Natur in hohem Maße belastet. Außerdem rückte vor dem Hintergrund wachsender Nöte der Entwicklungsländer, der der soziale Aspekt der Umweltprobleme in den Vordergrund und es wurde zunehmend die Verknüpfung zwischen Entwicklungs- und Umweltaspekten diskutiert.34 Wichtig zu nennen ist hier der Daf-Hammarskjöld-Report »what now« von 1975. In diesem Projekt tauchten erstmals Gedanken zum »Ecodevelopment« auf. Die Leitlinien dieses Berichtes, welche wichtige Grundbausteine für spätere nachhaltige Entwicklungs- Leitlinien liefert, sind wie folgt35:
- Befriedigung der Grundbedürfnisse überwiegend mithilfe der eigenen Ressourcenbasis
- Kein Nachahmen des westlichen Lebens- und Konsumstils
- Erhalt einer intakten Umweltsituation
- Respekt vor anderen Kulturen & Traditionen
- Solidarität mit zukünftigen Generationen
- Techniken angepasst an die lokalen Gegebenheiten
- Lokale Partizipation vor allem durch die Stärkung der Rolle der Frau
- Erziehungsprogramme
- Familienplanung
- Teilweise Abkopplung vom globalen Markt und eine Entwicklung lokaler Märkte
- Orientierung auf Religion & Tradition
- Keine Mitgliedschaft bei den militärischen Machtblöcken der Nato und des Warschauer Paktes
Das Bewusstsein, dass die Industriestaaten für viele ökologische und sozioökonomische Probleme verantwortlich sind, und daher auch die größte Verantwortung für deren Lösung tragen, machte sich breit. Es wurde außerdem deutlich, dass es keine realisierbare Lösung sei, den von den Industriestaaten praktizierte Lebens- und Produktionsstil auf den Rest der Welt zu übertragen.36
2.1.3.1 Brutlandbericht
Das heutige Verständnis zur Nachhaltigen Entwicklung leitet sich überwiegend aus dem »Brundtland-Bericht«, welcher 1987 von der »World Commission on Environment and Development« (WCED) publiziert wurde, ab.37 1983 realisierte die »Brundtland- Kommission«, unter dem Vorsitz der norwegischen Ministerpräsidentin »Gro Hartem Brundtland«, aufgrund der wachsenden Herausforderungen in ökonomischen, ökologischen und sozialen Bereichen, ihre Arbeit. Zu den Herausforderungen dieser Zeit zählten beispielsweise: Ölkrisen, Trockenheit in Afrika, Vernichtung tropischer Wälder, die Verringerung der Ozonschicht, nationale Finanzkrisen und Verschuldungsprobleme.38 Das Ziel der Kommission war es, Handlungsempfehlungen zur Erreichung einer dauerhaften Entwicklung zu erarbeiten.39 Im Rahmen des Brundtland-Berichtes mit dem Titel »Our Common Future«, wurde der Begriff »Nachhaltige Entwicklung« als »Sustainable Development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs «(WCED, 1987,S. 43) definiert und wurde damit erstmals als globales Leitbild einer breiten Gesamtheit nagegebracht. Der Bericht stellt drei Grundprinzipien in den Mittelpunkt: die globale Perspektive, die Verknüpfung zwischen Umwelt- und Entwicklungsaspekten und die Realisierung von Gerechtigkeit, aus intergenerativer (zwischen verschiedenen Generationen) sowie intragenerativer (innerhalb einer Generation) Perspektive. Diese Ausgangsbasis findet bis heute breiten Zuspruch.40 Kritisiert wird der geringe Konkretisierungsgrad sowie der große Interpretations-Spielraum des Berichtes. Dennoch fand »Our Common Future« breite Zustimmung und initiierte den Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung.41
2.1.3.2 Rio Prozess
1992 wurde der wichtigste Meilenstein der politischen Integration von Umwelt- und Entwicklungsbestrebungen in Rio de Janeiro gelegt. Auf Vorschlag der Brundtland- Kommission fand der Erdgipfel, auch »United Nations Conference on Environment and Development« (UNCED) statt.42 Hier wurde die Brundtland-Definition für »nachhaltige Entwicklung« erstmals offiziell anerkannt. Vertreter aus 178 Ländern versammelten sich, um über Umweltfragen in einem globalen Rahmen zu beraten. Als Ergebnis der Rio- Konferenz kamen fünf Dokumente zustande, welche von den verschiedenen Ländern unterzeichnet wurden. Dazu zählen:
- die »Rio-Deklaration«, welche in 27 Grundsätzen erstmals global das Recht auf nachhaltige Entwicklung verankerte und das Gerechtigkeitsprinzip der intergenerativen und intragenerativen Perspektive als Leitbild anerkannte,
- die »Agenda 21« ein Aktionsprogramm für Ziele, Maßnahmen und Instrumente zur Umsetzung des Leitbilds, mit verschiedenen Schwerpunkten für verschiedene Industrie- und Entwicklungsländer,
- sowie die »Klimaschutz-Konvention« mit dem Ziel die Treibhausgasemissionen zu reduzieren,
- die »Biodiversitätskonvention« welche die biologische Vielfalt schützen soll,
- die »Walddeklaration« welche Leitsätze zur Bewirtung, Erhaltung und nachhaltiger Entwicklung der Wälder aufstellt
- und die »Konvention zur Bekämpfung der Wüstenbildung«.43
Der Erdgipfel beschwor eine kraftvolle Vision - die einer »Globalen Partnerschaft« zwischen Umwelt und Entwicklung, Ökologie und Ökonomie und auch zwischen Nord und Süd. Es wurden zusammengefasst Umrisse für eine Entwicklung entworfen, die nicht länger die Umwelt und damit die Lebensgrundlagen zerstört, sowie Hunger und Armut insbesondere in Entwicklungsländern zementiert.44 Die positive Aufbruchsstimmung »The Spirit of Rio« musste in den Folgekonferenzen, auf denen die Umsetzung der Konventionen überprüft und überarbeitet werden sollten, jedoch weichen. Die Konventionen stellten lediglich Rahmenbedingungen und keine konkreten, überprüfbaren Verpflichtungen dar, weswegen wenige Länder sich an Zielsetzungen hielten.45 Um die Einhaltung und die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele zu gewähren, wurden zahlreiche Folgekonferenzen festgelegt sowie eine Kommission für nachhaltige Entwicklung (CSD) gegründet. Die CSD hat die Aufgabe der Koordination und Konkretisierung auf globaler Ebene.46 Die erste Folgekonferenz »5 Jahre nach Rio« fand 1997 in New York statt, mit dem ernüchternden Ergebnis, dass der Zustand der Umwelt in einem schlechteren Zustand als je zuvor sei.47 Es hat sich gezeigt, dass die Änderung umweltschädlicher und unsozialer Produktions- und Konsumweisen nicht durch freiwillige Änderungen von Unternehmen und Verbrauchern erreicht werden kann. Rückschritte in den Trends ökologischer Probleme, Klimaveränderungen, großflächige Vegetationszerstörungen, Verlust biologischer Vielfalt und Verknappung sowie Verschmutzung des Wassers werden verzeichnet. Auch Fünf Jahre nach Rio kam die Welt dem Ziel eines öko-sozialen Wandels nicht näher48. Abschließend gab es die Zielsetzung für alle Länder bis 2002, zur Folgekonferenz »10 Jahre nach Rio«, eine nationale Nachhaltigkeitsstrategie zu entwickeln. 10 Jahre nach Rio musste diese Zielsetzung erneut eingefordert werden, da die Länder kaum etwas vorweisen konnten.49 Es hieß: Die Vision von Rio steckt in einer Krise, Fortschritte kommen zu langsam.50
2012 fand die Konferenz »20 Jahre nach Rio« erneut in Rio de Janeiro statt, der politische Wille für eine nachhaltige Entwicklung wurde erneuert und konkretisiert. Zentrales Thema war die grüne Ökonomie »green economy«.51 Das Bundesministerium für Bildung und Forschung definiert die grüne Ökonomie, als eine Ökonomie, die gesellschaftliche Wohlfahrt steigert, die Armut bekämpft und soziale Gerechtigkeit anstrebt. Jedoch ist das Konzept der »green economy« und damit das Konzept des »grünen Wachstums« unzureichend definiert, kritisiert und politisch hoch- umstritten.52 Generell ist die Bilanz der Sitzung auch 20 Jahre nach Rio enttäuschend, die Umsetzungsdefizite des Rio-Prozesses sind immens.53 Bundeskanzlerin Angela Merkel bilanzierte, dass die Rio-Ergebnisse hinter dem zurückgeblieben sind, was angesichts der Ausgangslage notwendig gewesen wäre.54
2.1.3.3 Agenda 2030
2015 fand die Folgekonferenz »Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung« in New York statt. Das Ergebnisprotokoll der Konferenz ist die »Agenda 2030 für eine nachhaltige Entwicklung«. Ausgangspunkte für die Agenda 2030 sind die Agenda 21 und der Milleniumsgipfel 2000, auf welchem die Millenniums-Entwicklungsziele (MDGs) festgelegt wurden. Die MDGs sind die zeitlich festgelegten und befähigten Ziele für die Beseitigung der enormen Armut in ihren unterschiedlichen Dimensionen.55 In der Agenda 2030 mit dem Titel »Transformation unserer Welt« sind 17 Entwicklungsziele, die SDGs, festgelegt, mit welcher die 193 Mitgliedsstaaten den globalen Rahmen für die Nachhaltigkeitspolitik der kommenden 15 Jahre umreißen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Die 17 Entwicklungsziele der Agenda 2030 (Welthungerhilfe, 2020)
Die SDGs sind zentraler Referenzpunkt in der Entwicklungspolitik geworden. Sie bieten ein universal gültiges Konzept für alle Regierungen, sowie die Zivilgesellschaft, die Wirtschaf und die Wissenschaft.56 Jedoch sind sie daher auch weniger konkret, erzeugen keinen Veränderungsdruck und passen sich nicht an aktuelle Neuausrichtungen im entwicklungspolitischen Zielsystem an.57 Vereinfacht und zusammengefasst dargestellt zeigen sich die 17 SDGs in der aufgeführten Grafik.
Zentrale Aspekte der Ziele sind das Voranbringen des Wirtschaftswachstums, die Reduktion von Unterschieden im Lebensstandard, die Schaffung von Chancengleichheit sowie ein nachhaltiges Management von natürlichen Ressourcen, das den Erhalt von Ökosystemen gewährleistet und deren Resistenz stärkt. Diese 17 Entwicklungsziele sind auf globaler und politischer Ebene die relevantesten und aktuellen Verankerungen zur nachhaltigen Entwicklung.
2.2 Definition »Nachhaltigkeit«
Zahlreich sind die Orte, die Akteure und die Zusammenhänge, an denen »Nachhaltigkeit« hohe Ansprüche und weitreichende Erwartungen schürt und vorgibt, das führende Leitbild zu sein. Zu zahlreich, dass hier von einem einheitlichen Verständnis gesprochen werden kann?
Wie sich in 2.1 herausstellt, wird seit einigen Jahrzehnten nach dem Verständnis von Nachhaltigkeit debattiert und bis dato ist keine eindeutig bestimmte statische Definition gefunden worden. Eine überwiegend anerkannte Formulierung ist jedoch, wie in 2.1 erwähnt, die der Brundtland-Kommission, die sagt, dass nachhaltige Entwicklung dann realisiert sei, wenn »die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt sind, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können.« (Von Hauff, 1987, S.46).58 Die »Brundtland-Definition« gibt eine Regel vor, die aussagt wie überlegt, reflektiert und abgewogen werden soll - und in welcher Maßgabe und Orientierung dies geschehen soll.59 Die Umschreibung der Bedeutung von Nachhaltigkeit ist jedoch auf einer sehr allgemeinen Ebene gehalten und hat keine präzise Bedeutung. Sie gibt weder Inhalte, Strategien noch Richtlinien vor und ist damit konsensfähig60 - ein möglicher Grund, wieso sie sich an allgemeiner Anerkennung erfreut.61 Nachhaltigkeit versteht sich als ein gesellschaftlich-politisches sowie ein ethisch-moralisches und damit normatives Leitbild.62 Umso problematischer die fehlende Präzisierung und die bestehende Bedeutungsvielfalt, denn diese steht ihrer Umsetzung im Wege, kann politisch missbraucht werden und schadet der öffentlichen Kommunikation und Durchsetzung.63 Für eine weitere Auseinandersetzung sowie eine spätere Anwendung ist es daher wichtig den Begriff der »Nachhaltigen Entwicklung« zu präzisieren und die wichtigsten Grundgedanken herauszufiltern.
Im Folgenden werden daher die wichtigsten Kernelemente aufgezeigt, welche im Nachhaltigkeitsdiskurs stets auftreten und die maßgeblich bedeutend für die nachhaltige Entwicklung sind.
2.2.1 Inter- und Intragenerationale Gerechtigkeit
Die Prämisse, die sich auch aus der Brundtland Definition ableiten lässt, ist die der Gerechtigkeit. Sie nimmt einen hohen Stellenwert ein und bezieht sich auf zwei Prinzipien der Verteilungsgerechtigkeit, die der intragenerationalen (zwischen allen heute Lebenden - global sowie lokal) und der intergenerationalen (zwischen den heute Lebenden und den zukünftig Lebenden) Gerechtigkeit, welche eng miteinander verbunden sind.64 Gerechtigkeit ist ein weitgreifender ethischer Begriff, der viele Fragen aufwirft, was eine Präzisierung erneut erschwert. Jedoch eindeutig ist: Der Mensch trägt Verantwortung, sowohl für seine heute lebenden Mitmenschen als auch für die Menschen, die nach ihm leben (Zukunftsverantwortung). Gerechtigkeit wird hauptsächlich daran gemessen, nach welchen Kriterien Ressourcen, Wohlstand, Rechte, Pflichten, soziale und ökonomische Ressourcen sowie Einfluss- und Wahlmöglichkeiten verteilt werden. Gerechtigkeitsfragen zwischen Parteien wie Industrie- und Entwicklungsländern, den Geschlechtern und zwischen den verschiedenen Generationen sind zu betrachten. »Ungerechte« Verteilung führt zu globalen Problemlagen und Konflikten. Es zeigt sich, um Gerechtigkeit zu gewährleisten, muss »der Blick aufs große Ganze« gerichtet werden, es darf nicht nur innerhalb eines lokalen, zeitlich begrenzten Systems gedacht werden.65 Die Verantwortung sowie die Gerechtigkeit sind die ethischen Grundlagen nachhaltiger Entwicklung, aus welchen weitreichende Gestaltungserfordernisse resultieren.66
2.2.2 Dimensionen nachhaltiger Entwicklung
Wie in 2.2.1 aufgezeigt ist es unerlässlich beim Begriff »nachhaltiger Entwicklung« das komplette System »Erde« zu betrachten. Da die Zusammenhänge der einzelnen Komponenten im System der Welt äußerst komplex und vielfältig sind, wurde ein Konzept entwickelt, welches die Betrachtung des Systems in Dreidimensionalität erlaubt.67 Dieses Konzept findet heute breiten Zuspruch und hat sich weltweit durchgesetzt.68
Nachhaltigkeit ist demnach als ein integratives Konzept zu betrachten. Das Ziel dieses Konzeptes ist es, das interdisziplinäre und integrative Wahrnehmen sowie Denken von Ganzheitlichkeit und Wechselwirkungen zu fördern.69 Das System besteht in dieser Überlegung aus den Dimensionen der Ökologie, der Ökonomie und dem Sozialen.70 Die Leitgedanken der einzelnen Dimensionen in Bezug auf Nachhaltigkeit sind wie folgt:
- Die ökonomische Dimension beschreibt den Verstand, dass eine Gesellschaft nicht über ihre Verhältnisse leben und wirtschaften soll. Eine nachhaltige Wirtschaftsweise ist eine Art zu wirtschaften, die dauerhaft ohne Verzicht für nachfolgende Generationen möglich ist.
- Die ökologische Dimension hat inne, dass die natürlichen Grundlagen der Erde nur in dem Maße beansprucht werden, in dem sie sich auch regenerieren können. Dies beinhaltet auch den Verzicht auf Raubbau und den Wandel hin zu regenerierbaren Ressourcen.
- Der Kern der sozialen Dimension ist die Gerechtigkeit. Die Gesellschaft sollte für alle gerecht aufgebaut sein, das schließt Chancengleichheit und Partizipation mit ein.71
Die wichtigsten Ziele und Regeln der einzelnen Dimensionen sind in folgender Tabelle von Grundwald und Kopfmüller kurz und gut übersichtlich zusammengefasst.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Ziele der unterschiedlichen Nachhaltigkeitsdimensionen (Kopfmüller et al., 2001, S.172)
Als wichtigste Ziele der einzelnen Dimensionen werden hier die Sicherung der menschlichen Existenz, die Erhaltung des gesellschaftlichen Produktivpotenzial und die Bewahrung der Entwicklungs- und Handlungsmöglichkeiten aufgeführt. Es haben sich verschiedenen Modelle herausgebildet, die den Zusammenhang dieser Dimensionen untereinander darstellen sollen. Die Bekanntesten sind das Drei-Säulen-Modell, das Dreiklangmodell, das Nachhaltigkeitsdreieck und das eingebettete Modell der Nachhaltigkeit (Vorrangmodell).72 Die ersten drei genannten Modelle zielen auf die Gleichrangigkeit der Nachhaltigkeitsdimensionen ab, das eingebettete Modell der Nachhaltigkeit oder auch »Vorrangmodell« nimmt jedoch eine eindeutige Gewichtung der Ökologie als wichtigste Dimension vor. Wie sich zeigt, existieren verschiedene Vorstellungen über die Gewichtung der Dimensionen.73 Diese Gewichtungen bzw. Bewertungen werden in folgendem Kapitel in »starke und schwache Nachhaltigkeit« unterschieden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Modelle der Nachhaltigkeitsdimensionen (Pufe, 2016)
2.2.3 Starke und schwache Nachhaltigkeit
Im Diskurs der starken und schwachen Nachhaltigkeit wird oft von »Kapitalarten« gesprochen. Das Gesamtkapital besteht hier aus dem Naturkapital, dem Sachkapital und dem Human- und Sozial kapital.74
In der schwachen Nachhaltigkeit wird davon ausgegangen, dass die Kapitalarten substituiert werden können.75 Dieser Ansatz beschreibt die Vorstellung, dass Naturkapital durch Sachkapital ersetzt werden kann. Eine nachhaltige Entwicklung ist realisiert, wenn das Gesamtkapital gleichbleibt oder wächst. In diesem System kann ein Rückgang an Naturkapital also auch noch als »nachhaltig« gelten, solange dieser Rückgang durch steigendes Kapital in anderen Bereichen ersetzt wird. Die schwache Nachhaltigkeit gewichtet die Dimensionen folglich als gleichwertig, dieses Gleichgewicht der Dimensionen wird im Drei-Säulen-Modell, im Dreiklang-Modell und im Nachhaltigkeitsdreieck veranschaulicht. Generell stehen bei der schwachen Nachhaltigkeit die Steigerung und Aufrechterhaltung des Gesamtwohlstandes im Fokus. Diese Vorstellung hat den Menschen im Mittelpunkt seiner Betrachtungen. Nach seinem Empfinden und Wohlergehen wird gemessen, so werden auch Umwelt und andere Lebewesen nach dem Nutzen des Menschen bewertet. Diese Betrachtungsweise wird als »Anthropozentrismus« bezeichnet. Wirtschaftliches Wachstum auf Kosten der Natur wird nicht verhindert.76 Die schwache Nachhaltigkeit beruht auf den Prämissen der neoklassischen Ökonomie. In der neoklassischen Ökonomie wird davon ausgegangen, dass Wachstum und nachhaltige Entwicklung miteinander vereinbar sind. Neoklassische Umweltökonom:innen werden daher auch als »Wachstumsoptimisten« bezeichnet.77
In der starken Nachhaltigkeit wird die Idee der Substituierbarkeit abgelehnt. Die Dimension der Ökologie steht hier klar über den anderen beiden Dimensionen, es wird also eine Komplementarität statt einer Substituierbarkeit angenommen.78 Substituiert werden kann in diesem System nur zwischen Human- und Sachkapital sowie innerhalb des Naturkapitals.79 Der starken Nachhaltigkeit liegt die ökozentrische Sichtweise zugrunde, wonach der Mensch, wie auch alle anderen Lebewesen, nur eine einzelne Komponente im ökologischen System ist.80 Seine Bedürfnisse sind in Relation des ganzen Systems zu betrachten. Es wird davon ausgegangen, dass das System »Erde« ein in sich geschlossenes und nicht materiell wachsendes thermodynamisches System ist.81 82 Die Natur wird hier als Basis des Lebens verstanden und die intakte Umwelt als eine Grundvoraussetzung für das Bestehen von Human- und Sachkapital gesehen. “Dieser Zusammenhang wird im »Vorrangmodell« deutlich. Die Prämisse der starken Nachhaltigkeit ist die Position der ökologischen Ökonomie, welche innehat, dass Wirtschaftswachstum Belastungsgrenzen hat. Es wird von einem unauflösbaren Zielkonflikt zwischen Wachstum und der Schonung der Umwelt ausgegangen, daher wird hier von »Wachstumspessimisten« gesprochen.83 Daly, Vertreter der ökologischen Ökonomie, legte drei Managementregeln fest, die in Bezug auf die starke Nachhaltigkeit verwendet werden, diese fordern, dass durch menschliches Handeln
- Erneuerbare Ressourcen nur in dem Maße genutzt werden, in dem sie sich auch regenerieren,
- Ressourcen geschont werden, da sie sich nicht selbst erneuern können und somit das Naturkapital verringern würden, und wenn dann nur in dem Maße genutzt werden, wie andere physisch und funktionell gleichwertige natürliche erneuerbare Ressourcen geschaffen werden können sowie
- die Senkenfunktion der Umwelt nur so weit zu nutzen, wie die Aufnahmekapazität der Natur es ermöglicht, ohne einen Schaden davon zu tragen.84
In der ökologischen Ökonomie wird der Grundgedanke der »Prävention und Antizipation«, statt der »Nachsorge und Reaktion«, welchen die neoklassische Ökonomie als Lösung sieht, vertreten.85
Generell stehen sich die beiden Leitbilder der »starken und schwachen Nachhaltigkeit« relativ konträr gegenüber, daher wurde ein Mittelweg, die »ausgewogene Nachhaltigkeit«, welche umweltfreundliche und nachhaltiges Wachstum deklariert und auf eine Strategie ökologischer Konsummuster und Effizienz setzt, mit auf den Weg gebracht.86 Jedoch ist die Relevanz dieses Ansatzes umstritten.87 Die zwei Paradigmen weisen eine Polarisierung in den Bereichen der Weltanschauung, der Relevanz der Natur und in der Position zum Wachstum auf. Erneut wird festgestellt, dass die Konkretisierung nachhaltiger Entwicklung ethische Betrachtungsweisen fordert.
2.2.4 Strategien zur Realisierung nachhaltiger Entwicklung
Was jedoch sowohl starke und schwache Nachhaltigkeit verfolgen sind Strategien zur Realisierung nachhaltiger Entwicklung. Es handelt sich hierbei um drei unterschiedliche Ansätze zur Lösung der Naturprobleme sowie der Verteilungsprobleme.88 Die drei Strategien sind aufeinander abzustimmen und in einer ganzheitlichen Nachhaltigkeitsstrategie zusammenzuführen.89
2.2.4.1 Effizienz-Strategie
Die Effizienz-Strategie hat es zum Ziel, den Material- und Energieeinsatz pro Produktionseinheit zu minimieren.90 Damit wird auf eine Steigerung der Ressourcen- und Energieeffizienz gezielt, welche zu einer Entlastung der Natur führt.91 Diese Strategie beruht auf der Idee der »Dematerialisierung«, was eine Entkopplung der Wirtschaftsleistung vom Umweltverbrauch bedeutet. Neben der ökologischen Vorteilhaftigkeit weist die Effizienz-Strategie auch ökonomische Vorteile auf. Zu diesen ökonomischen Vorteilen zählen: Steigerung der Ressourcensicherheit, Kostenreduktion durch Material- und Energieeinsparungen und geopolitische Krisenprävention durch Vermeidung von Konflikten um Ressourcen.92 Die Effizienz-Strategie ist von den drei Leitstrategien am meisten operationalisiert und wird von Wirtschaft und Politik als eine besonders wichtige Strategie anerkannt.93 94 Kritisiert wird der »Technikoptimismus« dieser Strategie sowie der »ReboundEffekt«. Der »Rebound-Effekt« beschreibt die Problematik, dass technische Innovationen nicht unbedingt zu einem Einsparpotenzial, sondern ggf. sogar noch zu einem Mehrverbrauch führen können. Dieser Mehrverbrauch kann durch sinkende Preise, erhöhte Nachfrage nach effizienteren Produkten und verändertem Nutzungsverhalten ausgelöst werden. ^Aufgrund dieser Kritikpunkte werden Mengen-Reduktionsziele und Innovation von Lebensstilen ergänzend empfohlen, hierzu zählen unter anderem Veränderungen der Konsummuster wie die Langlebigkeit und Mehrfachnutzung von Produkten.95
2.2.4.2 Konsistenz Strategie
Das Ziel der Konsistenz Strategie ist es, die Stoff- und Energieströme aus menschlicher Aktivität an die natürlichen Ströme der Umwelt anzupassen.96 Die menschlichen Einwirkungen auf die Umwelt sollen also im Einklang mit den Abläufen der Natur sein.97 Die Konsistenz Strategie bezieht sich auf der Vorstellung von in-sich-geschlossenen Kreisläufen. Naturfremde Stoffe sollen nur in geschlossenen Systemen wiedergewonnen werden und natureigene sollen sich in den natürlichen Kreislauf der Natur einbetten. Stoffe, die nicht in einen Kreislauf eingeführt werden, können sollen substituiert oder vermieden werden. Im Vergleich zu Effizienz- und Suffizienz-Strategie soll bei dieser Strategie die Materialnutzung nicht überwiegend reduziert werden, sondern so verändert werden, dass Abfälle und Emissionen zurück in einen gesunden Kreislauf geführt werden können.98 Das macht die Konsistenz Strategie zu einer deutlich anspruchsvolleren Strategie sowohl im Bereich der Konzipierung als auch im Bereich der Umsetzung.99 Zudem wird eine Umstellung von Konsum- und Produktionsmustern, eine Förderung innovativer Technologien sowie eine Gestaltung komplexer Innovationssysteme vorausgesetzt.100
2.2.4.3 Suffizienz Strategie
Die Forderung der Suffizienz-Strategie ist eine sozial verträgliche Höchstgrenze für die Wirtschaft bzw. dem Wirtschaftswachstum, um die Belastungsgrenzen der Umwelt einhalten zu können.101 Die Strategie besteht aus den Komponenten der Selbstbeschränkung, der qualitativen Veränderung der Lebensstile und dem Strukturwandel des Güterkorbs von materiellen Gütern hin zu Dienstleistungen und immateriellen Gütern.102 Das Ziel ist ein Lebensstil der weniger auf dem Wachstumsparadigma und mehr auf dem Prinzip der Genügsamkeit beruht.103 Eigene Bedürfnisse sollen hinterfragt werden in Form von »Wie viel ist genug?« und »Brauche ich das wirklich?«. Es liegt die Auffassung zugrunde, dass ein verminderter Konsum ebenso für ein zufriedenstellendes, also »suffizientes« Leben genügt.104 Einige Kritiker bemängeln die Anforderungen, die damit an das Individuum, die Politik und die Wirtschaft gestellt werden, da diese nicht als marktkonform empfunden werden. Zudem gehe das Prinzip der Selbstbeschränkung gegen das Prinzip der Konsumentensouveränität.105 Die Komponenten der »Suffizienz« sind Forderungen, welche, wie in 2.1 aufgeführt, seit den 60ern von kritischen Stimmen gestellt werden. Bis heute sehen viele Ökononrinnen, Wissenschaftlerinnen und andere Expertinnen die Änderung der Lebensstile als entscheidende Schlüsselrolle zur nachhaltigen Entwicklung. Um die Relevanz der »Suffizienz« als Leitstrategie wird daher noch genauer in späterem Kapitel eingegangen.
Generell ist ein Zusammenspiel der drei Leitstrategien entscheidend, denn nur so können die ökonomischen, sozialen und ökologischen Probleme bewältigt werden. Auch wenn Stimmen aus der Wirtschaft kritisieren, dass die »Suffizienz« utopisch sei, ist diese Strategie unabdingbar, denn Effizienzgewinne können kompensiert - sogar überkompensiert - werden und die Konsistenz-Strategie fordert aufgrund ihrer Komplexität ebenso ein Maß an »Suffizienz«. Folgende zwei Beispiele zeigen die Relevanz des Zusammenspiels der einzelnen Strategien:
- Eine konsistente Maßnahme von Konsumentinnen ist beim Fleischeinkauf auf die Verwendung von naturverträglicher Technologien bei der Fleischproduktion zu achten. Angenommen ein/e Konsumenten entscheidet sich also für den Kauf von Fleisch aus der Biolandwirtschaft, dann ist dies für die Umwelt und für den Menschen verträglicher. Jedoch wird die Menge an Methangas, Methangas ist rund 25-Mal schädlicher als CO2 und daher auch der Haupttreiber der Klimaerwärmung106, welche bei der Fleischproduktion anfallen, nicht reduziert. Die Menge an Treibhausgasen kann nur reduziert werden, wenn weniger Fleisch konsumiert wird. Hier stehen besonders die Industrieländer in der Pflicht.
- Ein anderes Beispiel: Der Kauf eines neuen Elektroautos und die damit verbundene Entsorgung eines älteren Fahrzeugs. Das Elektroauto ist das deutlich effizientere Produkt, aus Seiten der Effizienz ist die Nachhaltigkeit hier erfüllt. Betrachtet man jedoch die Entsorgung des alten Fahrzeugs kann der Konsistenz-Strategie hier kaum nachgekommen werden. Da zudem beim Kauf eines neuen Autos in den meisten Fällen auch nicht auf Komfort und neuartige Funktionen verzichtet wird, fällt die Suffizienz hier auch negativ aus.
Ein integrativer Ansatz der drei Leitstrategien ist also essenziell. Erneut zeigt sich, dass ein Denken in Teilsystemen nicht zielführend ist und dass eine ganzheitliche Betrachtungsweise und das Denken im kompletten System unabdingbar ist, um eine wirkliche Veränderung zu erzielen. Alles andere wäre nur im Teilsystem zielführend und hätte auf das ganze System nur bedingt bis keinen Einfluss.
2.3 Fazit
Das Verständnis, das Bewusstsein und die Relevanz von »Nachhaltiger Entwicklung« wächst seit Aufkommen der Umweltprobleme stetig. Diskussionen über aktuelle Problematiken sind bis in das 18. Jahrhundert zurückzuverfolgen. Die Naturzerstörung und die daraus resultierenden Folgen wurden schon lange erkannt und thematisiert. Es wurde schon in den Sechzigern klar, dass unsere Wirtschaftsweise der größte Treiber der Zerstörung ist, daher steht »Nachhaltige Entwicklung« in enger Korrelation zu einer Kritik am Wirtschaftssystem. Relevanz auf politischer Ebene gewann der Begriff schon in den Siebzigern, der wichtigste Meilenstein zur Verankerung des Nachhaltigkeitsleitbildes wurde durch die UNCED Konferenz 1992 in Rio gelegt. Es wurden vielfach Konzepte und Programme zur Umsetzung »nachhaltiger Entwicklung« auf politischer Ebene entwickelt und verabschiedet, oft scheiterte es jedoch an der Umsetzung. Die Etablierung des Leitbildes der »nachhaltigen Entwicklung« scheint ambivalent, die Relevanz und die zunehmende Institutionalisierung und Internationalisierung der Nachhaltigkeit steht im Gegensatz zur langsamen und fragmentarischen politischen Konsensfindung und Umsetzung. Aufgeführte Gründe für die fehlende und langsame Umsetzung sind die zu geringe Konkretisierung, die Unverbindlichkeit sowie das Dilemma zwischen Wirtschaftswachstum und Konsumreduktion.
Eine einheitliche Definition des Begriffes »Nachhaltigkeit« lässt sich kaum bestimmen, denn Nachhaltigkeit liegt vielmehr ein ethisches-normatives Leitbild zugrunde. Nachhaltige Entwicklung ist somit keine Handlungsvorschrift, sondern eine Anleitung, wie Handlungen und Entscheidungen bewertet und reflektiert werden sollen - ergo kein operativer Begriff, der mit Eigenschaften besetzt ist. Somit wird der nachhaltigen Entwicklung jedoch eine Urteilskraft nach kollektivem Verständnis vorausgesetzt. Diese Beurteilungsvorschrift ohne substanziellen Gehalt formuliert die Brundtland Kommission in ihrer Definition von Nachhaltigkeit treffend.107 Trotz der fehlenden Operationalisierung gibt es Kernelemente, die im Rahmen der Nachhaltigkeit stets auftreten. Aber auch hier herrschen Differenzen in Anwendung und Umsetzung. Besonders im Bereich der starken und schwachen Nachhaltigkeit kommt es, aufgrund der unterschiedlichen Auffassungen bezüglich Wachstumsgrenzen, zu Kontroversen der jeweiligen Vertreter der ökologischen und neoklassischen Ökonomie. Auch ist die Relevanz der Strategie der »Suffizienz« umstritten - auch hier ist es, der Widerspruch - Verzicht versus Wachstum - zum herrschenden Wirtschaftssystem, welcher als Kritikpunkt genannt wird. Vor dem Hintergrund der aktuellen Lage, in der sich katastrophale Klimaauswirkungen vermehrt häufen, wird jedoch klar, dass die Strategie der »Suffizienz« und eine Präferenz der ökologischen Dimension, somit ein Leitbild der starken Nachhaltigkeit längst überfällig ist.
Generell und zusammenfassend soll die nachhaltige Entwicklung folgende Paradigmen innehaben:108
- Gerechtigkeit - intergenerationell und intragenerationell
- Ganzheitlichkeit und Integration - Betrachtung des Systems und der Wechselbeziehungen aus Ökologie, Ökonomie und dem Sozialen
- Verantwortung und Partizipation - Alle Parteien sind verantwortlich, interdisziplinäres Arbeiten der Parteien untereinander
- Prävention und vorausschauendes Handeln - Viele Schäden sind nicht irreversibel
- Blick aufs Ganze - Denken im lokalen sowie globalen zeitlich unbegrenzten System
- Veränderung der Sichtweise - Ethisch-moralische Einstellungen dem Nachhaltigkeitsparadigma anpassen
Es verbergen sich große Fragen, Herausforderungen, Konflikte und Debatten hinter dem Begriff der »Nachhaltigkeit«. Daher erfordert eine nachhaltige Betrachtungsweise permanente Reflexion, eine interdisziplinäre Sicht sowie eine jeweilige Anpassung an bestimme Fragestellungen mit Beteiligung aller Akteure.
[...]
1 (S. Kern, 2014)
2 (Presseportal, 2016a)
3 (Pirki, 2015)
4 (Bamburger, 2021)
5 (Gutberiet, 2018)
6 (Rundfunk, 2021)
7 (Umweltbundesamt, 2020)
8 (WHO, 2011)
9 (Grunwald & Kopfmüller, 2006)
10 (Grunwald & Kopfmüller, 2006; Spindler, 2012)
11 (Brockhaus, 2017)
12 (von Hauff, 2014)
13 (Grunwald & Kopfmüller, 2006)
14 (Huss & von Gadow, 2012)
15 (Huss & von Gadow, 2012; Von Carlowitz, 2013)
16 (von Hauff, 2014)
17 (Becker et al., 2004)
18 (Wikipedia-Autoren, 2002)
19 (Wieland, 2002)
20 (Hank, 2014; Kruse, 2012)
21 (Wikipedia-Autoren, 2003)
22 (Von Hauff, 2014)
23 (Pollert et al., 2010)
24 (The social contract, 2006)
25 (Grundwald & Kopfmüller, 2006)
26 (Pollert et al., 2016)
27 (Von Hauff, 2014)
28 (Rundfunk, 2018)
29 ((Meadows et al., 1972)
30 (Grundwald & Kopfmüller, 2006)
31 (Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen, 2019)
32 (Von Hauff, 2014; Grunwald & Kopfmüller, 2006)
33 (Daly, 1997)
34 (Grundwald & Kopfmüller, 2006)
35 (Von Hauff, 2014)
36 (Grunwald & Kopfmüller, 2006)
37 (Kopfmüller et al., 2007)
38 (von Hauff, 2014)
39 (Hauff, 1987)
40 (Grunwald & Kopfmüller, 2006)
41 (Grunwald & Kopfmüller, 2006; Von Hauff, 2014)
42 (UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung, o. D.)
43 (Weltgipfel Rio, o. D.)
44 (Forum Umwelt und Entwicklung & Hoering, 2002)
45 (von Hauff, 2014)
46 (Grunwald &Kopfmüller, 2006)
47 (Forum Umwelt und Entwicklung, 1997)
48 (Forum Umwelt und Entwicklung, 1997)
49 (Von Hauff, 2014)
50 (Forum Umwelt und Entwicklung & Hoering, 2002)
51 (von Hauff, 2014)
52 (Heinrich-Böll-Stiftung & Unmüßig, 2012)
53 (Weltgipfel Rio +20,2019)
54 (Weltgipfel Rio +20, 2015)
55 (Martens & Obenland, 2017)
56 (Nachhaltigkeitsziele verständlich erklärt, o. D.)
57 (Sangmeister & Wagner, 2019)
58 (Grunwald & Kopfmüller, 2006)
59 (Grunwald, 2016)
60 (Schubert, 1998)
61 (Pufe, 2017)
62 (Grundwald & Kopfmüller, 2006; Pufe, 2017; von Hauff, 2014)
63 (Grunwald, 2016)
64 (Gaubitz, 2018; Grunwald & Kopfmüller, 2006; von Hauff, 2014)
65 (Grunwald & Kopfmüller, 2006)
66 (Gaubitz, 2018)
67 (Pufe, 2016)
68 (Pufe, 2016; von Hauff, 2014)
69 (Pufe, 2016)
70 (Gaubitz, 2018; Grunwald & Kopfmüller, 2006; von Hauff, 2014)
71 (Gaubitz, 2018)
72 (Pufe, 2017)
73 (Grunwald & Kopfmüller, 2006)
74 (Ekins, 1999)
75 (von Hauff, 2014)
76 (Uni Hildesheim, 2020)
77 (von Hauff,2014)
78 (von Hauff, 2014)
79 (Grundwald & Kopfmüller, 2014)
80 (Pufe, 2016)
81 (Ott & Döring, 2008)
82 (von Hauff, 2014)
83 (Ott & Döring, 2008; Pufe, 2016)
84 (Grunwald & Kopfmüller, 2006)
85 (Pufe, 2016)
86 (Pufe 2016; von Hauff, 2014)
87 (Von Hauff, 2014)
88 (Huber, 1995)
89 (von Hauff, 2014)
90 (Grunwald &Kopfmüller, 2006)
91 (von Hauff, 2014)
92 (Grunwald & Kopfmüller, 2006; Pufe, 2014; von Hauff, 2014)
93 (Pufe 2016; von Hauff, 2014)
94 (Rebound Effekt, 2019)
95 (Grunwald & Kopfmüller, 2006; von Hauff, 2014;)
96 (Grunwald & Kopfmüller, 2006; Pufe 2016; von Hauff, 2014)
97 (von Hauff, 2014)
98 (Strigl, 2015)
99 (von Hauff, 2014)
100 (Pufe, 2016)
101 (von Hauff, 2014)
102 (Rogall, 2008)
103 (Grunwald & Kopfmüller, 2014)
104 (Grunwald & Kopfmüller, 2006; Pufe 2016; von Hauff, 2014)
105 (von Hauff, 2014)
106 (Quarks, 2021)
107 (Grunwald, 2016)
108 (Grunwald, 2016; Grunwald& Kopfmüller, 2014; Pufe, 2016)
- Citar trabajo
- Celine Burghardt (Autor), 2021, Nachhaltigkeit durch Design. Welche Haltung braucht eine nachhaltige Produktgestaltung?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1246906