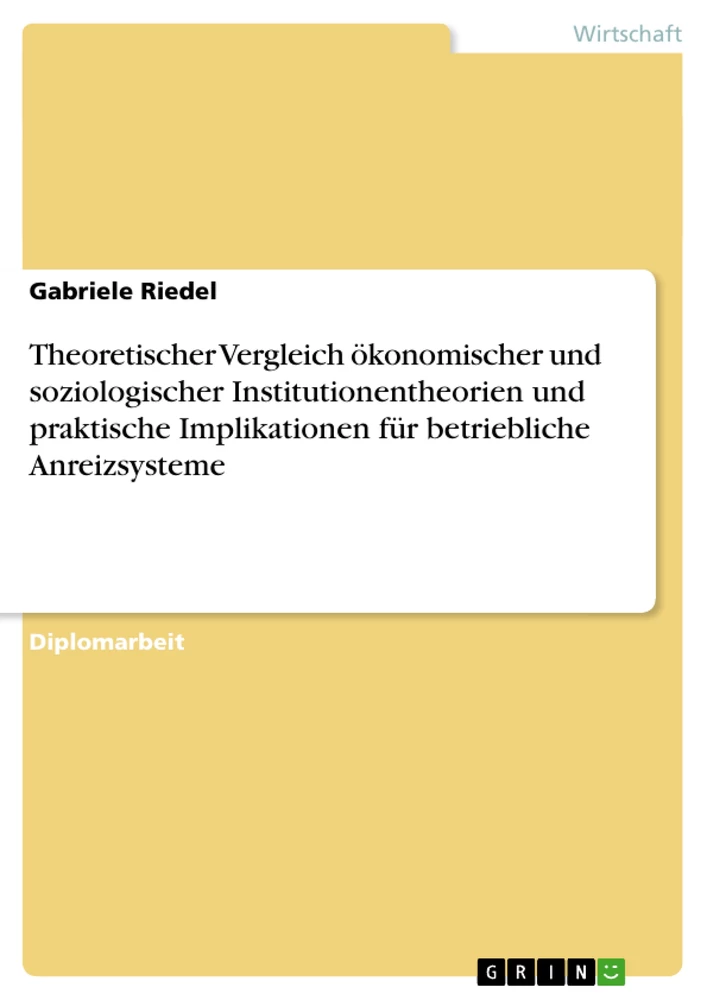Weder in der Soziologie noch in der Ökonomie bestehen einheitliche Definitionen darüber, was mit dem Begriff „Institution“ bezeichnet werden soll. In dieser Arbeit wird der wissenschaftliche Erkenntnisstand ökonomischer und soziologischer Institutionenanalysen näher aufgezeigt. Ziel soll dabei sein, die Unterschiede zwischen den Disziplinen herauszuarbeiten, um anschließend zu prüfen, inwieweit sich diese Unterschiedlichkeiten komplementär verhalten oder sich gegenseitig ausschließen. Ich werde zeigen, dass sich im theoretischen Vergleich neben den überwiegend konkurrierenden Annahmen auch komplementäre Ansatzpunkte, im Besonderen hinsichtlich des untersuchten Gesellschaftsausschnittes und Erklärungsgegenstandes finden lassen. Diese idealtypische Komplementarität wird zum Ausgangspunkt genommen, um eine eigene Theorie zu entwerfen, die beide Rationalitätskonzepte in einen übergeordneten, soziologischen Rahmen integriert. Zweckrationalität wird dabei als gesellschaftliche Norm interpretiert, die anderen übergeordneten und wertrationalen Normen unterworfen ist.
Der praktische Anwendungsteil bestärkt diese Ergebnisse hinsichtlich der eingeschränkten Erklärungskraft der Ökonomie im Vergleich zur Soziologie. Das Beispiel der effektiven Anreizsetzung in Unternehmen zeigt verschiedene Aspekte, die sich der ökonomischen Erklärungskraft entziehen und nur von soziologischen Institutionentheorien berücksichtigt werden: 1) soziale Präferenzen und Normen, 2) intrinsische Motivation und Identität und 3) die Rolle uneigennützigen Verhaltens für die Überwindung von sozialen Dilemmasituationen. Gerade eine Berücksichtigung dieser Aspekte bei der Anreizgestaltung ist jedoch ausschlaggebend für eine gesteigerte Motivation der Arbeitnehmer, die über die Ergebnisse durch rein ökonomische Anreizsetzung hinausgeht.
Inhaltsverzeichnis
- TEIL I: INSTITUTIONELLES HANDELN IN MARKT UND GESELLSCHAFT. THEORETISCHE GEGENÜBERSTELLUNG ÖKONOMISCHER UND SOZIOLOGISCHER INSTITUTIONENTHEORIEN
- 1 EINLEITUNG
- 2 ZUM INSTITUTIONENBEGRIFF
- 2.1 Entwicklung des Institutionenbegriffs in der Ökonomie
- 2.2 Entwicklung des Institutionenbegriffs in der Soziologie
- 2.3 Verknüpfung zu Webers Zweck- und Wertrationalität
- 3 ÖKONOMISCHE INSTITUTIONENTHEORIEN
- 3.1 Das Handlungsmodell des Homo oeconomicus
- 3.2 Zwischen Ökonomie und Soziologie: Habitualisierungsansatz
- 3.2.1 Veblen: Evolutorische Erklärung von Institutionen
- 3.2.2 Commons: Regulatorische Erklärung von Institutionen
- 3.3 Entsoziologisierung: Rational-Choice-Ansatz
- 3.3.1 Williamson: Transaktionskostenansatz
- 3.3.2 Spence: Prinzipal-Agenten-Ansatz
- 3.3.3 Coase: Verfügungsrechte-Ansatz
- 3.4 Rückbesinnung auf soziologische Elemente: Wirtschaftsgeschichte-Ansatz
- 3.5 Zusammenfassende Betrachtung
- 4 SOZIOLOGISCHE INSTITUTIONENTHEORIEN
- 4.1 Das Handlungsmodell des Homo sociologicus
- 4.2 Erklärung wertrationalen Handelns: Kultur-Ansatz
- 4.2.1 Parsons: Institutionen als Wertsystem
- 4.2.2 Berger/Luckmann: Institutionen als Realitätssystem
- 4.2.3 Neo-Institutionalismus in der Organisationssoziologie
- 4.3 Einbeziehung zweckrationalen Handelns: Rationalansatz
- 4.3.1 Blau: Austauschtheorie
- 4.3.2 Coleman: Rationale Sozialtheorie
- 4.3.3 Esser: Framing-Ansatz
- 4.4 Zwischen Ökonomie und Soziologie: Historischer Ansatz
- 4.4.1 Anwendung beider Handlungsmodelle
- 4.4.2 Pierson: Institutionelle Pfadabhängigkeit
- 4.5 Zusammenfassende Betrachtung
- 5 VERGLEICHENDE GEGENÜBERSTELLUNG INSTITUTIONEN-ÖKONOMISCHER UND -SOZIOLOGISCHER ANSÄTZE
- 5.1 Inhaltliche Konkurrenz und Komplementarität
- 5.2 Methodologische Konkurrenz und Komplementarität
- 5.3 Zusammenfassende Betrachtung
- 6 EIGENE THEORIE: ZWECKRATIONALITÄT ALS KULTIVIERTE NORM
- TEIL II: ZWISCHEN FINANZIELLEM ANREIZ UND SOZIALER EINBINDUNG. VERGLEICH DER PRAKTISCHEN ERKLÄRUNGSKRAFT ÖKONOMISCHER UND SOZIOLOGISCHER INSTITUTIONENTHEORIEN HINSICHTLICH EFFEKTIVER ANREIZSETZUNG
- 7 GRUNDLEGENDES ZU ANREIZSYSTEMEN
- 7.1 Überwindung des Motivationsproblems
- 7.2 Extrinsische und intrinsche Motivation
- 7.3 Konträre praktische Auswirkungen
- 8 MONETÄRE ANREIZSETZUNG
- 8.1 Zweckrationalität: Produktivitätssteigerung durch finanzielle Anreize
- 8.1.1 Prinzipal-Agenten-Ansatz
- 8.1.2 Transaktionskosten-Ansatz
- 8.2 Gefahren und Grenzen leistungsabhängiger Entlohnung
- 8.2.1 Beschränkung auf extrinsische Anreize
- 8.2.2 Einfache, ausführende Tätigkeiten
- 8.2.3 Sortierfunktion
- 8.1 Zweckrationalität: Produktivitätssteigerung durch finanzielle Anreize
- 9 NORMATIVE ANREIZSETZUNG
- 9.1 Wertrationalität: Erzielung eines einheitlichen Anstrengungsniveaus
- 9.1.1 Leistungsnormen, Gruppennormen
- 9.1.2 Unternehmenskultur
- 9.1.3 Überwachung, Sanktionierung
- 9.2 Gefahren und Grenzen normativer Anreizsetzung
- 9.2.1 Beschränkung auf intrinsische Anreize
- 9.2.2 Legitimation
- 9.2.3 Kontraproduktiver Gruppendruck
- 9.1 Wertrationalität: Erzielung eines einheitlichen Anstrengungsniveaus
- 10 VERBINDUNG VON ANREIZMANAGEMENT UND NORMMANAGEMENT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit vergleicht die Erklärungskraft ökonomischer und soziologischer Institutionentheorien hinsichtlich betrieblicher Anreizsysteme. Sie untersucht die Unterschiede zwischen den Disziplinen und prüft deren komplementäres oder konkurrierendes Verhalten.
- Vergleich ökonomischer und soziologischer Institutionentheorien
- Analyse des Institutionenbegriffs in Ökonomie und Soziologie
- Untersuchung verschiedener Handlungsmodelle (Homo oeconomicus, Homo sociologicus)
- Bewertung der praktischen Implikationen für betriebliche Anreizsysteme
- Entwicklung einer eigenen Theorie zur Zweckrationalität
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert den Dissens zwischen sozialwissenschaftlichen Disziplinen bezüglich des Institutionenbegriffs und benennt den Vergleich der Erklärungskraft ökonomischer und soziologischer Institutionentheorien als Ziel der Arbeit. Kapitel 2 beleuchtet die unterschiedlichen Entwicklungen des Institutionenbegriffs in Ökonomie und Soziologie und seine Verknüpfung mit Webers Rationalitätstypen. Kapitel 3 präsentiert ökonomische Institutionentheorien, von Handlungsmodelle des Homo oeconomicus bis hin zu Ansätzen wie dem Transaktionskostenansatz und dem Prinzipal-Agenten-Ansatz. Kapitel 4 behandelt soziologische Institutionentheorien, inklusive des Homo sociologicus und Ansätze wie den Kultur- und den Rationalansatz. Kapitel 5 vergleicht die ökonomischen und soziologischen Ansätze hinsichtlich inhaltlicher und methodologischer Aspekte. Kapitel 6 entwickelt eine eigene Theorie, die Zweckrationalität als kultivierte Norm beschreibt. Kapitel 7 legt die Grundlagen zu Anreizsystemen dar und Kapitel 8 behandelt die monetäre Anreizsetzung im Detail, inklusive der Gefahren und Grenzen leistungsabhängiger Entlohnung. Kapitel 9 befasst sich mit der normativen Anreizsetzung und ihren potenziellen Problemen.
Schlüsselwörter
Institutionentheorien, Ökonomische Soziologie, Homo oeconomicus, Homo sociologicus, Anreizsysteme, Zweckrationalität, Wertrationalität, Transaktionskosten, Prinzipal-Agenten-Problem, Unternehmenskultur, Normmanagement.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Homo oeconomicus und Homo sociologicus?
Der Homo oeconomicus handelt rein zweckrational und nutzenmaximierend, während der Homo sociologicus durch soziale Normen und Rollenerwartungen gesteuert wird.
Warum greifen rein monetäre Anreizsysteme oft zu kurz?
Sie vernachlässigen intrinsische Motivation, soziale Präferenzen und die Rolle der Identität, was langfristig die Leistungsbereitschaft schwächen kann.
Was versteht Max Weber unter Zweck- und Wertrationalität?
Zweckrationalität fokussiert auf das Erreichen eines Ziels mit effizienten Mitteln; Wertrationalität folgt ethischen, religiösen oder ästhetischen Eigenwerten unabhängig vom Erfolg.
Was ist das Prinzipal-Agenten-Problem?
Ein ökonomisches Dilemma, bei dem ein Auftraggeber (Prinzipal) nicht sicher sein kann, ob der Beauftragte (Agent) in seinem Sinne handelt (Informationsasymmetrie).
Wie kann Normmanagement die Motivation steigern?
Durch eine starke Unternehmenskultur und geteilte Werte können soziale Dilemmata überwunden werden, die durch rein finanzielle Anreize ungelöst blieben.
- Quote paper
- Dipl.-Soz. Gabriele Riedel (Author), 2008, Theoretischer Vergleich ökonomischer und soziologischer Institutionentheorien und praktische Implikationen für betriebliche Anreizsysteme, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/124680