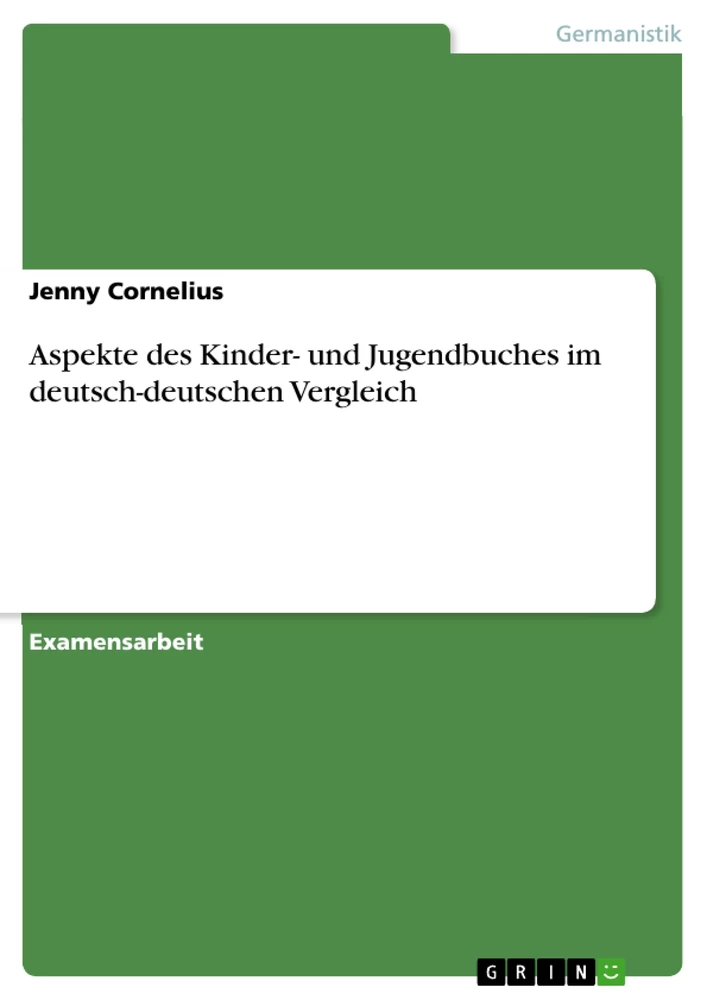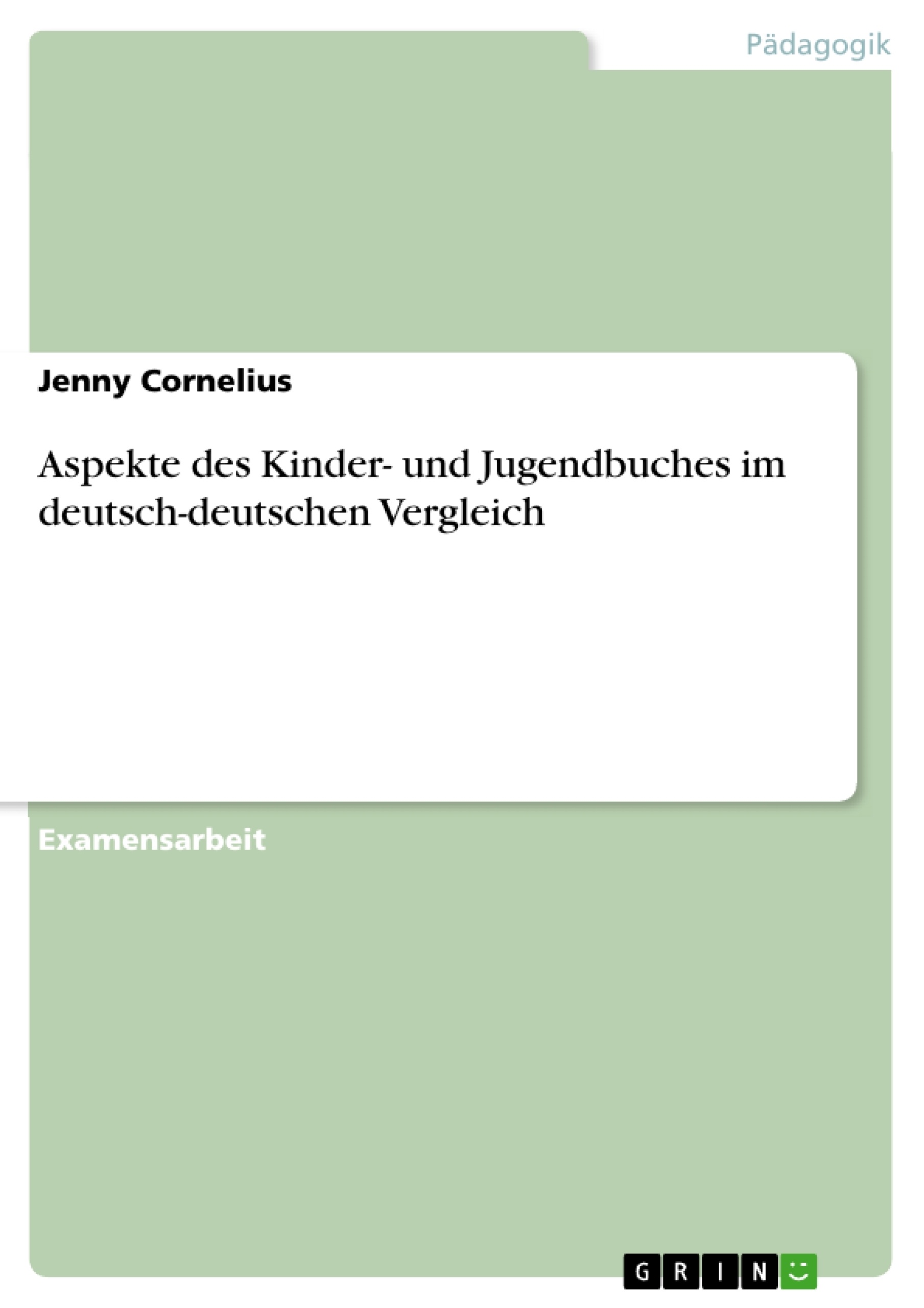Der deutsche Jugendbuchforscher Klaus Doderer definierte Kinderliteratur im Kinderlexikon der Kinder- und Jugendliteratur als eine Textsorte, die ausdrücklich für Kinder produziert wird: Spezifische Kinderliteratur . Sie stellt einen Sammelbegriff für die gesamte Produktion von Werken für Kinder dar, in den sowohl belletristische Werke als auch Sach- und Fachbücher einbezogen werden. Die Definition von Jugendliteratur steht in großen Teilen in Übereinstimmung mit der von Kinderliteratur. Es wird unterschieden zwischen spezifischer Jugendliteratur und der Jugendlektüre, die Jugendliche über das Angebot für sie hinaus noch lesen. Diese Literaturform umfasst alle Texte für junge Menschen, die nicht mehr Kinderliteratur, aber auch noch nicht als Erwachsenenliteratur deklarierte Bücher lesen wollen.
Wie die Literatur allgemein, kann auch die Kinder- und Jugendliteratur in die Gattungen Epik, Dramatik, Lyrik oder Sachtexte eingeteilt werden, wie zum Beispiel in Kindergeschichte, Roman, Laienspiel, Trauerspiel, Kinderreim und Stimmungsgedicht, erzählender Sachtext und Lehrbuch. Bei seiner Definition dieser Literaturform deutet Klaus Doderer an, dass diese in Stil und Sprache den Tendenzen der Erwachsenenliteratur, jedoch mit einer gewissen Verzögerung, folgt. Weiterhin ist zu erkennen, dass Kindern in ihren Entwicklungsstufen und den damit verbundenen unterschiedlichen Interessen Verschiedenes angeboten wird – daher auch die Einteilung in Kinderliteratur und Jugendliteratur.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Kinderliteratur im deutsch-deutschen Vergleich: Unterscheidung von Kinder- und Jugendbuch, Familie und Familienpolitik in beiden deutschen Staaten in den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts
- 2 Die Familie in der Kinder- und Jugendliteratur (KJL) der 70er Jahre
- 2.1 Frauenbewegte Zeiten: Die Darstellung der Institution Familie in der KJL der BRD in den 70er Jahren
- 2.2 Frauen in die Produktion: Die Darstellung der Institution Familie in der KJL der DDR in den siebziger Jahren
- 3 Familiale Aspekte der 70er Jahre im deutsch-deutschen Vergleich am Beispiel zweier Kinderromane
- 3.1 Zwei ausgewählte Beispielbücher: Bekannte Autoren, hohe Auflagen, verfilmte Stoffe
- 3.1.1 Christine Nöstlinger als Repräsentantin der problemorientierten und phantastischen Kinderliteratur der BRD
- 3.1.1.1 Leben und literarisches Schaffen: Von der Hausfrau zur Schriftstellerin
- 3.1.1.2 Thematische Schwerpunkte ihrer Werke: Selbstverwirklichung und Selbstbestimmung
- 3.1.2 Wir pfeifen auf den Gurkenkönig – eine reale Familie unter phantastischem Einfluss
- 3.1.2.1 Die Entstehung eines Kinderbuchklassikers in Zeiten des Aufbruchs und der Emanzipation
- 3.1.2.2 Die Geschichte einer Rebellion als Auflehnung gegen autoritäre Strukturen
- 3.1.3 Peter Brock als Repräsentant der problemorientierten und humoristischen Kinderliteratur der DDR
- 3.1.3.1 Leben und literarisches Schaffen: Postler, Filmemacher und auch Schriftsteller
- 3.1.3.2 Thematische Schwerpunkte seiner Werke: (Un)gewöhnlicher Alltag zwischen Schule und Zuhause
- 3.1.4 Ich bin die Nele - Einflussreiche Phantasterei einer Individualistin
- 3.1.4.1 Die Entstehung eines Kinderbuchklassikers in Zeiten der Umsetzung der Festlegungen des Familiengesetzbuches
- 3.1.4.2 Nele Sonntag bewährt sich im familialen wie im sozialen Umfeld
- 3.2 Familiendarstellung im direkten Vergleich
- 3.2.1 Familienzusammensetzung in beiden Literaturbeispielen
- 3.2.2 Die Rolle der Mutter: zwischen Haushalt und Selbstverwirklichung
- 3.2.3 Die Rolle des Vaters: zwischen Versorger, Patriarch und Vorbildfigur
- 3.2.4 Rolle des/der Kindes/der: zwischen Erziehung und Selbsterfahrung
- 3.2.5 Familienleben: Schlüsselkinder vs. Nesthäkchen
- 3.2.6 Schulalltag: kollektivierte Freizeit vs. individualisierte Freiheit
- 4 Ergebnisse der Analyse von Gemeinsamkeiten und Unterschieden in der KJL unter familialem Aspekt
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Kinder- und Jugendliteratur der 70er Jahre in der BRD und der DDR im Hinblick auf die Darstellung der Familie. Ziel ist es, Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Behandlung familiärer Themen und der Abbildung von Familienstrukturen in den beiden deutschen Staaten aufzuzeigen.
- Darstellung der Familie in der Kinder- und Jugendliteratur der 70er Jahre
- Vergleich der Familienbilder in der BRD und DDR Literatur
- Einfluss der Frauenbewegung auf die Kinderliteratur
- Analyse ausgewählter Kinderromane
- Unterschiede in der Erziehung und im Schulalltag
Zusammenfassung der Kapitel
1 Kinderliteratur im deutsch-deutschen Vergleich: Unterscheidung von Kinder- und Jugendbuch, Familie und Familienpolitik in beiden deutschen Staaten in den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts: Dieses Kapitel liefert eine Einführung in die Thematik und definiert die Begriffe Kinder- und Jugendliteratur im Kontext der beiden deutschen Staaten der 1970er Jahre. Es beleuchtet unterschiedliche Definitionen von Kinder- und Jugendliteratur, die jeweiligen Altersgrenzen und die Schwierigkeiten einer eindeutigen Abgrenzung. Der Fokus liegt auf der Herausarbeitung der unterschiedlichen Ansätze in der Definition und Kategorisierung dieser Literaturformen in Ost und West, unter Berücksichtigung historischer und sozialer Einflüsse auf die jeweilige Literaturproduktion.
2 Die Familie in der Kinder- und Jugendliteratur (KJL) der 70er Jahre: Dieses Kapitel analysiert die Darstellung der Familie in der Kinder- und Jugendliteratur der 1970er Jahre in der BRD und der DDR. Es untersucht, wie die gesellschaftlichen Veränderungen und die Frauenbewegung die literarische Abbildung von Familienstrukturen beeinflusst haben, sowohl in den west- als auch in den ostdeutschen Texten. Der Fokus liegt auf den unterschiedlichen Perspektiven und den spezifischen Herausforderungen, denen die Kinderliteratur in beiden gesellschaftlichen Kontexten begegnete.
3 Familiale Aspekte der 70er Jahre im deutsch-deutschen Vergleich am Beispiel zweier Kinderromane: Das Kapitel vergleicht die Darstellung von Familien in zwei ausgewählten Kinderromanen aus der BRD und der DDR. Es analysiert die Familienstrukturen, die Rollenverteilung von Eltern und Kindern, und den Einfluss von gesellschaftlichen Normen und Ideologien auf die literarische Gestaltung der Familien. Durch detaillierte Analysen der ausgewählten Texte werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Darstellung des Familienlebens in den beiden deutschen Staaten herausgearbeitet.
Schlüsselwörter
Kinderliteratur, Jugendliteratur, deutsch-deutscher Vergleich, DDR, BRD, 1970er Jahre, Familie, Frauenbewegung, Kinderroman, Erziehung, Schulalltag, Sozialisation, Identität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Kinderliteratur im deutsch-deutschen Vergleich der 70er Jahre
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Diese Hausarbeit untersucht die Kinder- und Jugendliteratur der 1970er Jahre in der Bundesrepublik Deutschland (BRD) und der Deutschen Demokratischen Republik (DDR). Der Fokus liegt auf der Darstellung von Familien und den Unterschieden in der Abbildung familiärer Strukturen und Themen in Ost und West.
Welche Aspekte der Familien werden verglichen?
Der Vergleich umfasst die Familienstrukturen, die Rollenverteilung von Eltern und Kindern (Mutter, Vater, Kind), den Einfluss gesellschaftlicher Normen und Ideologien auf die literarische Gestaltung der Familien, Erziehung, Schulalltag und die Unterschiede in der Sozialisation und Identität der Kinder in den beiden deutschen Staaten.
Welche Methode wird verwendet?
Die Arbeit verwendet eine vergleichende Analyse von Kinderliteratur aus der BRD und der DDR der 1970er Jahre. Sie analysiert ausgewählte Kinderromane, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Darstellung des Familienlebens aufzuzeigen. Zusätzlich wird der Einfluss der Frauenbewegung auf die Kinderliteratur untersucht.
Welche Bücher werden analysiert?
Die Arbeit analysiert zwei ausgewählte Kinderromane: ein Buch von Christine Nöstlinger (BRD) und ein Buch von Peter Brock (DDR). Die Auswahl basiert auf bekannten Autoren, hohen Auflagen und der Verfilmung der Stoffe. Die spezifischen Titel werden im Inhaltsverzeichnis genannt ("Wir pfeifen auf den Gurkenkönig" und "Ich bin die Nele").
Was sind die wichtigsten Ergebnisse?
Die Arbeit wird Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Darstellung der Familie in der Kinder- und Jugendliteratur der BRD und der DDR der 1970er Jahre aufzeigen. Sie beleuchtet den Einfluss der jeweiligen politischen und gesellschaftlichen Systeme auf die literarische Gestaltung der Familie. Die Ergebnisse sollen Unterschiede in der Erziehung, im Schulalltag und in der Sozialisation der Kinder verdeutlichen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in vier Kapitel gegliedert: Kapitel 1 bietet eine Einführung und definiert Kinder- und Jugendliteratur im Kontext der 1970er Jahre. Kapitel 2 analysiert die Darstellung der Familie in der Kinderliteratur beider Staaten. Kapitel 3 vergleicht die Familienbilder in den ausgewählten Romanen. Kapitel 4 fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Kinderliteratur, Jugendliteratur, deutsch-deutscher Vergleich, DDR, BRD, 1970er Jahre, Familie, Frauenbewegung, Kinderroman, Erziehung, Schulalltag, Sozialisation, Identität.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an ein akademisches Publikum, das sich für Kinder- und Jugendliteratur, den deutsch-deutschen Vergleich und die Geschichte der Familie im 20. Jahrhundert interessiert. Sie dient der Analyse von Themen in einer strukturierten und professionellen Weise.
- Quote paper
- Jenny Cornelius (Author), 2008, Aspekte des Kinder- und Jugendbuches im deutsch-deutschen Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/124670