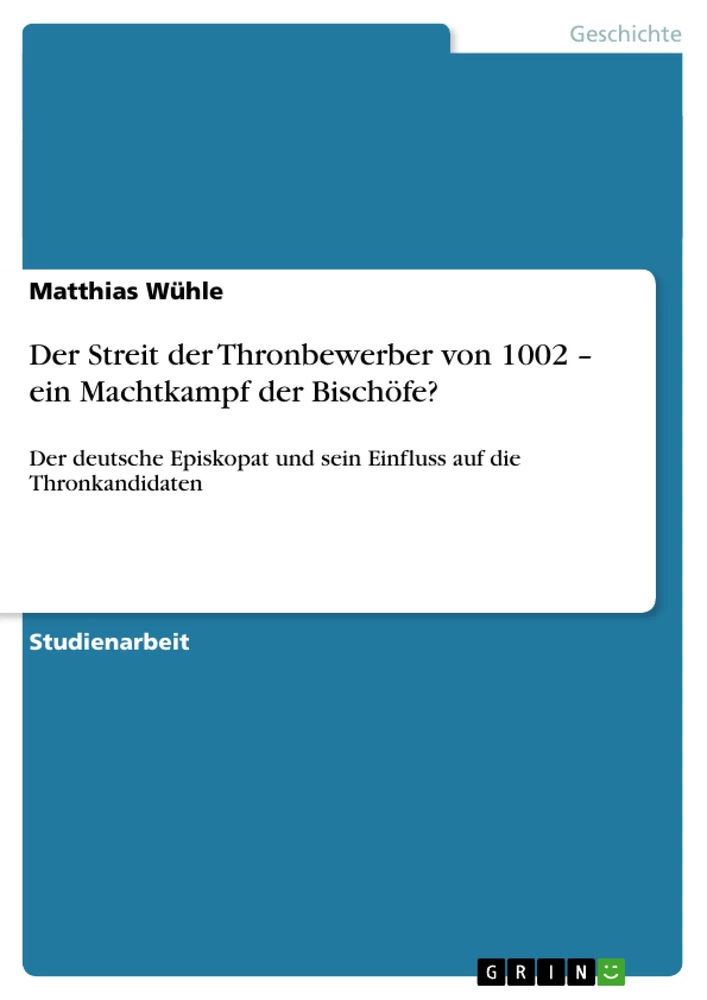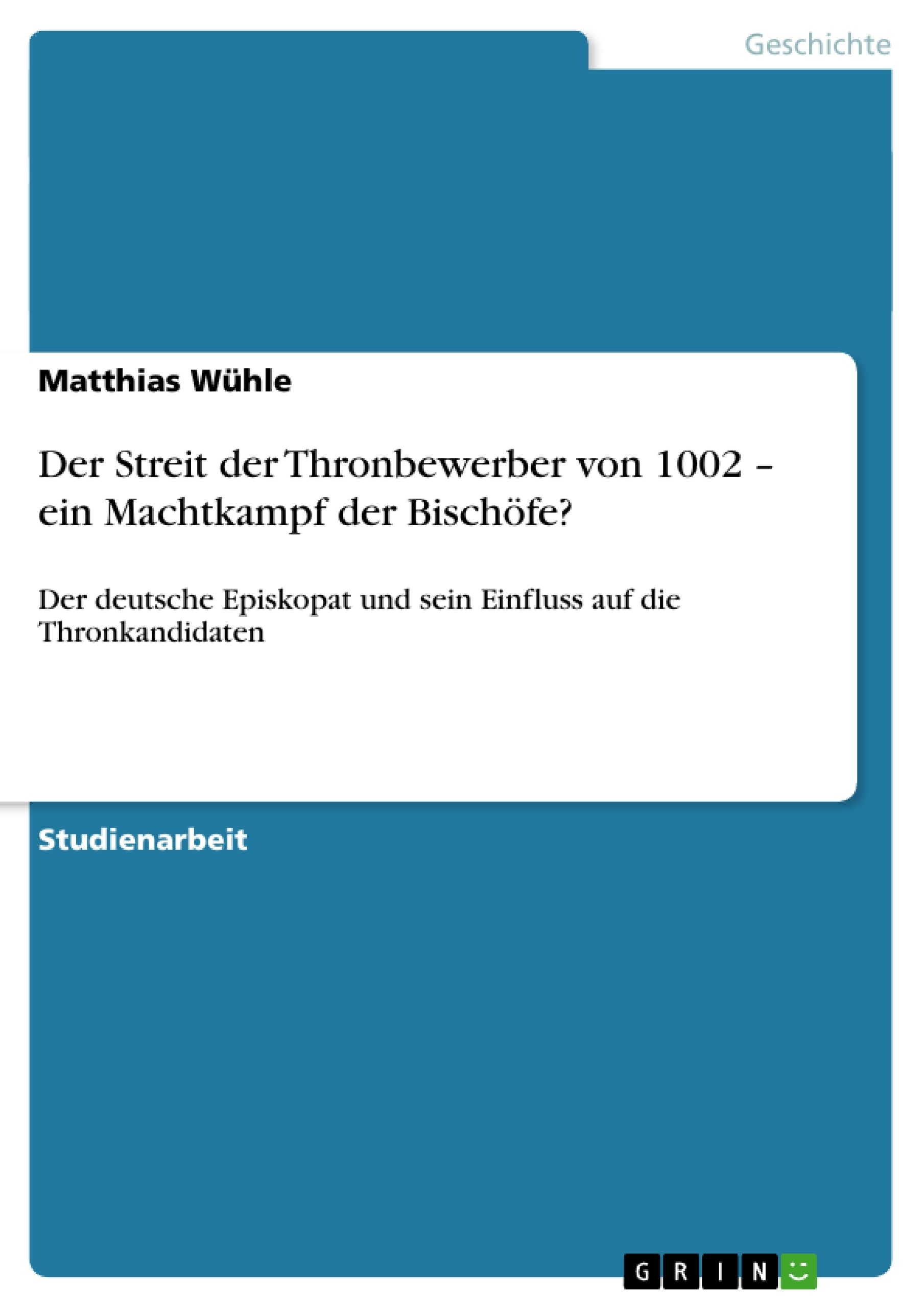Als am 23. Januar 1002 Kaiser Otto III. zweiundzwanzigjährig im italienischen Paterno starb, hinterließ er weder Nachfahren, noch hatte er sonst jemanden zu seinem Nachfolger bestimmt. Das Herrschergeschlecht der Ottonen war im Hauptstamm somit ausgestorben. Aus den potentiellen Nachfolgekandidaten hatten sich nach dem freiwilligen Ausscheiden Ottos von Kärnten, der über die weibliche Ottonenhauptlinie noch am ehesten Erbrechtsansprüche verwandtschaftlich hätte begründen können, drei Thronbewerber herauskristallisiert, denen eines gemeinsam war: Sie konnten – und mussten – sich auf einen Bischof berufen, der ihre Kandidatur unterstützte. Gerd Althoff bezeichnete das Kräftespiel zwischen Königtum, Kirche und Adel daher als Rahmenbedingung ottonischer Königsherrschaft. Ziel dieser Arbeit ist es, innerhalb dieses Kräftespiels die Bedeutung der Bischöfe um die erste Jahrtausendwende herauszuarbeiten. Waren sie nur das Werkzeug des Thronbewerbers oder reichte ihr Einfluss so weit, dass man von ihnen als „Königsmacher“ sprechen kann? Kann man sogar von einem Parteien- oder Lagerwahlkampf sprechen? Ging das Bischofsamt gestärkt oder geschwächt aus dem Thronstreit hervor? Und wie hat sich diese Auseinandersetzung auf das Kräfteverhältnis nach 1002 ausgewirkt?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Problem der Thronvakanz
- Die Stellung der Bischöfe vor 2002
- Die „Parteien“ der Thronbewerber
- Die Mainzer Partei
- Die Sächsische Partei
- Die Aachener Partei
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle der Bischöfe im Thronstreit des Jahres 1002 nach dem Tod Kaiser Ottos III. Ziel ist es, ihren Einfluss auf die Thronbewerber und den Verlauf des Machtkampfes zu beleuchten. Es wird der Frage nachgegangen, inwieweit die Bischöfe als „Königsmacher“ agierten und ob von einem Parteienwahlkampf gesprochen werden kann.
- Der Einfluss der Bischöfe auf die Thronbewerber
- Die Rolle der verschiedenen „Parteien“ (Mainzer, Sächsische, Aachener)
- Die Bedeutung der sakralen Legitimierung der Königsherrschaft
- Die Veränderung des Kräfteverhältnisses zwischen Königtum, Kirche und Adel
- Die Position der Bischöfe vor und nach dem Thronstreit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach dem Einfluss der Bischöfe auf den Thronstreit von 1002. Das Kapitel „Das Problem der Thronvakanz“ beschreibt die Krisensituation nach dem Tod Ottos III. und die daraus resultierende Machtvakanz. Im Kapitel „Die Stellung der Bischöfe vor 2002“ wird die Position der Bischöfe im ottonischen Herrschaftssystem analysiert, ihre wachsende Macht und ihre enge Verknüpfung mit dem Königtum. Das Kapitel „Die „Parteien“ der Thronbewerber“ untersucht die Allianzen zwischen den Thronbewerbern und den Bischöfen, wobei die Mainzer, Sächsische und Aachener Partei näher beleuchtet werden.12345678910111213141516
Schlüsselwörter
Kaiser Otto III., Thronvakanz 1002, Bischöfe, Thronbewerber, Heinrich IV. von Bayern, Ekkehard I. von Meißen, Hermann II. von Schwaben, Willigis von Mainz, Bernward von Hildesheim, Heribert von Köln, Ottonen, Königsherrschaft, sakrale Legitimierung, Reichsinstitutionen, Machtkampf, Parteienwahlkampf.
- Quote paper
- Matthias Wühle (Author), 2009, Der Streit der Thronbewerber von 1002 – ein Machtkampf der Bischöfe?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/124667