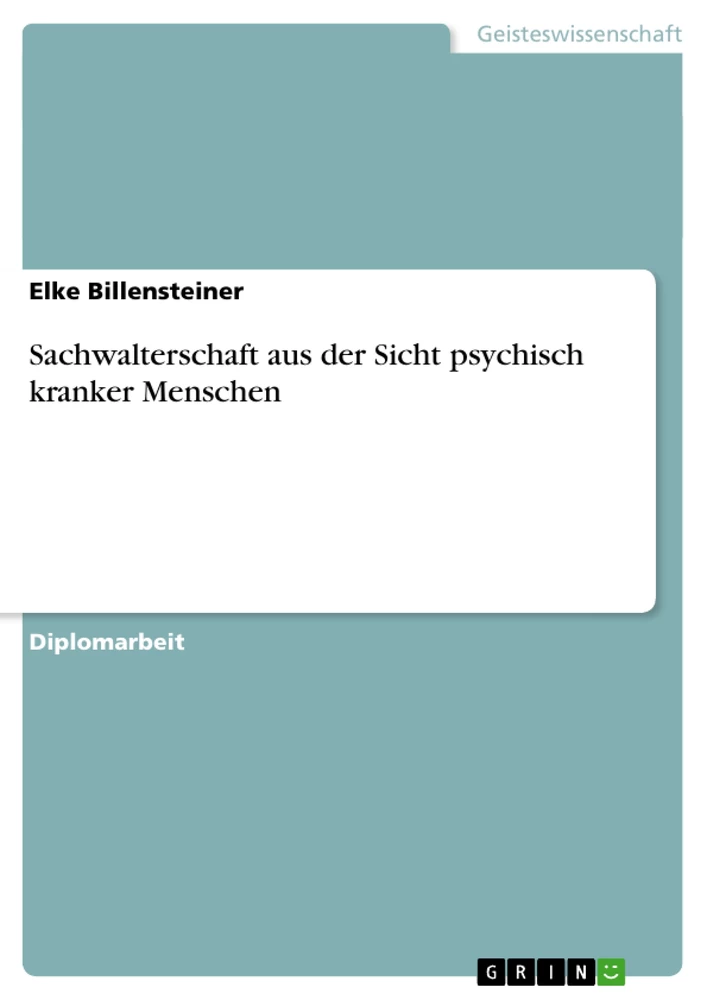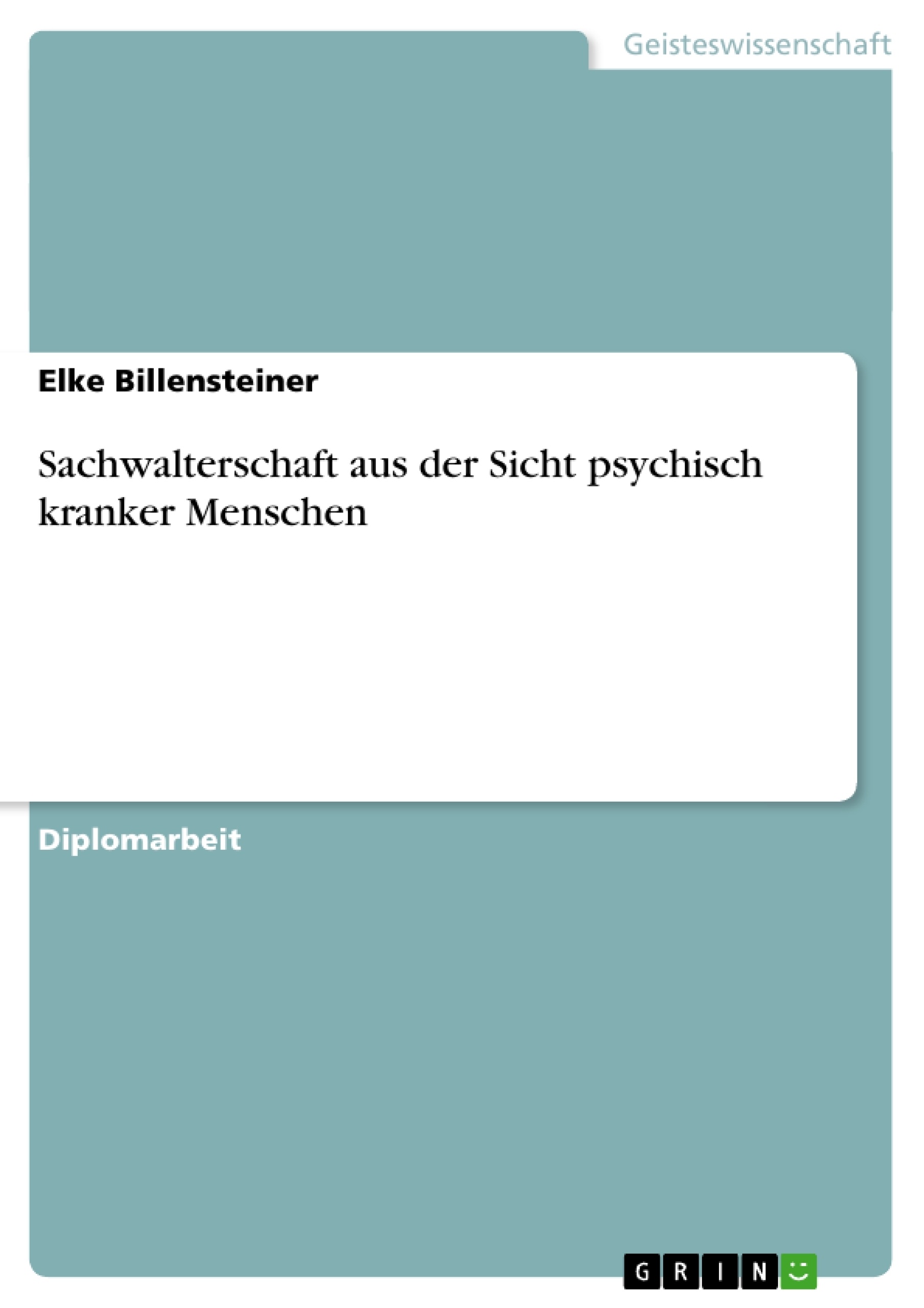Seit 1984 sind die Sachwalterschaftsverfahren kontinuierlich gestiegen. Dies bedeutet, dass immer mehr Menschen Rechtsschutz benötigen. Durch diese Zunahme ist die Sachwalterschaft unter Druck geraten und die Befürchtungen, dass die Qualität in der Betreuung abnimmt, sind berechtigt.
Gründe für die Zunahme der Sachwalterschaften sind u.a. die Zunahme der Zielgruppen und fehlende soziale Ressourcen.
Da es sich bei den KlientInnen in der Sachwalterschaft um unfreiwillige KlientInnen handelt, ist es häufig schwierig für den/die SachwalterIn, eine zufriedenstellende Zusammenarbeit zu erreichen.
Einerseits brauchen psychisch kranke Menschen häufig einen Sachwalter, da sie auf Grund der Krankheit nicht fähig sind, ihren Lebensalltag selbstständig zu gestalten. Andererseits bedeutet eine Sachwalterschaft für die betroffenen Personen Einschränkung, Abhängigkeit, aber auch Kontrolle und Stigmatisierung.
Das Ziel der Arbeit ist es, aufzuzeigen, was es braucht, damit betroffene Personen die Sachwalterschaft als nützlich erleben, bzw. was fehlt oder schief läuft, wenn die Sachwalterschaft (nur) als Einschränkung erlebt wird.
Mit Hilfe von narrativen Interviews mit betroffenen Personen wurden die aktuelle Situation, die Bedürfnisse, die Anforderungen an eine/n SachwalterIn, aber auch die Kritik an den/die SachwalterIn erhoben und in der Folge ausgewertet und interpretiert.
Ein wesentliches Ergebnis der Forschung ist, dass die Sachwalterschaft Beziehungsarbeit sein muss, damit sie funktioniert und als positiv erlebt wird.
Die Häufigkeit der Kontakte und das Engagement des/der SachwalterIn sind ausschlaggebend für eine gute Zusammenarbeit mit den betroffenen Personen.
Inhaltsverzeichnis
- I. EINLEITUNG
- II. ZUGRUNDELIEGENDE FORSCHUNGSFRAGE DIESER ARBEIT
- III. MOTIVATION UND ERKLÄRUNG DES FORSCHUNGSANLASSES
- IV. INHALTLICHER AUFBAU DER ARBEIT
- V. AUSGANGSSITUATION
- VI. MÖGLICHE GRÜNDE FÜR DEN EXPANSIVEN ANSTIEG
- VI.1. Zunahme an Rechtsgeschäften
- VI.2. Fehlende soziale Ressourcen
- VI.3. Veränderung des Wohlfahrtssystems
- VI.4. Zunahme der Zielgruppe
- VII. VORRAUSSETZUNGEN FÜR EINE SACHWALTERSCHAFT
- VIII. SACHWALTERSCHAFTSVERFAHREN (AUBSTRG IDF. AB 1.1.2005)
- IX. PSYCHISCHE ERKRANKUNGEN
- IX.1. Häufigkeit von psychischen Erkrankungen
- IX.2. Allgemeines
- X. PSYCHISCHE KRANKHEITEN, DIE HÄUFIG ZU EINER SACHWALTERSCHAFT FÜHREN
- X.1. Depression
- X.2. Manie
- X.3. Borderline Störung
- X.4. Schizophrenie
- X.5. Vermüllungssyndrom
- XI. EMPIRISCHER TEIL
- XI.1. Kontext der forschungsleitenden Frage
- XI.2. Forschungsleitende Frage
- XI.3. Methode zur Datenerhebung
- XI.4. Zielgruppe
- XI.5. Durchführung der Interviews
- XI.6. Auswertung des Datenmaterials
- XI.7. Kategorienbildung
- XI.8. Formulierung von 9 Kategorien
- XI.9. Auswertung und Interpretation der Interviews
- XI.9.a Unterschied in der Betreuung auf Grund des/der Sachwalterln
- XI.9.b Kontakt zum/r SachwalterIn
- XI.9.c Beziehung zum/zur Sachwalterln
- XI.9.d Wertschätzende Haltung und Respekt
- XI.9.e Macht bzw. Machtmissbrauch
- XI.9.f Transparenz und Information
- XI.9.g Anerkennung bzw. Förderung der Selbstbestimmung
- XI.9.h Einschränkung der Freiheitsrechte
- XI.9.i Engagement des/der Sachwalterin
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Erfahrungen psychisch kranker Menschen mit Sachwalterschaften. Das Ziel ist aufzuzeigen, unter welchen Bedingungen Betroffene die Sachwalterschaft als hilfreich erleben und welche Faktoren zu negativen Erfahrungen führen.
- Die Auswirkungen von Sachwalterschaften auf das Leben psychisch kranker Menschen
- Die Bedeutung der Beziehung zwischen Betroffenen und SachwalterIn
- Faktoren, die zu einer positiven oder negativen Wahrnehmung der Sachwalterschaft beitragen
- Die Rolle von Kommunikation und Transparenz im Sachwalterschaftsprozess
- Die Notwendigkeit von Ressourcen und Unterstützungssystemen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Sachwalterschaft und deren steigende Bedeutung ein. Es werden die Forschungsfrage und der methodische Ansatz erläutert. Die folgenden Kapitel beleuchten den Anstieg der Sachwalterschaften, mögliche Gründe hierfür (z.B. fehlende soziale Ressourcen), die rechtlichen Rahmenbedingungen und verschiedene psychische Erkrankungen, die häufig zu einer Sachwalterschaft führen. Der empirische Teil beschreibt die Methodik der narrativen Interviews und die Auswertung der Daten. Die Analyse konzentriert sich auf die Erfahrungen der Betroffenen und die Bedeutung der Beziehung zum/zur SachwalterIn. Hier werden Aspekte wie Kommunikation, Respekt, Machtverhältnisse und die Förderung der Selbstbestimmung untersucht.
Schlüsselwörter
Sachwalterschaft, psychische Erkrankung, narrative Interviews, Betroffene, Beziehungsarbeit, Selbstbestimmung, Ressourcen, Stigmatisierung, Qualität der Betreuung.
- Quote paper
- Mag.(FH) Elke Billensteiner (Author), 2007, Sachwalterschaft aus der Sicht psychisch kranker Menschen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/124615