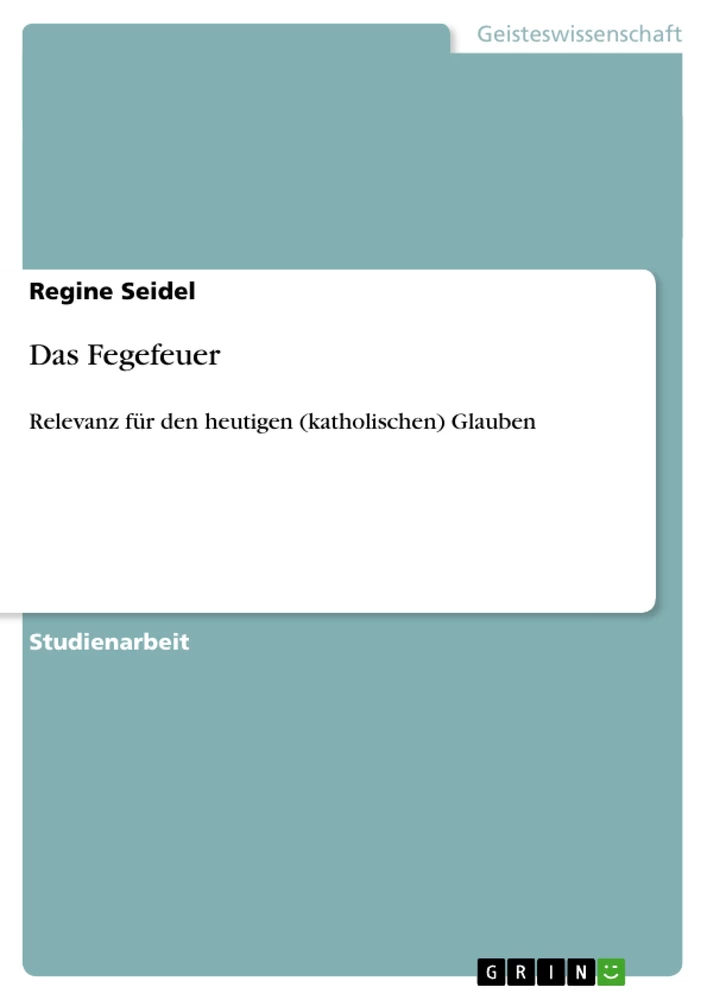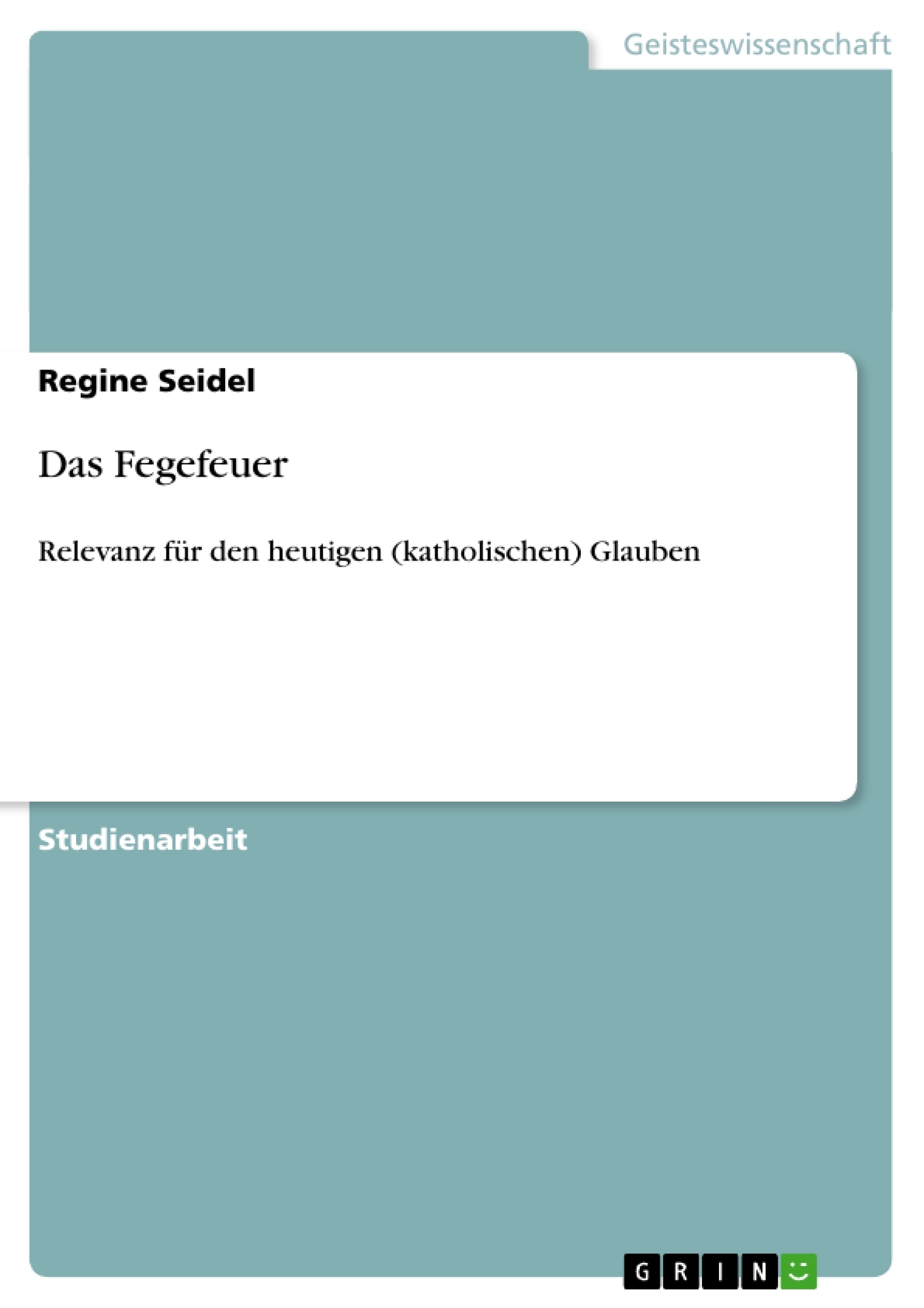Bei dem Begriff Fegefeuer dachte ich zunächst an Ablasshandel, üble Kirchendruckmittel und mittelalterlichen Katholizismus. Doch diese Assoziationen erschienen mir zu voreingenommen und einseitig. Also versuchte ich, möglichst vorurteilsfrei darüber nachzudenken, welchen Grund es geben konnte, dass sich Menschen eine Vorstellung wie die vom Fegefeuer erschufen.
Etwas psychologischer gedacht, kam mir die Angst vor der Endgültigkeit des Todes in den Sinn. In unserer heutigen Gesellschaft besteht ein starker Drang zur persönlichen Autonomie, der durch den Tod ein jähes Ende gesetzt wird. Dieser Umstand ist wohl auch ein Grund für die gegenwärtige Tabuisierung des Todes. Im Tode sind wir machtlos, und auch unreligiöse Menschen stehen am Ende ihres Lebens vor dem Problem, nichts mehr ändern oder nachholen zu können. In dieser Endgültigkeit liegt für mich die Verknüpfung zwischen den christlichen Vorstellungen vom Fegefeuer und meiner Gegenwart.
Daher lautet meine zu beantwortende Frage: Wie konnte sich eine für mich heute so abwegige Vorstellung eines Fegefeuers entwickeln und welche Relevanz hat sie heute noch für den (katholischen) Glauben?
In dieser Kurzarbeit möchte ich zuerst kurz den Begriff Fegefeuer definieren und nach biblischen Belegen für seine Existenz suchen. Anschließend möchte ich darlegen, woher die Vorstellung vom Fegefeuer stammt und wie sie sich im Laufe der Dogmengeschichte entwickelt hat. Im Anschluss daran möchte ich ergründen, ob und wie die gegenwärtige katholische Theologie auf die Vorstellung des Fegefeuers Bezug nimmt. Abschließend werde ich die Ansichten der neueren katholischen Theologie aufgreifen, um diese mit meiner lutherisch und hoffnungstheologisch geprägten Auffassung von den letzten Dingen zu vergleichen. Aus diesem Vergleich heraus mag sich die Antwort auf die Frage ergeben, welche Relevanz der Glaube an das Fegefeuer heute noch haben kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung und Fragestellung
- 2. Definition des Begriffs „Fegefeuer“
- 3. Biblische Grundlagen des Fegefeuerglaubens?
- 4. Woher stammt der Glaube an das Fegefeuer?
- 4.1. Dogmengeschichtliche Entwicklung des Fegefeuers
- 4.2. Zusammenfassung und Resumée
- 5. Die katholische Fegefeuerlehre der Gegenwart
- 6. Persönliches Fazit – Würdigung und Kritik der Fegefeuerlehre
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Kurzarbeit untersucht die Entstehung und die heutige Relevanz des Glaubens an das Fegefeuer im katholischen Kontext. Die Arbeit zielt darauf ab, die Entwicklung der Fegefeuerlehre nachzuvollziehen und diese mit einer lutherisch-hoffnungstheologischen Perspektive zu vergleichen.
- Definition und biblische Grundlagen des Fegefeuerglaubens
- Dogmengeschichtliche Entwicklung des Fegefeuerkonzepts
- Die katholische Fegefeuerlehre in der Gegenwart
- Vergleich der katholischen Fegefeuerlehre mit einer lutherischen Perspektive
- Relevanz des Fegefeuerglaubens in der heutigen Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung und Fragestellung: Die Einleitung beschreibt die anfängliche Assoziation des Autors mit dem Begriff Fegefeuer, verbunden mit Ablasshandel und mittelalterlichem Katholizismus. Diese Vorurteile werden jedoch als einseitig zurückgewiesen. Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie konnte sich die Vorstellung vom Fegefeuer entwickeln und welche Relevanz hat sie heute noch? Die Arbeit skizziert den methodischen Ansatz: Definition des Begriffs, Suche nach biblischen Belegen, Untersuchung der dogmengeschichtlichen Entwicklung, Analyse der gegenwärtigen katholischen Theologie und abschließender Vergleich mit einer lutherischen Perspektive.
2. Definition des Begriffs „Fegefeuer“: Dieses Kapitel definiert das Fegefeuer ("Purgatorium") als einen Zustand der Läuterung nach dem Tod innerhalb der katholischen Glaubenslehre. Es basiert auf der Vorstellung eines Gerichts nach dem Tod, bei dem Seelen noch lässliche Sünden oder zeitliche Sündenstraffolgen zu überwinden haben, bevor sie Gottes Angesicht schauen können. Die Bedeutung der Fürbitte der Gläubigen und die Verbindung zur Ablasslehre werden hervorgehoben.
3. Biblische Grundlagen des Fegefeuerglaubens?: Das Kapitel räumt ein, dass es keine eindeutigen biblischen Belege für das Fegefeuer gibt. Es werden jedoch verschiedene Bibelstellen (2. Makk 12,40-46; Lk 16,24; Mt 5,25-26; 1. Kor 3,11-15) diskutiert, die in der Vergangenheit zur Begründung der Fegefeuerlehre herangezogen wurden. Die heutige historisch-kritische Exegese lässt jedoch keine eindeutige Deutung dieser Stellen im Sinne des Fegefeuers zu.
4. Woher stammt der Glaube an das Fegefeuer?: Kapitel 4 erörtert die religionswissenschaftlichen Ursprünge des Fegefeuerglaubens, die in uralten Motiven (Feuer, Finsternis, Marter, Prüfung) und ägyptischen Jenseitsvorstellungen liegen. Es wird betont, dass die christliche Eschatologie Elemente aus früheren Religionen übernahm und sich im Kontext der jesuanischen Verkündigung des Jüngsten Gerichts und der Entwicklung der frühen christlichen Gemeinde herausbildete. Die Bedeutung der liturgischen Praxis (Fürbitten, Totenmessen) und die Auseinandersetzung mit der Gnosis werden als wichtige Faktoren in der Entstehung der Fegefeuerlehre hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Fegefeuer, Purgatorium, katholische Dogmatik, Dogmengeschichte, Eschatologie, Jüngstes Gericht, biblische Exegese, Ablass, Letzte Dinge, Lutherische Theologie, Hoffnungstheologie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Kurzarbeit: "Der Glaube an das Fegefeuer"
Was ist der zentrale Gegenstand der Kurzarbeit?
Die Kurzarbeit untersucht die Entstehung und heutige Relevanz des Glaubens an das Fegefeuer im katholischen Kontext. Sie verfolgt die Entwicklung der Fegefeuerlehre und vergleicht diese mit einer lutherisch-hoffnungstheologischen Perspektive.
Welche Fragen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der Definition des Begriffs „Fegefeuer“, der Suche nach biblischen Belegen, der dogmengeschichtlichen Entwicklung des Konzepts, der Analyse der gegenwärtigen katholischen Fegefeuerlehre und einem Vergleich mit der lutherischen Theologie. Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie konnte sich die Vorstellung vom Fegefeuer entwickeln und welche Relevanz hat sie heute noch?
Welche Kapitel umfasst die Kurzarbeit und worum geht es in ihnen?
Die Kurzarbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung und Fragestellung) legt die Forschungsfrage und den methodischen Ansatz dar. Kapitel 2 (Definition des Begriffs „Fegefeuer“) definiert das Fegefeuer innerhalb der katholischen Lehre. Kapitel 3 (Biblische Grundlagen des Fegefeuerglaubens?) untersucht die biblischen Belege (oder deren Fehlen) für das Fegefeuer. Kapitel 4 (Woher stammt der Glaube an das Fegefeuer?) erörtert die religionswissenschaftlichen Ursprünge und die dogmengeschichtliche Entwicklung. Kapitel 5 (Die katholische Fegefeuerlehre der Gegenwart) analysiert die heutige katholische Lehre. Kapitel 6 (Persönliches Fazit – Würdigung und Kritik der Fegefeuerlehre) bietet ein persönliches Fazit und einen Vergleich mit einer lutherischen Perspektive.
Gibt es eindeutige biblische Belege für das Fegefeuer?
Nein, die Kurzarbeit stellt fest, dass es keine eindeutigen biblischen Belege für das Fegefeuer gibt. Verschiedene Bibelstellen werden zwar diskutiert, aber die heutige historisch-kritische Exegese lässt keine eindeutige Deutung dieser Stellen im Sinne des Fegefeuers zu.
Welche religionswissenschaftlichen Ursprünge werden für den Glauben an das Fegefeuer genannt?
Die Arbeit verweist auf uralte Motive wie Feuer, Finsternis, Marter und Prüfung sowie auf ägyptische Jenseitsvorstellungen als mögliche Ursprünge. Die christliche Eschatologie übernahm Elemente aus früheren Religionen und entwickelte sich im Kontext der jesuanischen Verkündigung und der frühen christlichen Gemeinde.
Wie wird die katholische Fegefeuerlehre mit einer lutherischen Perspektive verglichen?
Dieser Vergleich ist Teil des Schlusskapitels und wird in der Zusammenfassung der Kapitel nicht explizit beschrieben. Die Arbeit zielt jedoch darauf ab, die katholische Fegefeuerlehre mit einer lutherisch-hoffnungstheologischen Perspektive zu kontrastieren und zu bewerten.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Kurzarbeit?
Schlüsselwörter sind: Fegefeuer, Purgatorium, katholische Dogmatik, Dogmengeschichte, Eschatologie, Jüngstes Gericht, biblische Exegese, Ablass, Letzte Dinge, Lutherische Theologie, Hoffnungstheologie.
- Quote paper
- Regine Seidel (Author), 2004, Das Fegefeuer, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/124573