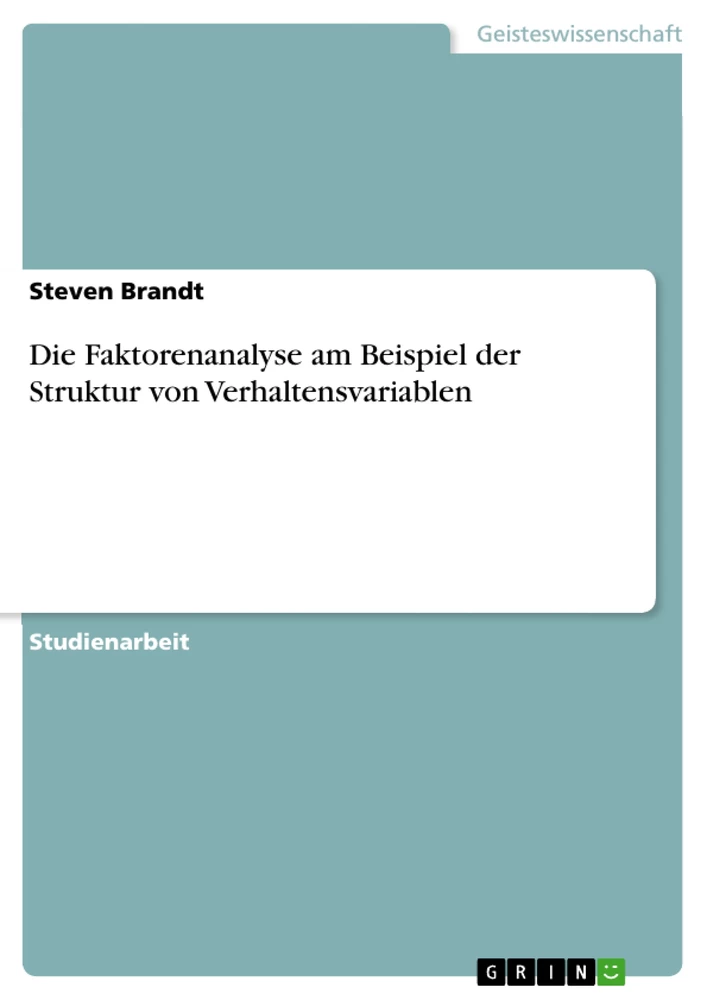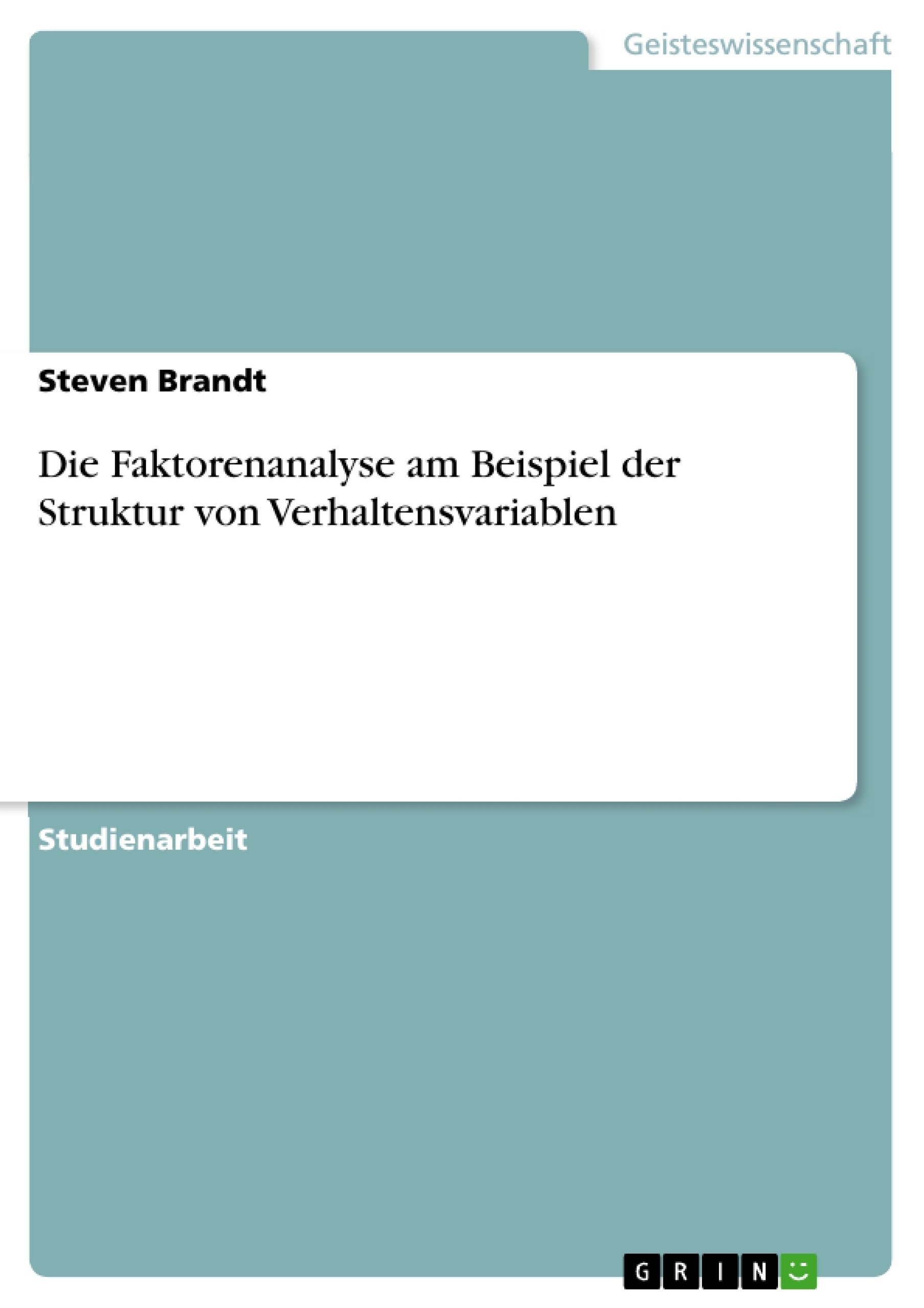Die Phase des wirtschaftlichen Aufschwungs und relativer politischer Stabilität der europäischen und nordamerikanischen Staaten nach dem 2. Weltkrieg und die damit einhergehende relative materielle Sicherheit der dort lebenden Menschen führte nach Inglehart (1997) zu einem Wandel der Werte, bei dem materielle Bedürfnisse aufgrund ihrer ständigen Möglichkeit zur Befriedigung um sog. postmaterialistische Bedürfnisse erweitert werden. Seine Mangelhypothese besagt, dass sich die Prioritäten eines Individuums nach seiner sozioökonomischen Umwelt richten und knappe Dinge subjektiv höher eingeschätzt werden, wobei hier die Befriedigung affektiver Bedürfnisse primäres Ziel von Lebewesen ist. Der nach dem Krieg erreichte Wohlstand führte nach Inglehart folglich zu einer Höherbewertung immaterieller Aspekte des Lebens. Eine hohe Lebensqualität und Selbstverwirklichung werden bspw. zu zentralen Werten. Dies hat auch Einfluss auf die politische Partizipation der Bevölkerung. Während sich die politische Partizipation, sowohl empirisch als auch im Verständnis der sog. realistischen Demokratietheorie und der Elitetheorie aufgrund geringen politischen Wissens und Engagements und eines defizitären Demokratie- und Politikverständnisses der Bürger bis in die 60er Jahre auf die Beteiligung an Wahlen und auf die Zurkenntnisnahme politischer Ereignisse aus den Massenmedien beschränkte, sah sich die junge Bildungselite dieser Zeit mit den ökonomischen Zielen der Elterngeneration nicht mehr engagiert verbunden und formulierte eigene Vorstellungen von Politik und Gesellschaft, deren Verwirklichung andere Formen der Partizipation bedurfte. (Kaase 1997, Westle 1992)
Kaase und Barnes formulierten 1979 eine Unterscheidung in konventionelle, also legitime und verfasste, und unkonventionelle, also institutionell nicht verfasste Möglichkeiten der politischen Partizipation, wobei der reine Akt des Wählens aufgrund seiner hohen Institutionalisiertheit keiner der beiden Kategorien zugeordnet wurde (Kaase 1997). Aufgrund der Ungenauigkeit dieser eindimensionalen Unterscheidung die weitere Unterscheidungen im Legalitätsstatus nicht zulässt, wurden die Modelle politischer Partizipation erweitert, so dass Uehlinger (1988) mit Hilfe empirischer Studien und den Analysemethoden der hierarchischen Clusteranalyse und multidimensionalen Skalierung ein komplexeres Modell des Partizipationsraumes vorschlug.
Uehlinger unterschied Typen politischer Partizipation: [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Faktorenanalyse - das allgemeine Modell
- 2.1 Die Faktorenanlyse im Kanon der multivariaten Verfahren
- 2.2 Die Logik der Faktorenanalyse anhand eines einführenden Beispiels
- 2.3 Das Fundamentaltheorem der Faktorenanalyse
- 2.4 Das Ablaufmodell der Faktorenanalyse
- 3. Einführung des Beispiels
- 4. Variablenauswahl
- 4.1 Gütetest der Variablen in der Untersuchung
- 5. Das Kommunalitätenproblem
- 5.1 Bestimmung der Kommunalitäten im Beispiel
- 6. Das Faktorenproblem
- 6.1 Extraktionsverfahren
- 6.2 Bestimmung der Anzahl der Faktoren
- 6.3 Faktorenextraktion im Beispiel
- 7. Das Rotationsproblem
- 7.1 Rotation der Faktoren im Beispiel
- 8. Schätzung der Faktorwerte
- 8.1 Graphische Darstellung der Faktoren
- 9. Inhaltliche Interpretation der Faktoren
- 10. Faktorenanalyse nichtmetrischer Daten
- 11. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist es, mithilfe der Faktorenanalyse die Struktur des Partizipationsverhaltens von Personen aufzudecken. Die Studie untersucht dabei die Beziehung zwischen der sozioökonomischen Umwelt, dem Wertewandel und den verschiedenen Formen der politischen Partizipation.
- Die Entwicklung des Partizipationsverständnisses von konventionellen zu unkonventionellen Formen
- Der Einfluss von sozioökonomischen Faktoren auf das Partizipationsverhalten
- Die Anwendung der Faktorenanalyse als Instrument zur Erkennung von Verhaltensstrukturen
- Die Unterscheidung zwischen konventioneller und unkonventioneller politischer Partizipation
- Die Untersuchung des Partizipationsraums und seine Dimensionen
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung gibt einen Überblick über die Entwicklung des Partizipationsverständnisses und die Bedeutung des Wertewandels nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie stellt das Forschungsfeld der Faktorenanalyse und die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit vor.
- Kapitel 2 erläutert die Grundlagen der Faktorenanalyse als multivariates Verfahren. Es wird die Logik der Faktorenanalyse anhand eines Beispiels erklärt, das Fundamentaltheorem der Faktorenanalyse vorgestellt und ein Ablaufmodell der Faktorenanalyse dargestellt.
- Kapitel 3 beschreibt den Datensatz, der für die Analyse verwendet wird: der Allbus-Datensatz aus dem Jahre 1998.
- Kapitel 4 befasst sich mit der Auswahl der Variablen für die Faktorenanalyse und deren Gütetest.
- Kapitel 5 behandelt das Kommunalitätenproblem, welches bei der Faktorenanalyse auftritt, und zeigt die Berechnung der Kommunalitäten im Beispiel.
- Kapitel 6 widmet sich dem Faktorenproblem und erläutert verschiedene Extraktionsverfahren, die zur Bestimmung der Anzahl der Faktoren eingesetzt werden. Es präsentiert die Faktorenextraktion im Beispiel.
- Kapitel 7 erklärt das Rotationsproblem und demonstriert die Rotation der Faktoren im Beispiel.
- Kapitel 8 beschreibt die Schätzung der Faktorwerte und die graphische Darstellung der Faktoren.
- Kapitel 9 befasst sich mit der inhaltlichen Interpretation der Faktoren.
- Kapitel 10 behandelt die Faktorenanalyse nichtmetrischer Daten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Faktorenanalyse als Methode zur Analyse von Verhaltensdaten. Wichtige Schlüsselwörter sind: politische Partizipation, Wertewandel, Mangelhypothese, konventionelle und unkonventionelle Partizipation, Faktorenanalyse, multivariates Verfahren, Datensatz, Allbus.
- Citation du texte
- Steven Brandt (Auteur), 2001, Die Faktorenanalyse am Beispiel der Struktur von Verhaltensvariablen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/12454