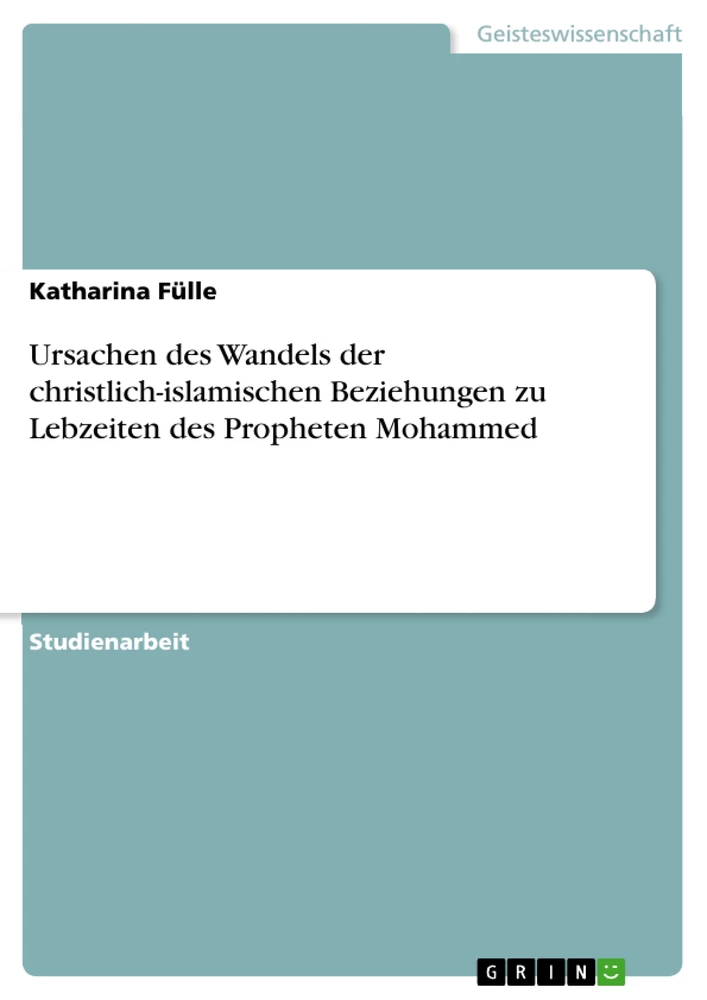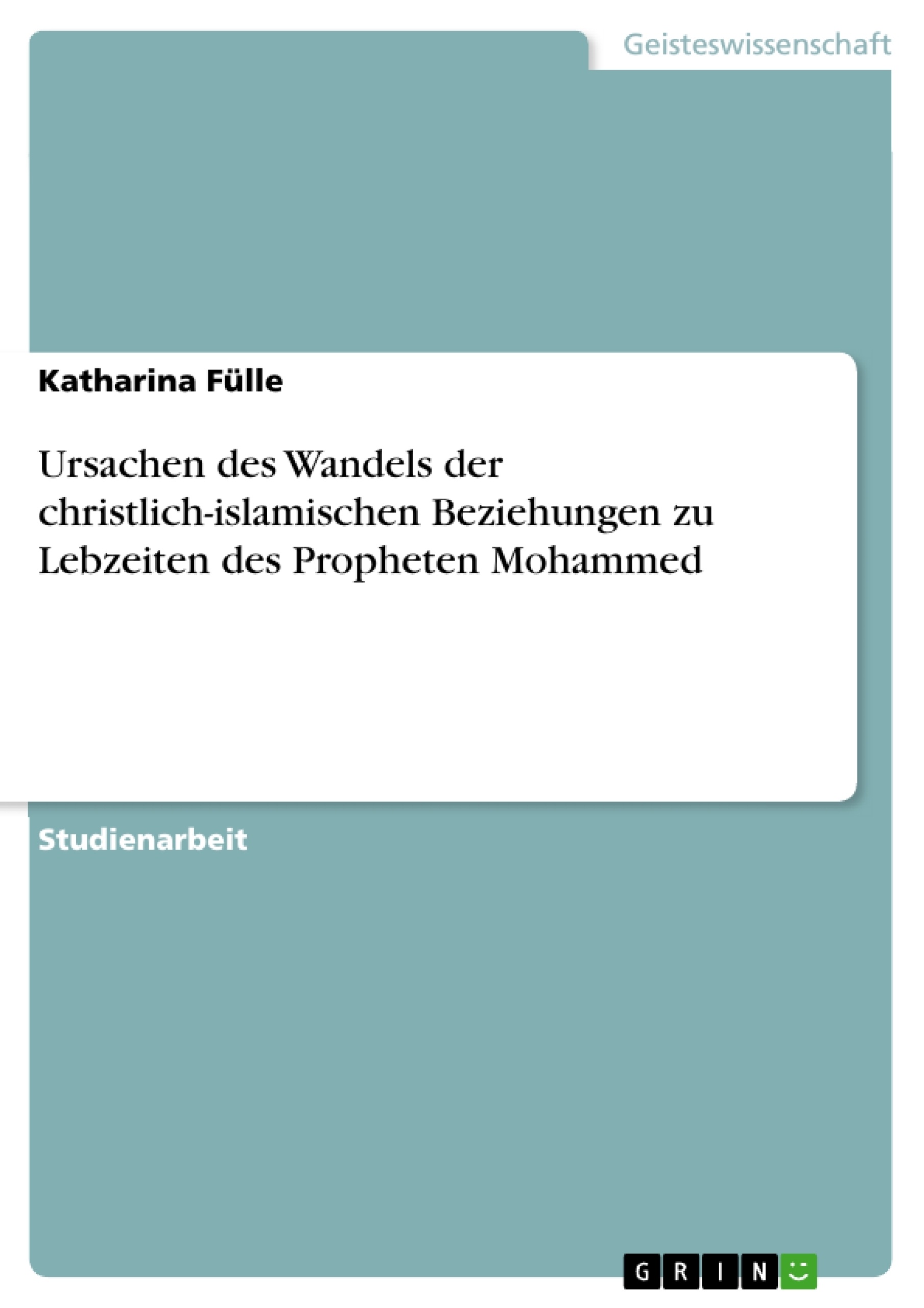Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Wandel der christlich-islamischen Beziehungen zu
Lebzeiten des Propheten Mohammed (ca.570-632 n. Chr.) und der Forschung nach deren
Ursachen. Da sich die Geschichte des Islam zu Lebzeiten von
Mohammed an seinen Offenbarungen und Handlungsweisen orientiert, könnte es im Titel
auch heißen „Ursachen des Wandels der Beziehungen zwischen Mohammed und dem Christentum
zu seinen Lebzeiten“. Trotzdem sich diese Arbeit chronologisch nach den Etappen in
Mohammeds Leben ausrichtet und vor allem nach den Ursachen im Wandel seines Verhältnisses
zum Christentum sucht, legt die Handlungsweise und Gesetzgebung des Propheten
Mohammed den Grundstein für die christlich-islamischen Beziehungen allgemein. Dies sollte
auch im Titel zum Ausdruck kommen. Mit Hilfe einer chronologischen Darstellung der Entwicklung
der christlich-islamischen Kontakte in Etappen wird der Phasenverlauf von einem
friedlich-toleranten Neben- und Miteinander beider Religionsgemeinschaften hin zu dem
feindseligen Klima gezeigt, deren Ausläufer das Verhältnis auch heute noch prägen.
Um die Ursachen des Wandels ergründen zu können, kommt man nicht umhin, den Wandel
selbst zu beschreiben. Das zweite Kapitel beginnt daher in der vorislamischen Zeit und beschäftigt
sich mit der Klärung der religiösen Umgebung in die
Mohammed hinein geboren wurde und die ihn zweifellos in seinen späteren Überzeugungen
beeinflusst hat. Es beschreibt die Voraussetzungen und Bedingungen unter denen sich die
christlich-islamischen Beziehungen entwickelten.
Mit der Entwicklung von Mohammeds Geburt bis zur hira und der Auswanderung der muslimischen
Gemeinde aus Mekka nach Medina, beschreibt das dritte Kapitel den Höhepunkt
der friedlich-wohlmeinenden Beziehungen zu Christen. Danach werden die beiden letzten Etappen der schlechter werdenden christlich-islamischen Beziehungen dargestellt (Kapitel 4).
Erst ab diesem Zeitpunkt vollzog sich der Wandel dessen Ursachen diese Arbeit untersuchen
möchte. Durch die Themenwahl der islamischen Frühgeschichte ergibt sich, was die wissenschaftliche
Quellenlage betrifft, eine entscheidende Schwierigkeit. Die Überlieferung von Mohammeds
Biografie (sira) und seines Umfeldes muss mangels materieller Zeugnisse und arabischer Inschriften
trotz wissenschaftlicher Skrupel aus literarischen Quellen entnommen werden die
Jahrzehnte und Jahrhunderte nach dem historischen Geschehen von gläubigen Muslimen in
arabischer Sprache festgehalten oder überarbeitet worden sind.[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Glaubenswelt der arabischen Polytheisten in Mekka um das sechste Jd. n. Chr. und ihre Beziehungen zum Christentum
- Mohammeds Verhältnis zu Christen vor der hiğra
- Erste Kontakte
- Zeit der Sendung
- Auswanderungen nach Abessinien
- Die hiğra: Der Wendepunkt der muslimisch-christlichen Beziehungen
- Die Verurteilung der Christen
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Wandel der christlich-islamischen Beziehungen während des Lebens des Propheten Mohammed (ca. 570-632 n. Chr.) und analysiert die Ursachen dieses Wandels. Die Arbeit verfolgt einen chronologischen Ansatz, der Mohammeds Beziehung zum Christentum in verschiedenen Phasen seines Lebens beleuchtet. Der Fokus liegt auf der Entwicklung des Verhältnisses von friedlicher Koexistenz zu Feindseligkeit und den zugrundeliegenden Faktoren.
- Die religiöse Landschaft Mekkas vor der islamischen Offenbarung und deren Einfluss auf Mohammed.
- Die Entwicklung von Mohammeds Beziehung zu Christen vor der Hidschra.
- Die Rolle der Hidschra als Wendepunkt in den christlich-islamischen Beziehungen.
- Die Ursachen des Wandels in den Beziehungen zwischen Mohammed und Christen.
- Die Bedeutung der historischen Quellenlage und deren Herausforderungen für die Forschung.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Diese Einleitung beschreibt die Zielsetzung der Arbeit: die Untersuchung des Wandels der christlich-islamischen Beziehungen während Mohammeds Lebens und die Analyse der Ursachen dieses Wandels. Sie betont die Bedeutung der chronologischen Darstellung und die Herausforderungen, die sich aus der Quellenlage ergeben, insbesondere die Abhängigkeit von literarischen Quellen, die Jahrzehnte nach den Ereignissen entstanden sind. Die Relevanz der Arbeit wird im Kontext des heutigen Interesses an einem christlich-islamischen Dialog begründet.
Glaubenswelt der arabischen Polytheisten in Mekka um das sechste Jd. n. Chr. und ihre Beziehungen zum Christentum: Dieses Kapitel beschreibt das religiöse Klima Mekkas vor der islamischen Offenbarung, das von polytheistischen Glauben geprägt war, mit Einflüssen aus dem Judentum, Zoroastrismus, dem Glauben der Ḥunafā', den Mandäern und dem Christentum. Es diskutiert die unterschiedlichen christlichen Gruppen (Nestorianer, Monophysiten) und ihre Präsenz auf der Arabischen Halbinsel. Die Autorin hinterfragt die These von Schirrmacher, dass christliche Gemeinden in Mekka existierten, und diskutiert alternative Quellen und Perspektiven zum Kontakt der Mekkaner mit dem Christentum.
Mohammeds Verhältnis zu Christen vor der hiğra: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung von Mohammeds Beziehung zu Christen in den Phasen vor der Hidschra: von ersten Kontakten über die Zeit der Sendung bis hin zu Auswanderungen nach Abessinien. Es hebt die Bedeutung friedlicher Beziehungen hervor, welche durch die Unterscheidung zwischen verschiedenen christlichen Gruppen, die Mohammed möglicherweise nicht bewusst war, kontextualisiert werden. Die frühe, relativ friedliche Koexistenz wird als zentraler Aspekt dieser Phase dargestellt.
Die hiğra: Der Wendepunkt der muslimisch-christlichen Beziehungen: Dieses Kapitel beschreibt die Hidschra als einen Wendepunkt, der zu einer Veränderung im Verhältnis zwischen Muslimen und Christen führte. Es analysiert die Faktoren, die zu dieser Veränderung beitrugen. Diese Veränderung wird als ein komplexer Prozess mit mehreren Ursachen gesehen, welche mit dem weiteren Verlauf der Geschichte der islamischen Religion eng verwoben sind.
Schlüsselwörter
Christlich-islamische Beziehungen, Prophet Mohammed, Hidschra, Polytheismus, Mekka, Christentum, Monophysiten, Nestorianer, Quellenkritik, ḥadīt, sīra, interreligiöser Dialog.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Wandel der christlich-islamischen Beziehungen während des Lebens des Propheten Mohammed
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Wandel der christlich-islamischen Beziehungen während des Lebens des Propheten Mohammed (ca. 570-632 n. Chr.) und analysiert die Ursachen dieses Wandels. Der Fokus liegt auf der Entwicklung des Verhältnisses von friedlicher Koexistenz zu Feindseligkeit.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verfolgt einen chronologischen Ansatz, der Mohammeds Beziehung zum Christentum in verschiedenen Phasen seines Lebens beleuchtet. Die Bedeutung der historischen Quellenlage und deren Herausforderungen für die Forschung wird ebenfalls berücksichtigt.
Welche Phasen der christlich-islamischen Beziehungen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Phasen: die religiöse Landschaft Mekkas vor der islamischen Offenbarung, Mohammeds Beziehung zu Christen vor der Hidschra (erste Kontakte, Zeit der Sendung, Auswanderungen nach Abessinien), und die Hidschra als Wendepunkt in den christlich-islamischen Beziehungen.
Wie wird die religiöse Landschaft Mekkas vor der islamischen Offenbarung beschrieben?
Das Kapitel beschreibt das religiöse Klima Mekkas als polytheistisch, mit Einflüssen aus dem Judentum, Zoroastrismus, dem Glauben der Ḥunafā', den Mandäern und dem Christentum. Es diskutiert verschiedene christliche Gruppen (Nestorianer, Monophysiten) und ihre Präsenz auf der Arabischen Halbinsel und hinterfragt Thesen über christliche Gemeinden in Mekka.
Wie wird Mohammeds Verhältnis zu Christen vor der Hidschra dargestellt?
Diese Phase wird durch relativ friedliche Beziehungen gekennzeichnet, die jedoch durch die Unterscheidung verschiedener christlicher Gruppen (möglicherweise unbewusst von Mohammed) kontextualisiert werden müssen. Die frühe Koexistenz wird als zentraler Aspekt dieser Phase dargestellt.
Welche Bedeutung hat die Hidschra für die christlich-islamischen Beziehungen?
Die Hidschra wird als Wendepunkt dargestellt, der zu einer Veränderung im Verhältnis zwischen Muslimen und Christen führte. Die Arbeit analysiert die komplexen Faktoren, die zu diesem Wandel beitrugen, und betont den komplexen Prozess mit mehreren Ursachen, die mit dem weiteren Verlauf der Geschichte der islamischen Religion eng verwoben sind.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Christlich-islamische Beziehungen, Prophet Mohammed, Hidschra, Polytheismus, Mekka, Christentum, Monophysiten, Nestorianer, Quellenkritik, ḥadīt, sīra, interreligiöser Dialog.
Welche Herausforderungen ergeben sich aus der Quellenlage?
Die Arbeit betont die Herausforderungen, die sich aus der Quellenlage ergeben, insbesondere die Abhängigkeit von literarischen Quellen, die Jahrzehnte nach den Ereignissen entstanden sind. Die Bedeutung der Quellenkritik wird hervorgehoben.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, den Wandel der christlich-islamischen Beziehungen während Mohammeds Lebens zu untersuchen und die Ursachen dieses Wandels zu analysieren. Die Relevanz der Arbeit wird im Kontext des heutigen Interesses an einem christlich-islamischen Dialog begründet.
- Quote paper
- Katharina Fülle (Author), 2008, Ursachen des Wandels der christlich-islamischen Beziehungen zu Lebzeiten des Propheten Mohammed, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/124539