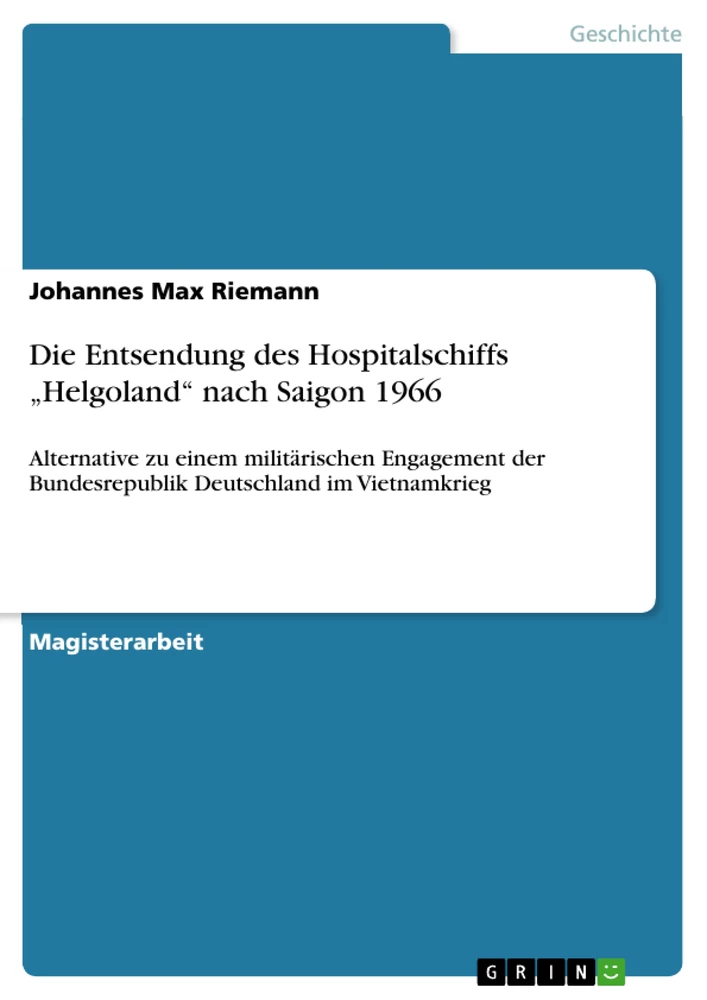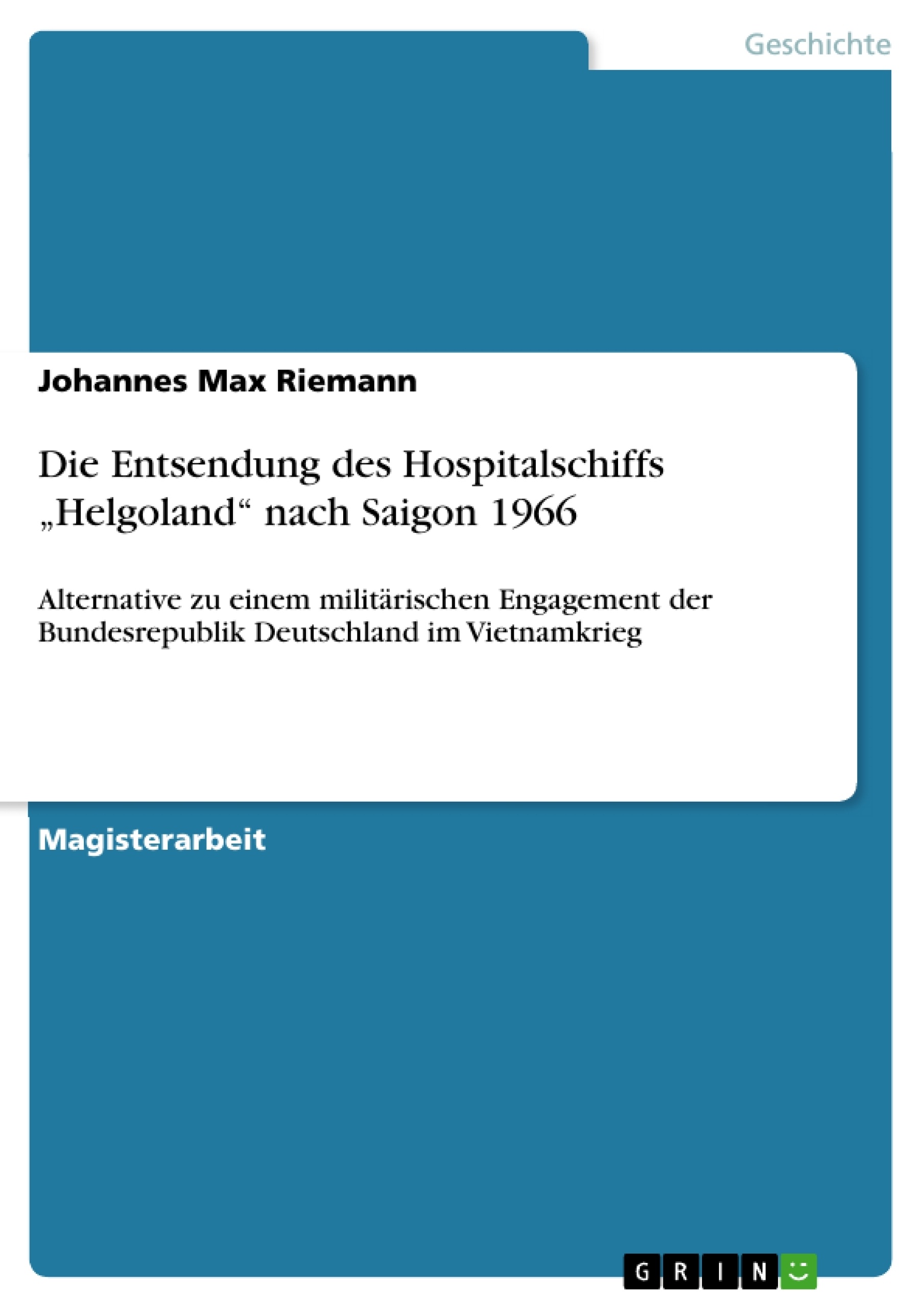Von 1966 bis 1972 lag das deutsche Hospitalschiff „Helgoland“ in den südvietnamesischen Städten Saigon und Da Nang vor Anker. Das „schwimmende Krankenhaus“, dessen Standard das Niveau vietnamesischer Kliniken um ein Vielfaches übertraf, war zwar nicht die einzige Form humanitärer Hilfe aus Westdeutschland für die Menschen in der Republik Vietnam, aber sicherlich die „populärste“: Kein anderes Hilfsprojekt der Deutschen im Ausland hatte national wie international eine vergleichbare Resonanz gefunden wie das Hospitalschiff.
In den vergangenen Monaten konnte ich bislang nicht zugängliche Dokumente einsehen und mit Zeitzeugen sprechen. Dabei stellte ich fest, dass die Thematik nicht nur bislang wissenschaftlich unerforscht geblieben, sondern auch fast vollständig aus dem Bewusstsein der deutschen Öffentlichkeit verschwunden ist. Selbst jene Menschen, welche die Zeit des Vietnamkriegs bewusst miterlebten, haben kaum noch Erinnerungen daran. In der jüngeren Generation ist der Einsatz der „Helgoland“ nach meiner Einschätzung so gut wie überhaupt nicht bekannt.
Vom Einsatz des Hospitalschiffs erfuhr ich erstmals im Sommer 1998 durch eine Fernsehdokumentation mit dem Titel „Nur leichte Kämpfe in Da Nang“. Im darauffolgenden Wintersemester bot sich mir die Gelegenheit, zur Vorbereitung eines Kurzreferats in einem Seminar an der Universität Düsseldorf über die Geschichte des Vietnamkriegs erste Nachforschungen zur Thematik durchzuführen.
Durch diese Recherche wurde ich in meiner Absicht bestärkt, die „Helgoland“-Mission im Rahmen meiner Magisterarbeit grundlegender zu erforschen und die aufgrund der gesetzlichen Sperrfrist bis vor kurzem nicht freigegebenen Quellen in den Archiven des Bundes sowie die entsprechenden Bestände des Deutschen Roten Kreuzes auszuwerten.
Es ist mein Anliegen, durch die Erforschung der Mission unter den Gesichtspunkten der Geschichtswissenschaft mit meiner Arbeit eine erste zusammenhängende Untersuchung zur Thematik vorzulegen und somit dazu beizutragen, das wissenschaftliche Interesse auf den Einsatz der „Helgoland“ und seine Hintergründe zu lenken.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Forschungsstand, Fragestellung und Methodik
- 1.2 Aufbau der Arbeit
- 1.3 Quellenlage
- 2. Ein deutscher Militäreinsatz im Vietnamkrieg?
- 2.1 Rahmenbedingungen: Neuorientierung der westdeutschen Außenpolitik 1963 bis 1966 – Kanzler Erhard und die „atlantische Option“
- 2.2 Der Staatsbesuch Erhards bei US-Präsident Johnson in Washington im Dezember 1965
- 2.3 Reaktionen auf die Bitte der Amerikaner um einen deutschen Militärbeitrag in Indochina
- 2.4 Rechtliche Hindernisse für ein militärisches Engagement der Bundesrepublik in Vietnam
- 3. Politische Alternative: die „Helgoland“-Mission
- 3.1 Humanitäres Engagement statt Militäreinsatz: Entscheidung für das Hospitalschiff „Helgoland“
- 3.2 Die Vorbereitung der Mission durch die Bundesregierung
- 3.3 Diskussion des „Helgoland“-Einsatzes im Plenum und in den Gremien des Deutschen Bundestages
- 3.4 Reaktionen in der Öffentlichkeit
- 3.5 Der Beginn des Einsatzes im August 1966
- 3.6 Exkurs: Medizinische Versorgung in der Republik Vietnam
- 4. Rechtliche Grundlagen für den „Helgoland“-Einsatz
- 4.1 Sicherheit für Schiff, Personal und Patienten: der Schutz der Mission durch die Genfer Konventionen
- 4.2 Der völkerrechtliche Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Südvietnam
- 4.3 Der Kooperationsvertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Deutschen Roten Kreuz
- 5. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entsendung des deutschen Hospitalschiffs „Helgoland“ nach Saigon im Jahr 1966 als humanitäre Alternative zu einem militärischen Engagement der Bundesrepublik Deutschland im Vietnamkrieg. Sie analysiert die politischen, rechtlichen und öffentlichen Reaktionen auf diese Entscheidung und beleuchtet den Kontext der westdeutschen Außenpolitik der 1960er Jahre.
- Die Rolle der Bundesrepublik Deutschland im Vietnamkonflikt
- Die Entscheidung für humanitäre Hilfe statt militärischer Intervention
- Die rechtlichen Grundlagen des „Helgoland“-Einsatzes
- Die öffentliche Wahrnehmung und die mediale Berichterstattung
- Der Vergleich zwischen humanitärer Hilfe und militärischem Engagement im Kontext des Kalten Krieges
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein, beschreibt den Forschungsstand, die Fragestellung und die Methodik der Arbeit. Es erläutert die Bedeutung der „Helgoland“-Mission im Kontext der deutschen Außenpolitik während des Vietnamkriegs und hebt die bis dato fehlende wissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesem Thema hervor. Die Quellenlage wird ebenfalls detailliert dargestellt.
2. Ein deutscher Militäreinsatz im Vietnamkrieg?: Dieses Kapitel untersucht die politischen Überlegungen innerhalb der Bundesregierung bezüglich eines möglichen militärischen Engagements im Vietnamkrieg. Es analysiert die Rahmenbedingungen der westdeutschen Außenpolitik unter Kanzler Erhard, seinen Besuch bei Präsident Johnson und die darauf folgenden Diskussionen über einen deutschen Militärbeitrag. Die rechtlichen Hürden für ein solches Engagement werden ebenfalls beleuchtet.
3. Politische Alternative: die „Helgoland“-Mission: Dieses Kapitel beschreibt die Entscheidung für den Einsatz des Hospitalschiffs „Helgoland“ als Alternative zu einem militärischen Engagement. Es detailliert die Vorbereitung der Mission, die Diskussionen im Bundestag, die öffentlichen Reaktionen und den Beginn des Einsatzes im August 1966. Der Exkurs zur medizinischen Versorgung in Vietnam vertieft den Kontext des humanitären Einsatzes.
4. Rechtliche Grundlagen für den „Helgoland“-Einsatz: Dieses Kapitel untersucht die rechtlichen Grundlagen der „Helgoland“-Mission. Es analysiert den Schutz der Mission durch die Genfer Konventionen, den völkerrechtlichen Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Südvietnam sowie den Kooperationsvertrag zwischen der Bundesrepublik und dem Deutschen Roten Kreuz. Der Fokus liegt auf der rechtlichen Absicherung des humanitären Einsatzes.
Schlüsselwörter
Hospitalschiff „Helgoland“, Vietnamkrieg, humanitäre Hilfe, deutsche Außenpolitik, Bundesrepublik Deutschland, Kanzler Erhard, Genfer Konventionen, Völkerrecht, Deutsches Rotes Kreuz, Kalter Krieg, atlantische Option, mediale Berichterstattung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Ein deutscher Militäreinsatz im Vietnamkrieg? Die 'Helgoland'-Mission als humanitäre Alternative"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht die Entsendung des deutschen Hospitalschiffs „Helgoland“ nach Saigon im Jahr 1966. Sie analysiert diese humanitäre Mission als Alternative zu einem militärischen Engagement der Bundesrepublik Deutschland im Vietnamkrieg und beleuchtet den politischen, rechtlichen und öffentlichen Kontext dieser Entscheidung im Rahmen der westdeutschen Außenpolitik der 1960er Jahre.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Rolle der Bundesrepublik im Vietnamkonflikt, die Entscheidung für humanitäre Hilfe statt militärischer Intervention, die rechtlichen Grundlagen des „Helgoland“-Einsatzes, die öffentliche Wahrnehmung und mediale Berichterstattung sowie einen Vergleich zwischen humanitärer Hilfe und militärischem Engagement im Kontext des Kalten Krieges. Sie untersucht auch die politischen Überlegungen innerhalb der Bundesregierung bezüglich eines möglichen militärischen Engagements, den Besuch von Kanzler Erhard bei Präsident Johnson und die damit verbundenen Diskussionen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Eine Einleitung mit Forschungsstand, Fragestellung und Methodik; ein Kapitel über die politischen Überlegungen zu einem möglichen deutschen Militäreinsatz im Vietnamkrieg; ein Kapitel zur „Helgoland“-Mission mit detaillierter Beschreibung der Vorbereitung, der Diskussionen im Bundestag, der öffentlichen Reaktionen und des Einsatzes selbst; ein Kapitel zu den rechtlichen Grundlagen des Einsatzes; und abschließend eine Zusammenfassung.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Arbeit nennt die Quellenlage im ersten Kapitel, welches detailliert auf die verwendeten Quellen eingeht.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zeigt auf, wie die Entsendung des Hospitalschiffs „Helgoland“ eine politische Entscheidung im Kontext der westdeutschen Außenpolitik und des Kalten Krieges darstellte. Sie analysiert die komplexen Abwägungen zwischen humanitärem Engagement und militärischer Beteiligung und beleuchtet die rechtlichen und politischen Herausforderungen dieser Entscheidung. Die Zusammenfassung fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Hospitalschiff „Helgoland“, Vietnamkrieg, humanitäre Hilfe, deutsche Außenpolitik, Bundesrepublik Deutschland, Kanzler Erhard, Genfer Konventionen, Völkerrecht, Deutsches Rotes Kreuz, Kalter Krieg, atlantische Option, mediale Berichterstattung.
- Quote paper
- M. A. Johannes Max Riemann (Author), 2003, Die Entsendung des Hospitalschiffs „Helgoland“ nach Saigon 1966, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/124463