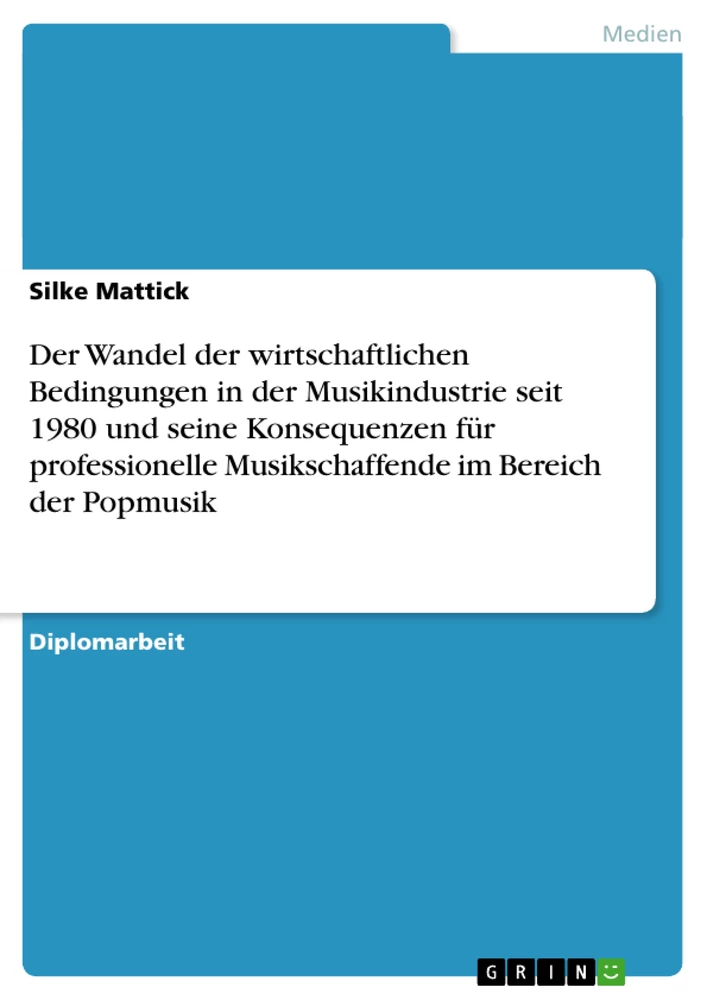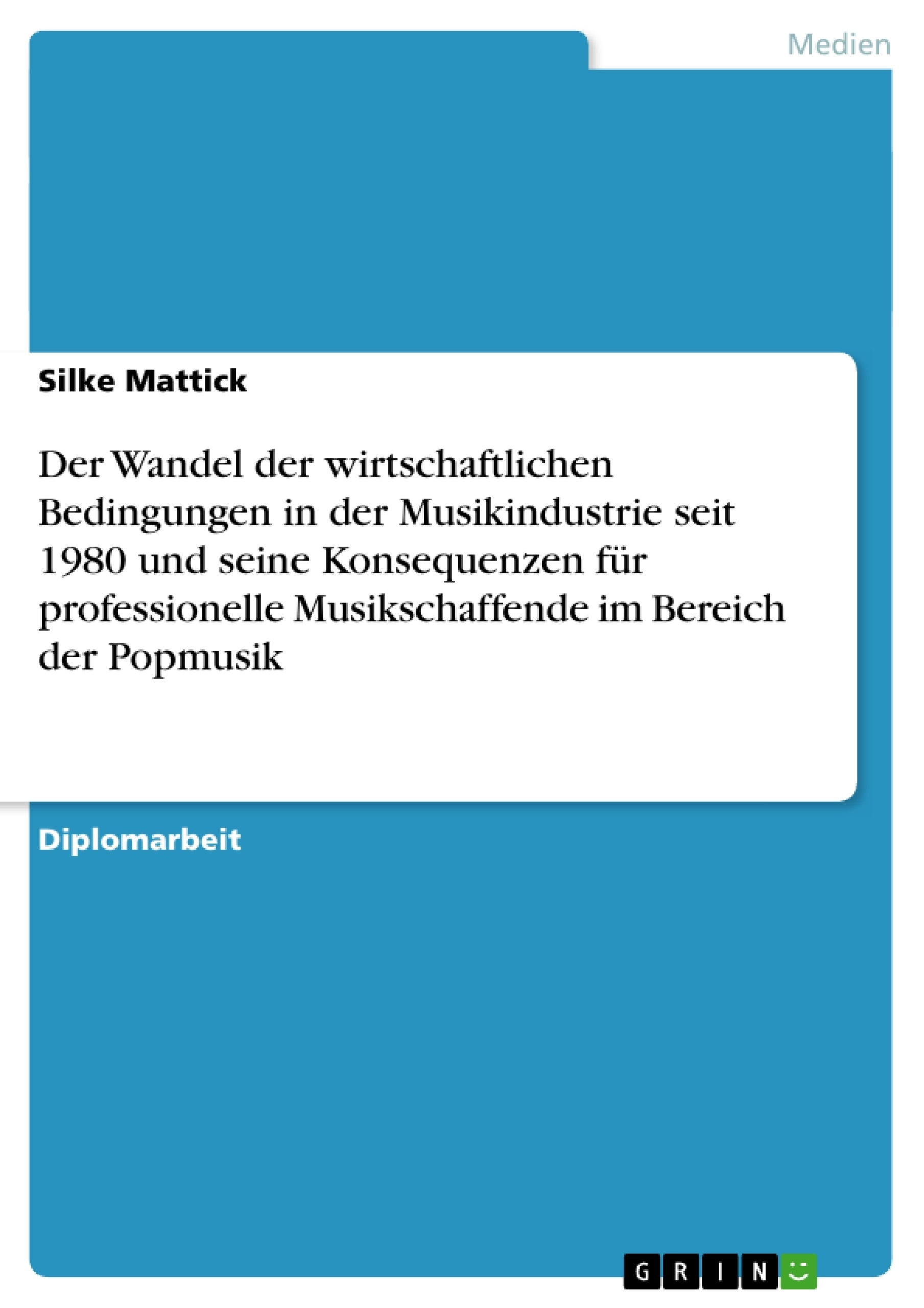Die Musikindustrie befindet sich seit Jahren in einer wirtschaftlichen Tiefphase. Es gibt Faktoren, die in der eingschlägigen Literatur bereits ursächlich als umsatzmindernde Einflüsse erkannt wurden und die hier zum Teil beschrieben werden. Die Beschäftigung mit diesen Einflussfaktoren führt wiederum zur Hauptfrage dieser Diplomarbeit: Welche Folgen ergeben sich aus den Transformationsprozessen innerhalb der Musikindustrie für die Musikschaffenden, die hauptberuflich ihren Lebensunterhalt mit der Erstellung von Musik bestreiten? Zum einen ist ein professioneller Musikschaffender heute scheinbar freier durch die technologischen Möglichkeiten wie ausgereifte Musikproduktionsprogramme und durch die Verbreitung seiner Werke im Internet, also auch unabhängig von traditionellen Distributionsmechanismen. Zum anderen erfordert der Strukturwandel eine Erweiterung seiner außermusikalischen Kompetenzen, in deren Folge sich eine Verschiebung in seinen Arbeitstätigkeiten ergibt, weil die musikalischen Werke in der Hauptsache als "Nebenprodukt" untergebracht werden müssen und der Musikschaffende sich nicht nur gegen Mitbewerber und durch die Beherrschung neuer Technologien behaupten muss, sondern zudem unternehmerisches Geschick braucht, um weiterhin am Musikmarkt bestehen zu können. Ich möchte in dieser Arbeit darstellen, welche Konsequenzen der technologische und infolgedessen der wirtschaftsstrukturelle Wandel der Musikindustrie für die professionellen Musikschaffenden hat. Dabei wird es nur um Selbstständige bzw. Freiberufler, nicht um abhängig beschäftigte Berufsmusiker gehen. Bei den möglichen Ursachen konzentriere ich mich auf die wichtigsten technologischen Entwicklungen und den Umgang der Konsumenten und Musikkonzerne mit dem Wirtschaftsgut Musik, die sich seit 1980 ergeben haben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Professionalisierung und Professionalität in der Popmusik
- 2. Überblick über den Wandel in der Musikindustrie ab 1980
- 2.1 Die Produktions- und Verwertungsmechanismen innerhalb der Musikindustrie
- 2.2 Die Verteilung der Rechte und Umsätze
- 2.3 Die Folgen technologischer Entwicklungen für die Produktion von Musik
- 2.4 Die Folgen technologischer Entwicklungen für die Distribution und den Konsum von Musik
- 2.5 Anpassungsverhalten der Majors
- 2.5.1 Alternative Distributionskanäle
- 2.6 Zusammenfassung der Merkmale des Wandels
- 3. Die Situation und Reaktionen der Musikschaffenden auf die neuen Entwicklungen
- 3.1 Interviewdurchführung und Auswertung
- 3.2 Die Entwicklung zum Musikschaffenden
- 3.3 Die Arbeit als Musikschaffender
- 3.3.1 Arbeitsabläufe
- 3.3.2 Umgang mit technologischen Entwicklungen und Fortbildung
- 3.3.3 Vermarktungsaktivitäten
- 3.3.4 Netzwerke und Konkurrenz
- 3.3.5 Finanzielle Lage
- 3.4 Einstellungen der Musikschaffenden
- 3.4.1 Berufszufriedenheit und die gesellschaftliche Bedeutung von Musik
- 3.4.2 Die Bedeutung der Plattenfirmen aus Sicht der Musikschaffenden
- 3.4.3 Persönliche Zukunftserwartungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Folgen des wirtschaftlichen Wandels in der Musikindustrie seit 1980 für professionelle Musikschaffende im Bereich der Popmusik. Die Arbeit analysiert die Auswirkungen technologischer Entwicklungen und veränderter Konsumgewohnheiten auf die Arbeitsbedingungen und die wirtschaftliche Situation dieser Künstler.
- Der Wandel der Produktions- und Verwertungsmechanismen in der Musikindustrie.
- Die Auswirkungen technologischer Entwicklungen auf die Musikproduktion und -distribution.
- Die Anpassungsstrategien der Musikschaffenden an die neuen Marktbedingungen.
- Die wirtschaftliche Situation und die Berufszufriedenheit professioneller Musiker.
- Die Rolle der Plattenfirmen aus der Sicht der Musikschaffenden.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den wirtschaftlichen Niedergang der Musikindustrie und stellt die zentrale Forschungsfrage: Welche Folgen ergeben sich aus den Transformationsprozessen innerhalb der Musikindustrie für hauptberuflich tätige Musikschaffende? Sie führt in die Thematik ein und skizziert den Ansatz der Arbeit, der sich auf selbstständige, freiberufliche Musiker konzentriert und die wichtigsten technologischen Entwicklungen seit 1980 sowie den Umgang von Konsumenten und Konzernen mit Musik als Ursachen betrachtet.
1. Professionalisierung und Professionalität in der Popmusik: Dieses Kapitel definiert den Begriff „professioneller Musikschaffender“ im Kontext der Popmusik. Es differenziert zwischen professionellen und nicht-professionellen Musikern und beschreibt die soziologischen Kennzeichen von Professionalisierung. Es wird deutlich, dass im Popbereich der Weg zur Professionalisierung anders verlaufen kann als in der klassischen Musik, oft ohne formale Ausbildung an Musikhochschulen. Trotzdem wird Professionalität durch die Kombination von besonderen Kenntnissen und Fähigkeiten definiert, die sich im musikalischen Schaffen ausdrücken und zu gesellschaftlicher Anerkennung und wirtschaftlichem Erfolg führen können.
2. Überblick über den Wandel in der Musikindustrie ab 1980: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die Veränderungen in der Musikindustrie seit 1980. Es analysiert die Produktions- und Verwertungsmechanismen, die Verteilung der Rechte und Umsätze, sowie die Folgen technologischer Entwicklungen für Produktion, Distribution und Konsum von Musik. Der Fokus liegt auf den Anpassungsstrategien der großen Musiklabels (Majors) im Angesicht dieser Veränderungen, insbesondere auf alternativen Distributionskanälen. Zusammenfassend werden die Hauptmerkmale des Wandels herausgestellt.
3. Die Situation und Reaktionen der Musikschaffenden auf die neuen Entwicklungen: Dieses Kapitel beschreibt die Situation professioneller Musikschaffender vor dem Hintergrund der im vorherigen Kapitel beschriebenen Veränderungen. Es berichtet über die Durchführung und Auswertung von Interviews mit Musikern, analysiert deren berufliche Entwicklung und Arbeitsabläufe, den Umgang mit neuen Technologien, Vermarktungsaktivitäten, Netzwerke, die finanzielle Lage, sowie Einstellungen zur Berufszufriedenheit, der gesellschaftlichen Bedeutung von Musik und Zukunftserwartungen. Die Kapitel unterstreichen die Herausforderungen und Anpassungsmechanismen der Musiker im Kontext des technologischen und wirtschaftlichen Wandels.
Schlüsselwörter
Musikindustrie, Popmusik, Professionalisierung, Technologischer Wandel, Wirtschaftsstruktur, Musikschaffende, Distribution, Vermarktung, Finanzielle Lage, Berufszufriedenheit.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Der Wandel in der Musikindustrie und seine Auswirkungen auf professionelle Musikschaffende
Was ist das Thema der Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Folgen des wirtschaftlichen Wandels in der Musikindustrie seit 1980 für professionelle Musikschaffende im Bereich der Popmusik. Sie analysiert die Auswirkungen technologischer Entwicklungen und veränderter Konsumgewohnheiten auf die Arbeitsbedingungen und die wirtschaftliche Situation dieser Künstler.
Welche Aspekte der Musikindustrie werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Wandel der Produktions- und Verwertungsmechanismen, die Auswirkungen technologischer Entwicklungen auf die Musikproduktion und -distribution, die Anpassungsstrategien der Musikschaffenden, deren wirtschaftliche Situation und Berufszufriedenheit, sowie die Rolle der Plattenfirmen aus der Sicht der Musiker.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Arbeit basiert auf einer Literaturrecherche und der Auswertung von Interviews mit professionellen Musikern. Die Interviews beleuchten die berufliche Entwicklung, Arbeitsabläufe, den Umgang mit Technologien, Vermarktungsaktivitäten, Netzwerke, die finanzielle Lage und die Einstellungen der Musiker.
Welche zentralen Fragen werden untersucht?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Welche Folgen ergeben sich aus den Transformationsprozessen innerhalb der Musikindustrie für hauptberuflich tätige Musikschaffende? Die Arbeit untersucht außerdem die Anpassungsstrategien der Musiker an die neuen Marktbedingungen und die Veränderungen in ihrer wirtschaftlichen Lage und Berufszufriedenheit.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Professionalisierung in der Popmusik, ein Kapitel zum Wandel der Musikindustrie seit 1980 und ein Kapitel zu den Reaktionen der Musikschaffenden auf diese Veränderungen. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung und einem Literaturverzeichnis.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Musikindustrie, Popmusik, Professionalisierung, Technologischer Wandel, Wirtschaftsstruktur, Musikschaffende, Distribution, Vermarktung, Finanzielle Lage, Berufszufriedenheit.
Wer ist die Zielgruppe der Arbeit?
Die Arbeit richtet sich an Wissenschaftler, Studierende und alle, die sich für die Musikindustrie, die Situation von Musikern und die Auswirkungen des technologischen Wandels interessieren.
Welche Zeitspanne wird betrachtet?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Entwicklungen in der Musikindustrie seit 1980.
Welche Rolle spielen die Plattenfirmen?
Die Arbeit untersucht die Rolle der Plattenfirmen aus der Sicht der Musikschaffenden und analysiert, wie sich die Beziehung zwischen Musikern und Plattenfirmen im Zuge des Wandels verändert hat.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Schlussfolgerungen der Arbeit werden in der Zusammenfassung der Kapitel dargestellt und beleuchten die Herausforderungen und Anpassungsmechanismen der Musiker im Kontext des technologischen und wirtschaftlichen Wandels. Die genauen Schlussfolgerungen lassen sich aus dem vollständigen Text entnehmen.
- Quote paper
- Silke Mattick (Author), 2008, Der Wandel der wirtschaftlichen Bedingungen in der Musikindustrie seit 1980 und seine Konsequenzen für professionelle Musikschaffende im Bereich der Popmusik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/124447