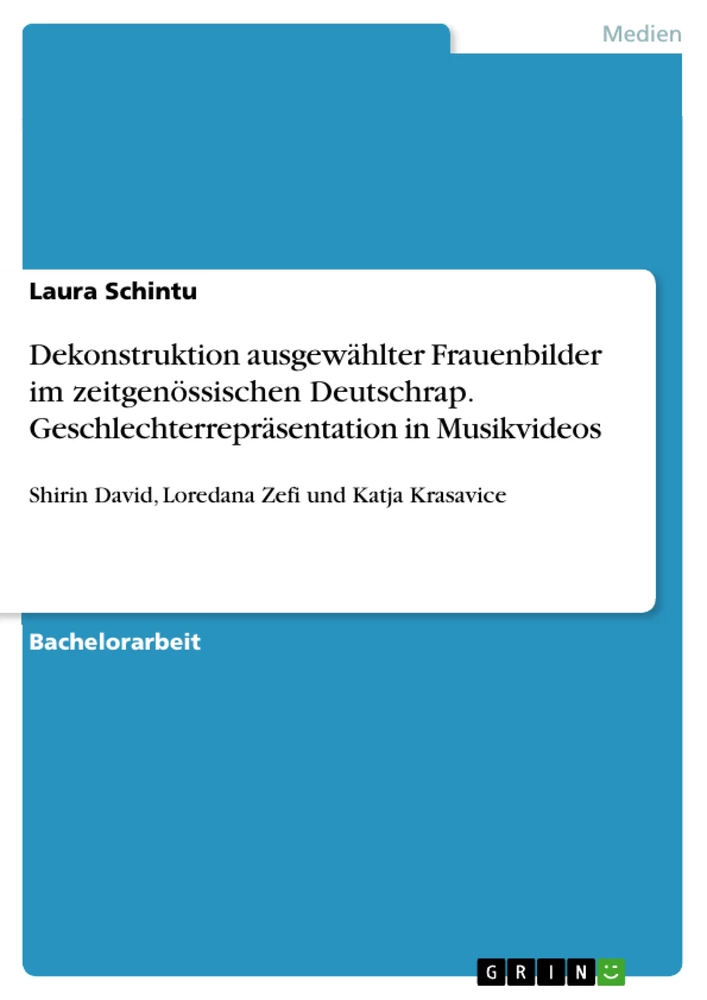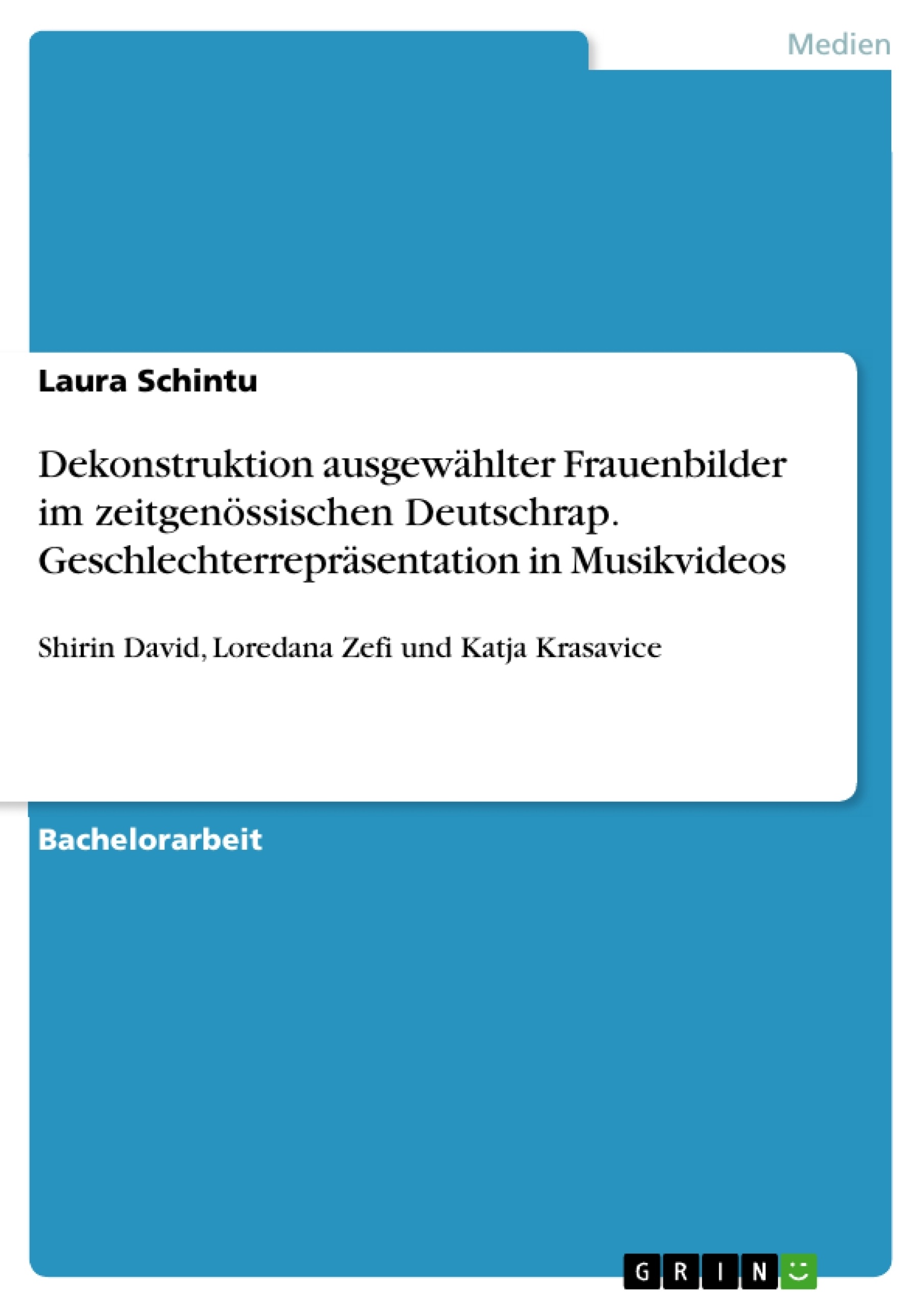Welches Frauenbild wird heutzutage im Deutschrap vermittelt und wie spielen die momentan erfolgreichen Rapperinnen mit der Geschlechterrepräsentation in ihren Musikvideos? Diese Arbeit untersucht, ob weibliche Rapper an das phallogozentrische hervorgebrachte Bild der Frauen anknüpfen oder eine neue Perspektive hinsichtlich der Geschlechterzuschreibungen inszenieren.
Die zeitgenössischen Massenmedien sowie die aktuellen deutschen Chartplatzierungen, scheinen eine Form von Revolution innerhalb des Rap-Genres aufzuzeigen. Rap, als Teil der HipHop-Kultur, galt seit seiner Entstehung in den USA und später auch in Europa als eine männlich dominierte Szene. Umso erstaunlicher ist es, dass es in den letzten zwei Jahren vorrangig weibliche Rapper sind, die wochenlang in den Top Ten der deutschen Charts verharren, sie weisen einen großen Erfolg in sozialen Medien auf und werden mittlerweile auch von öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten nicht mehr ignoriert.
Diese Führungsposition spricht somit nicht nur die heutige Generation der Jugend an, sondern sie repräsentiert auch veränderte Rollenbilder. Die kontroverse Diskussion rund um die zeitgenössischen weiblichen Rapper ist groß. Einerseits wird ihnen eine feministische Haltung zugesprochen, anderseits würden sie die männliche Hegemonie verherrlichen.
Rap-Musikvideos und ihre Verbreitung durch Massenmedien vermitteln eine Darstellung von Frauen, welche von Stereotypen, Klischees oder zugeschriebenen Geschlechterrollen geprägt ist. Durch die Rezeption der dargestellten Frauenbilder im Rap, werden die damit verbundenen Geschlechterdifferenzen und Konnotationen von Medienkonsumenten verinnerlicht. Somit prägen die Medien die Gesellschaft mit tradierten Vorstellungen und Bildern von Frauen und Männern, die das Denken und Verhalten beeinflussen.
Als kulturspezifisches Produkt prägen damit Musikvideos die vorherrschende Ideologie – Sie unterstützen, verbreiten und fördern Grundvorstellungen und damit auch die Konstruktion von Weiblichkeit und Männlichkeit. Die neu entwickelte Denkrichtung innerhalb der feministischen Forschung, die auf Judith Butler (1990) zurückzuführen ist, eröffnet einen Paradigmenwechsel. Jedoch ist die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit modern dekonstruierten Frauenbilder im Deutschrap, noch nicht sehr umfangreich, da es als neues Phänomen innerhalb der Rap-Kultur angesehen werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Konstruktion von Frauenbildern
- 2.1 Geschlechterkonstruktionen – Die Herstellung von Geschlecht
- 2.1.1 Performativitätstheorie
- 2.1.2 sex, gender und desire
- 2.1.3 Heterosexuelle Matrix, Diskursive Performativität und Phallogozentrismus
- 2.1.4 Materialisierung und Normierung von Körpern
- 2.2 Phallische Frauen
- 2.3 Die „vierte Welle“ der Frauenbewegungen
- 2.4 Geschlechterverhältnisse im und beim Musikfernsehen nach Bechdolf
- 2.4.1 Kriterien für Geschlechterverhältnisse in Musikclips nach Bechdolf
- 2.4.2 De- und Rekonstruktion von Geschlechterverhältnissen nach Bechdolf
- 3. HipHop
- 3.1 Ursprünge des HipHop
- 3.2 Kultur des HipHops
- 3.2.1 Die Inszenierungsgesellschaft und ihre Theatralität
- 3.3 Weibliche und männliche Rollen in Rapvideos
- 3.3.1 Weibliche Pioniere der Rapgeschichte
- 3.3.2 Geschlechterrollen im HipHop und Rap
- 4. Dekonstruktion
- 5. Methodisches Vorgehen
- 5.1 Musikvideo Analyse nach Bullerjahn
- 5.2 Kommentarauswertung nach der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring
- 6. Analyse
- 6.1 Shirin David
- 6.1.1 Dekonstruktion des Frauenbildes in Gib Ihm
- 6.1.2 Zwischenfazit zu Gib ihm
- 6.1.3 Auswertung der YouTube-Kommentare von Gib Ihm
- 6.1.4 Zusammenführung von Gib ihm
- 6.2 Loredana Zefi
- 6.2.1 Dekonstruktion des Frauenbildes in Milliondollar$mile
- 6.2.2 Zwischenfazit zu Milliondollar$mile
- 6.2.3 Auswertung der YouTube-Kommentare von Milliondollar$mile
- 6.2.4 Zusammenführung von Milliondollar$mile
- 6.3 Katja Krasavice
- 6.3.1 Dekonstruktion des Frauenbildes in Wer bist du von Katja Krasavice
- 6.3.2 Zwischenfazit zu Wer bist du
- 6.3.3 Auswertung der YouTube-Kommentare
- 6.3.4 Zusammenführung von Wer bist du
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung von Frauenbildern im zeitgenössischen Deutschrap. Ziel ist es, zu analysieren, wie erfolgreiche deutschsprachige Rapperinnen mit Geschlechterrepräsentation in ihren Musikvideos umgehen und welche Frauenbilder dabei vermittelt werden. Die Arbeit beleuchtet die Dekonstruktion dieser Bilder im Kontext der Performativitätstheorie und der Geschlechterforschung.
- Performativität von Geschlecht im Deutschrap
- Analyse der Geschlechterrollen in Musikvideos
- Dekonstruktion von Frauenbildern im Kontext der Rap-Kultur
- Rezeption und Kommentare der Zuschauer auf YouTube
- Vergleichende Analyse verschiedener Künstlerinnen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Forschungsfrage nach der Darstellung von Frauenbildern im aktuellen Deutschrap und dem Umgang der erfolgreichen Rapperinnen mit Geschlechterrepräsentation in ihren Musikvideos. Sie argumentiert, dass der Erfolg weiblicher Rapperinnen ein neues Phänomen darstellt, das eine Auseinandersetzung mit veränderten Rollenbildern und feministischen Haltungen erfordert, gleichzeitig aber auch Kontroversen um die Verherrlichung männlicher Hegemonie auslöst. Die Einleitung begründet die Relevanz der Forschungsfrage und skizziert den Aufbau der Arbeit.
2. Die Konstruktion von Frauenbildern: Dieses Kapitel bietet einen theoretischen Rahmen, indem es die Performativitätstheorie nach Judith Butler einführt und deren Anwendung auf die Analyse von Geschlechterdarstellungen in Musikvideos erklärt. Es beleuchtet verschiedene Ansätze der Geschlechterforschung, die für die Analyse relevant sind, und verweist auf die Bedeutung von Medien und kulturellen Produkten für die Konstruktion von Weiblichkeit und Männlichkeit. Der Abschnitt zu Bechdolf liefert Kriterien zur Analyse von Geschlechterverhältnissen in Musikclips.
3. HipHop: Dieses Kapitel beschreibt die Ursprünge und die Kultur des HipHops, mit Fokus auf die Entwicklung von weiblichen und männlichen Rollen innerhalb des Genres. Es untersucht die Inszenierung und Theatralität im HipHop-Kontext und führt wichtige historische Entwicklungen auf, die die Geschlechterdarstellungen im Rap beeinflusst haben. Der Abschnitt beleuchtet weibliche Pioniere des Rap und die Entwicklung der Geschlechterrollen im HipHop und Rap.
5. Methodisches Vorgehen: Dieses Kapitel beschreibt die methodischen Ansätze der Arbeit, die auf der Musikvideoanalyse nach Bullerjahn und der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring basieren. Es erläutert detailliert, wie die Musikvideos analysiert und die Kommentare der Zuschauer auf YouTube ausgewertet werden, um die Forschungsfrage zu beantworten.
6. Analyse: Dieses Kapitel präsentiert die Analysen der ausgewählten Musikvideos von Shirin David, Loredana Zefi und Katja Krasavice. Für jede Künstlerin wird die Dekonstruktion des Frauenbildes in ihren jeweiligen Musikvideos detailliert untersucht, Zwischenfazite gezogen und die Auswertung der YouTube-Kommentare eingebunden. Die Ergebnisse werden zusammengeführt und im Hinblick auf die Forschungsfrage interpretiert.
Schlüsselwörter
Deutschrap, Frauenbilder, Geschlechterrollen, Performativität, Dekonstruktion, Musikvideoanalyse, Judith Butler, Ute Bechdolf, Shirin David, Loredana Zefi, Katja Krasavice, YouTube-Kommentare, Geschlechterrepräsentation, Hegemonie, Feminismus.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Darstellung von Frauenbildern im zeitgenössischen Deutschrap
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Darstellung von Frauenbildern im zeitgenössischen Deutschrap, insbesondere wie erfolgreiche deutschsprachige Rapperinnen mit Geschlechterrepräsentation in ihren Musikvideos umgehen und welche Frauenbilder dabei vermittelt werden. Der Fokus liegt auf der Dekonstruktion dieser Bilder im Kontext der Performativitätstheorie und der Geschlechterforschung.
Welche Künstlerinnen werden untersucht?
Die Arbeit analysiert Musikvideos von Shirin David, Loredana Zefi und Katja Krasavice. Die Analyse umfasst die Dekonstruktion der jeweiligen Frauenbilder und die Auswertung der dazugehörigen YouTube-Kommentare.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf die Performativitätstheorie nach Judith Butler und bezieht weitere Ansätze der Geschlechterforschung mit ein. Die Analyse der Musikvideos basiert auf der Methode von Bullerjahn, die Auswertung der YouTube-Kommentare auf der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring. Die Arbeit bezieht außerdem die Kriterien von Bechdolf zur Analyse von Geschlechterverhältnissen in Musikclips mit ein.
Welche Aspekte der Musikvideos werden analysiert?
Die Analyse betrachtet die Geschlechterrollen und -darstellungen in den Musikvideos, die Konstruktion und Dekonstruktion von Frauenbildern, sowie die Rezeption und die Kommentare der Zuschauer auf YouTube. Es wird untersucht, wie die Künstlerinnen mit den gängigen Geschlechterstereotypen umgehen und welche Botschaften sie vermitteln.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Konstruktion von Frauenbildern (inkl. Performativitätstheorie und Bechdolfs Kriterien), HipHop (Ursprünge, Kultur, Geschlechterrollen), Methodisches Vorgehen (Musikvideoanalyse nach Bullerjahn und qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring), Analyse der Musikvideos von Shirin David, Loredana Zefi und Katja Krasavice (inkl. YouTube-Kommentar-Auswertung) und Schlussfolgerungen.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie gehen erfolgreiche deutschsprachige Rapperinnen mit Geschlechterrepräsentation in ihren Musikvideos um, und welche Frauenbilder werden dabei vermittelt?
Wie wird die Rezeption der Musikvideos berücksichtigt?
Die Rezeption wird durch die Auswertung der YouTube-Kommentare zu den analysierten Musikvideos berücksichtigt. Diese Kommentare liefern Einblicke in die Interpretationen und Reaktionen des Publikums auf die dargestellten Frauenbilder.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Deutschrap, Frauenbilder, Geschlechterrollen, Performativität, Dekonstruktion, Musikvideoanalyse, Judith Butler, Ute Bechdolf, Shirin David, Loredana Zefi, Katja Krasavice, YouTube-Kommentare, Geschlechterrepräsentation, Hegemonie, Feminismus.
- Quote paper
- Laura Schintu (Author), 2020, Dekonstruktion ausgewählter Frauenbilder im zeitgenössischen Deutschrap. Geschlechterrepräsentation in Musikvideos, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1243469