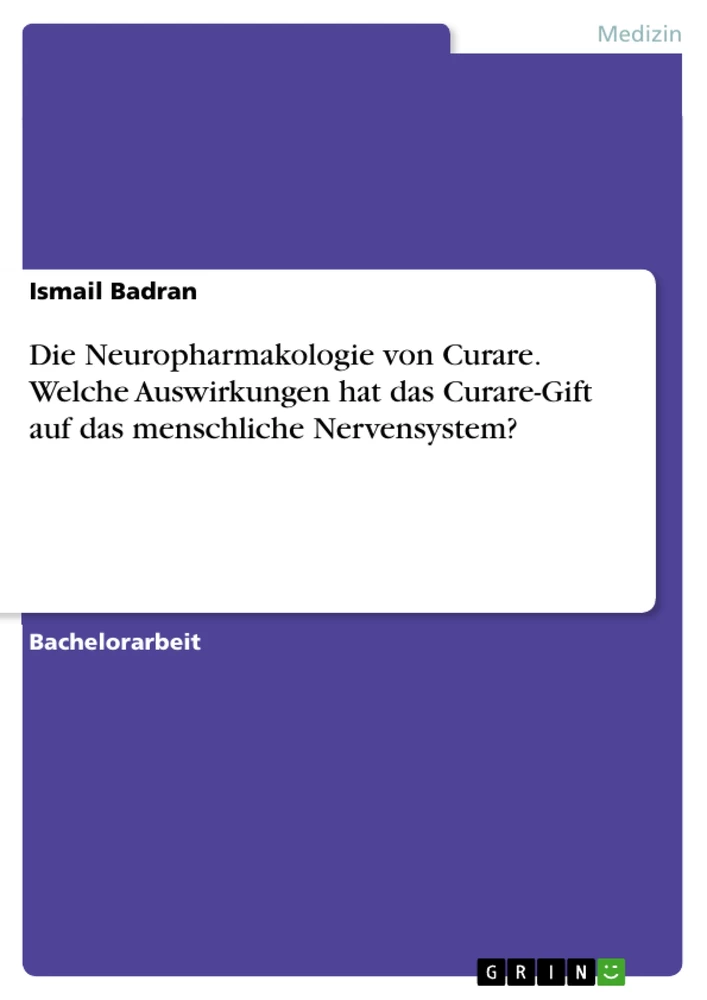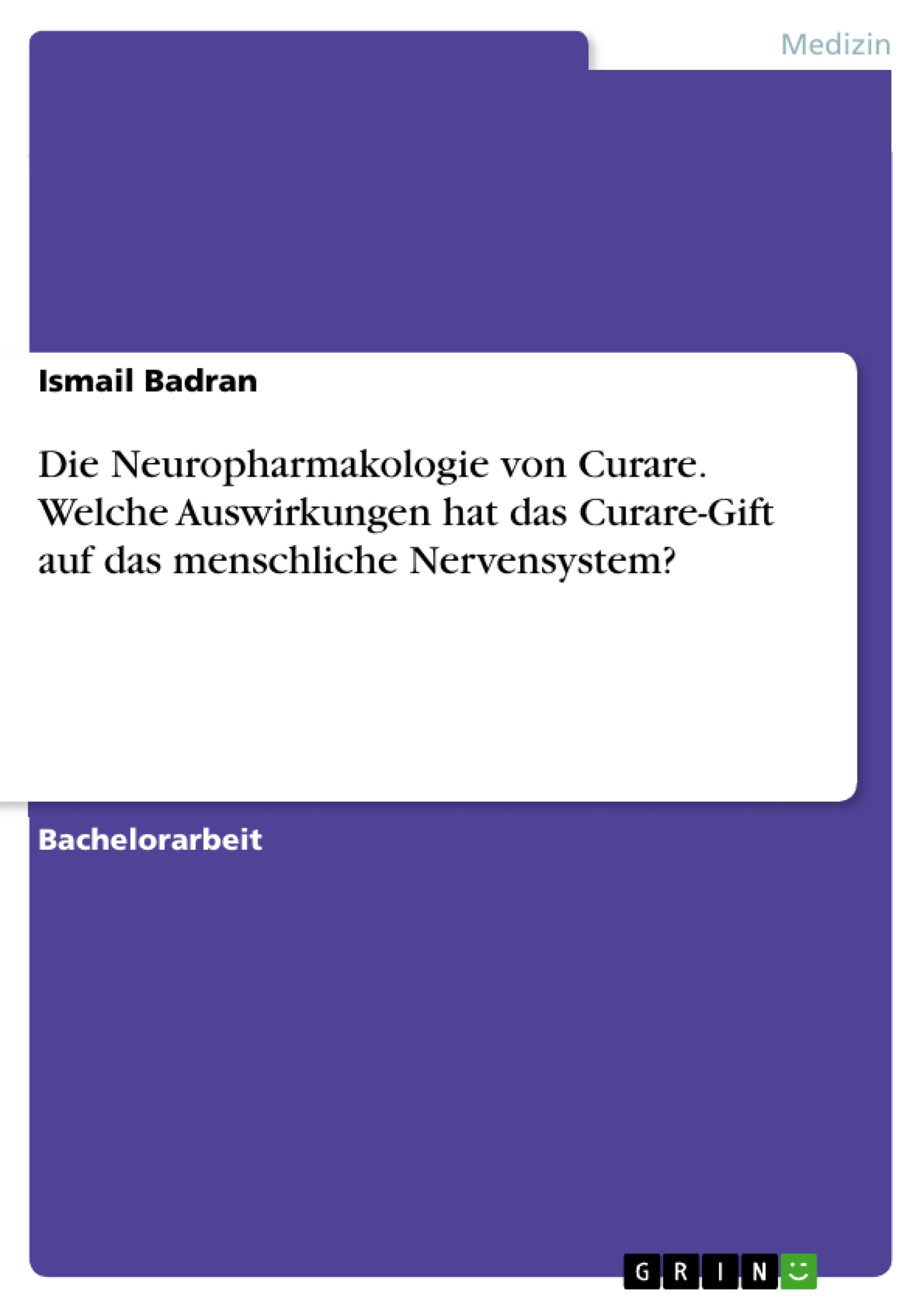In dieser Bachelorarbeit wird die Neuropharmakologie des Curare-Giftes untersucht und in dem Zusammenhang die Frage beantwortet, welche Auswirkungen das Curare-Gift auf das menschliche Nervensystem hat. Im Laufe der Arbeit wird unter anderem dargestellt, wie die toxische Wirkung des Giftes neutralisiert wird. Außerdem wird der Frage nachgegangen, inwiefern das Gift angewendet wird und welchen Beitrag es in der Anästhesie geleistet hat. Als Ausgangspunkt für die Arbeit werden zuvor die neurobiologischen und physiologischen Grundlagen der Signalweiterleitung und Muskelkontraktion veranschaulicht.
Die neuropharmakologische Wirkung des Curare-Giftes hat eine zentrale Bedeutung für die Anästhesiologie. Curare bindet als kompetitiver Antagonist an die nikotinischen Acetylcholin-Rezeptoren an. Diese Rezeptoren befinden sich an der motorischen Endplatte der Skelettmuskulatur. Das Toxin hemmt die Muskelkontraktion der Skelettmuskulatur, indem es mit dem natürlichen Liganden Acetylcholin konkurriert. Durch die inhibierende Wirkung wird die neuromuskuläre Übertragung zwischen Motorneuron und Muskelfaser verhindert. Folglich kommt es in den Myofibrillen nicht zur elektromechanischen Kopplung und nachfolgend auch nicht zum Querbrückenzyklus in den Sarkomeren. Grund hierfür ist, dass ohne die Acetylcholin-Wirkung deshalb kein Endplattenpotenzial und auch kein Muskel-Aktionspotenzial entstehen, da der Natrium-Kanal (den die nikotinischen Acetylcholin-Rezeptoren bilden) geschlossen bleibt. Ohne diese grundlegenden Prozesse wird die Skelettmuskulatur gelähmt.
Genau diese lähmende Wirkung des Toxins wurde zugunsten der Narkose genutzt. Die Entdeckung der Curare-Wirkung hat nämlich die Anästhesie erleichtert. Aufgrund der Tatsache, dass das Curare seine Wirkung nur im peripheren und somatischen Nervensystem entfaltet, ist das Zentralnervensystem deshalb nicht betroffen, da das Gift die Bluthirnschranke nicht passieren kann. Die Anästhesisten können damit gezielt für die Narkose die Skelettmuskulatur lähmen, während der Patient noch bei Bewusstsein ist. Bei hoher Curare-Dosis muss der Patient jedoch künstlich beatmet werden, da auch die Atemmuskeln betroffen sind. Zusätzlich treten schon bereits bei kleiner Dosis Nebenwirkungen auf, die zum Beispiel den Blutdruck senken. Diese Nebenwirkungen werden hervorgerufen durch die Freisetzung von Histamin und durch die Hemmung anderer Acetylcholin-Rezeptoren.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Nervensystem
- 2.1 Struktur und Funktion
- 2.2 Informationsverarbeitung
- 3 Nervenzelle
- 4 Zellmembran
- 4.1 Aufbau
- 4.2 Funktion
- 5 Membranpotenzial
- 5.1 Ruhepotenzial
- 5.2 Natrium-Kalium-Pumpe
- 5.3 Aktionspotenzial
- 5.4 Fortleitung des Aktionspotenzials
- 5.4.1 Kontinuierliche Erregungsweiterleitung
- 5.4.2 Saltatorische Erregungsweiterleitung
- 6 Synaptische Erregungsübertragung
- 6.1 Acetylcholin
- 6.2 Ionotrope Rezeptoren
- 6.3 Muskarinische und nikotinische Rezeptoren
- 6.4 Agonisten
- 6.5 Antagonisten
- 7 Muskelgewebe
- 7.1 Skelettmuskulatur
- 7.2 Muskelzelle
- 7.3 Sarkomer
- 7.4 Myofilamente
- 7.4.1 Aktinfilamente
- 7.4.2 Myosinfilamente
- 7.5 Muskelkontraktion
- 7.5.1 Neuromuskuläre Übertragung an der motorischen Endplatte
- 7.5.2 Querbrückenzyklus (Cross-Bridge-Cycle)
- 8 Curare
- 8.1 Arten
- 8.2 Geschichte und Herkunft
- 8.3 Pharmakodynamik
- 8.4 Pharmakokinetik
- 8.5 Einteilung als nichtdepolarisierendes Muskelrelaxans
- 8.6 Gegenmittel
- 8.7 Anwendung
- 9 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Neuropharmakologie des Curare-Giftes. Ziel ist es, die Wirkungsweise von Curare auf das Nervensystem und die Muskelkontraktion zu erläutern und dessen historische und klinische Bedeutung darzustellen.
- Wirkmechanismus von Curare auf der neuromuskulären Endplatte
- Die Rolle von Acetylcholinrezeptoren bei der Muskelkontraktion
- Pharmakodynamik und Pharmakokinetik von Curare
- Klinische Anwendung und Bedeutung von Curare in der Anästhesiologie
- Nebenwirkungen und Gegenmittel von Curare
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Neuropharmakologie von Curare ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Sie legt den Fokus auf die Bedeutung des Curare-Toxins für die Anästhesiologie und die nachfolgende detaillierte Erläuterung des Wirkmechanismus.
2 Nervensystem: Dieses Kapitel beschreibt die grundlegende Struktur und Funktion des Nervensystems, einschließlich der Informationsverarbeitung. Es bildet die essentielle Grundlage für das Verständnis der späteren Kapitel, indem es die anatomischen und physiologischen Voraussetzungen für die Wirkung von Curare aufzeigt.
3 Nervenzelle: Dieses Kapitel widmet sich der Nervenzelle als Grundeinheit des Nervensystems, legt den Fokus auf deren Aufbau und Funktion. Dieses detaillierte Verständnis der Nervenzelle ist unerlässlich, um die komplexen Prozesse der neuromuskulären Übertragung, die durch Curare beeinflusst werden, zu verstehen.
4 Zellmembran: Das Kapitel beschreibt den Aufbau und die Funktion der Zellmembran, einschließlich des Membranpotenzials. Die detaillierte Darstellung der Membranstruktur und der Ionenkanäle bildet die Grundlage für das Verständnis der Erregungsleitung und der Wirkung von Curare auf die Ionenströme.
5 Membranpotenzial: Hier werden Ruhepotenzial, Natrium-Kalium-Pumpe und Aktionspotenzial ausführlich erklärt. Das Kapitel veranschaulicht die Entstehung und Ausbreitung von Aktionspotenzialen, welche essentiell für die neuromuskuläre Signalübertragung sind, die durch Curare blockiert wird.
6 Synaptische Erregungsübertragung: Dieses Kapitel erläutert die Übertragung von Nervenimpulsen an der Synapse, insbesondere die Rolle von Acetylcholin und seinen Rezeptoren. Der detaillierte Einblick in die Funktion der Acetylcholinrezeptoren ist grundlegend für das Verständnis der kompetitiven Antagonistenwirkung von Curare.
7 Muskelgewebe: Der Fokus liegt hier auf der Skelettmuskulatur, ihren Zellen, dem Sarkomer und den Myofilamenten, sowie dem Prozess der Muskelkontraktion, inklusive des Querbrückenzyklus. Dieses Kapitel beschreibt die Zielstruktur der Curare-Wirkung und den molekularen Mechanismus der Muskelkontraktion.
8 Curare: Dieses Kapitel behandelt die verschiedenen Arten von Curare, seine Geschichte, Pharmakodynamik und Pharmakokinetik. Es erklärt ausführlich die Einteilung als nichtdepolarisierendes Muskelrelaxans, beschreibt Gegenmittel und Anwendungen in der Anästhesiologie. Die umfassende Darstellung der Curare-Eigenschaften bildet den Kern der Arbeit.
Schlüsselwörter
Curare, Neuropharmakologie, neuromuskuläre Übertragung, Acetylcholin, nikotinische Rezeptoren, Muskelrelaxans, Anästhesiologie, Muskelkontraktion, Nervensystem, Aktionspotenzial.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Neuropharmakologie von Curare
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der Neuropharmakologie des Curare-Giftes. Sie untersucht die Wirkungsweise von Curare auf das Nervensystem und die Muskelkontraktion und beleuchtet dessen historische und klinische Bedeutung.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: den Wirkmechanismus von Curare auf der neuromuskulären Endplatte, die Rolle von Acetylcholinrezeptoren bei der Muskelkontraktion, die Pharmakodynamik und Pharmakokinetik von Curare, die klinische Anwendung und Bedeutung von Curare in der Anästhesiologie sowie Nebenwirkungen und Gegenmittel von Curare.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in neun Kapitel gegliedert: Einleitung, Nervensystem, Nervenzelle, Zellmembran, Membranpotenzial, synaptische Erregungsübertragung, Muskelgewebe, Curare und Fazit. Jedes Kapitel baut auf dem vorherigen auf und führt schrittweise zum Verständnis der Curare-Wirkung.
Welche Kapitel gibt es und worum geht es in ihnen?
Kapitel 1 (Einleitung): Einführung in die Neuropharmakologie von Curare und Überblick über die Arbeit. Kapitel 2 (Nervensystem): Grundlegende Struktur und Funktion des Nervensystems. Kapitel 3 (Nervenzelle): Aufbau und Funktion der Nervenzelle. Kapitel 4 (Zellmembran): Aufbau und Funktion der Zellmembran, einschließlich des Membranpotenzials. Kapitel 5 (Membranpotenzial): Ruhepotenzial, Natrium-Kalium-Pumpe und Aktionspotenzial. Kapitel 6 (Synaptische Erregungsübertragung): Nervenimpulsübertragung an der Synapse, Rolle von Acetylcholin und seinen Rezeptoren. Kapitel 7 (Muskelgewebe): Skelettmuskulatur, Muskelzellen, Sarkomer, Myofilamente und Muskelkontraktion. Kapitel 8 (Curare): Arten, Geschichte, Pharmakodynamik, Pharmakokinetik, Anwendung und Gegenmittel von Curare. Kapitel 9 (Fazit): Zusammenfassung der Ergebnisse.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Curare, Neuropharmakologie, neuromuskuläre Übertragung, Acetylcholin, nikotinische Rezeptoren, Muskelrelaxans, Anästhesiologie, Muskelkontraktion, Nervensystem, Aktionspotenzial.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die Wirkungsweise von Curare auf das Nervensystem und die Muskelkontraktion zu erläutern und dessen historische und klinische Bedeutung darzustellen.
Welche Rolle spielen Acetylcholinrezeptoren?
Acetylcholinrezeptoren spielen eine zentrale Rolle bei der Muskelkontraktion. Curare wirkt als kompetitiver Antagonist an diesen Rezeptoren und blockiert somit die neuromuskuläre Übertragung.
Wie wirkt Curare?
Curare wirkt als nichtdepolarisierendes Muskelrelaxans, indem es kompetitiv die Bindung von Acetylcholin an nikotinische Rezeptoren an der neuromuskulären Endplatte blockiert und somit die Muskelkontraktion verhindert.
Welche klinische Bedeutung hat Curare?
Curare findet in der Anästhesiologie als Muskelrelaxans Anwendung, um während Operationen eine vollständige Muskelerschlaffung zu erreichen.
Gibt es Gegenmittel zu Curare?
Ja, es gibt Gegenmittel zu Curare. Die Arbeit beschreibt diese im Detail.
- Quote paper
- Ismail Badran (Author), 2021, Die Neuropharmakologie von Curare. Welche Auswirkungen hat das Curare-Gift auf das menschliche Nervensystem?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1243452