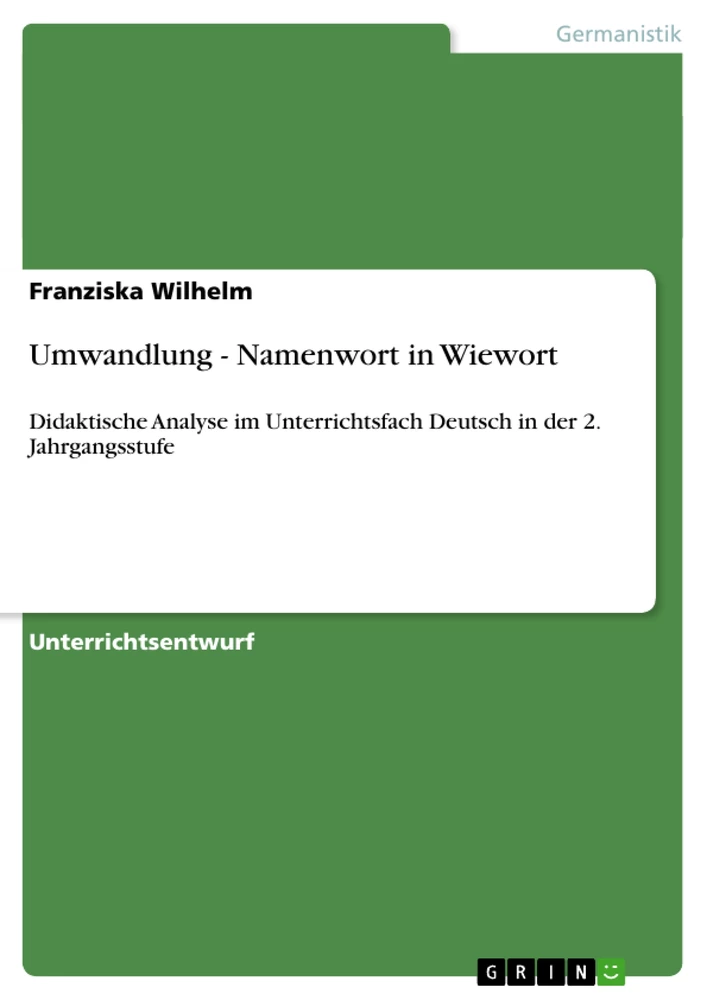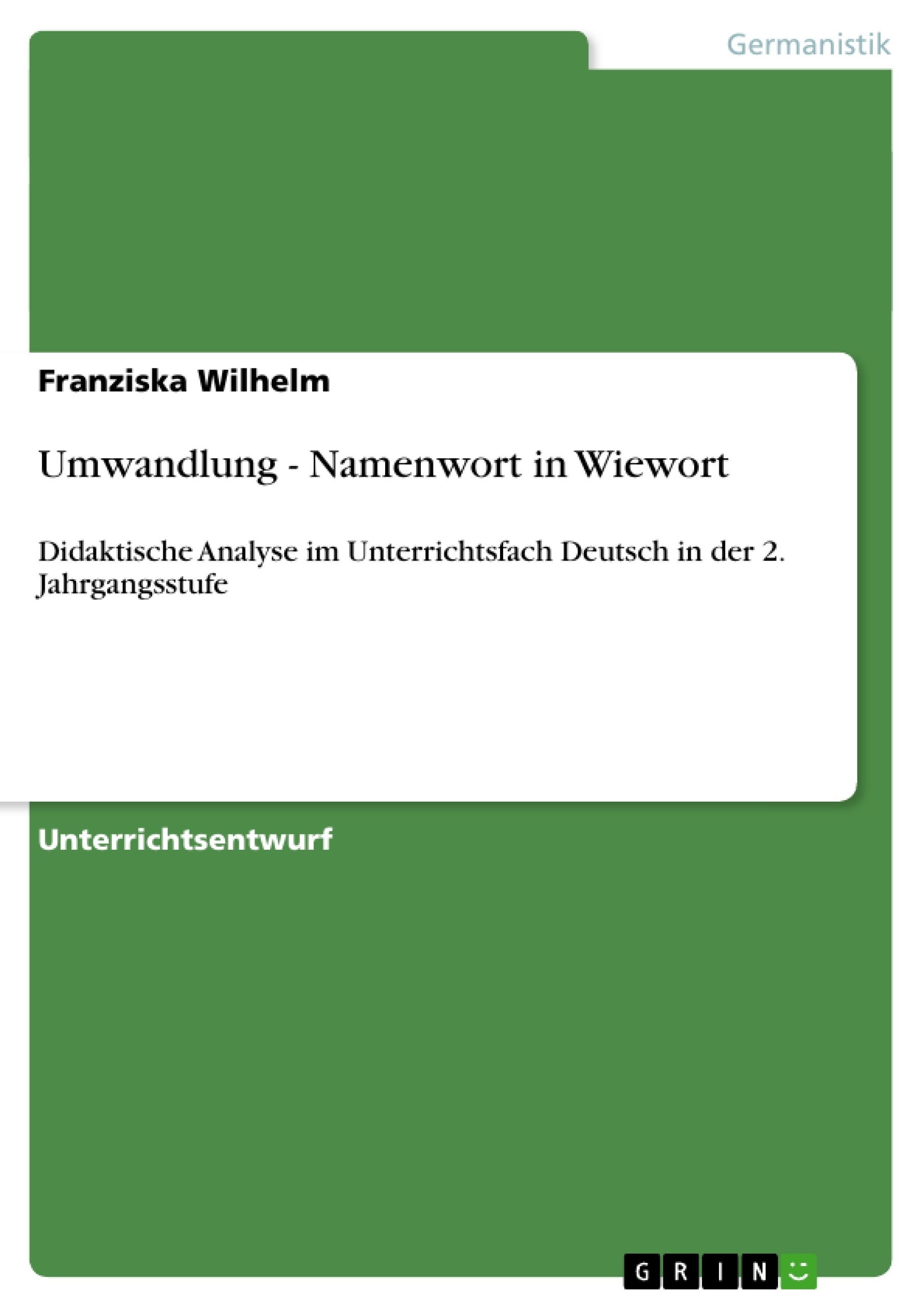Mit dem Erlernen des Lesens und Schreibens werden die Kinder auf neue Weise angeregt, über Sprache in ihrer mündlichen und schriftlichen Form nachzudenken. Die Schüler sollen in der ersten/zweiten Klasse Wortarten in ihrer Leistung kennen und voneinander unterscheiden können. Dabei eignen sie sich erste fachliche Begriffe und Arbeitstechniken an. In der ersten Klasse haben die Kinder Erfahrungen mit Namenwörtern und Wiewörtern machen können, sie haben gelernt, dass es einige wichtige Besonderheiten gibt, nämlich das Namenwörter groß geschrieben werden, dass man sie in vier Kategorien (Menschen, Tiere, Pflanzen, Dinge) einordnen kann und das es eine Überprüfungsmöglichkeit (man kann Namenwörter sehen, anfassen und malen) gibt. Zu den Besonderheiten der Wiewörter haben sie gelernt, dass sie zur Beschreibung von Lebewesen und Dingen verwenden werden können bzw. ein Sprecher mit ihnen angibt, wie es dem Jemanden geht, wie etwas vor sich geht oder geschiet. Vor den Pfingstferien, also Mitte der zweiten Klasse, hielt die Lehrerin ein Stunde mit dem Hauptaugenmerk auf die Umwandlung von Namenwörtern zu Tunwörtern. Als logische Schlussfolgerung setzt meine Stunde eine Woche später an diesem Punkt an. Da neben dem Tunwort, wie schon gesagt auch das Wiewort behandelt worden ist, lag mein Schwerpunkt auf der Umwandlung eines Namenwortes in ein Wiewort und umgekehrt. In den darauf folgenden Stunden wird die Lehrerin diese Umwandlungen noch einmal thematisieren und vertiefen. Allerdings sind dies auch schon die letzten im Lehrplan thematisierten Schwerpunkte zu den Namenwörtern. Danach wird sie auf Sammelnamen eingehen, sie in ihrer Funktion, die Funktionen der Zusammenfassung (z. B. Oberbegriffe wie Gemüse, Obst), der Ordnung (z. B. Spielzeug sortieren), der Orientierung (z. B. im Kaufhaus), untersuchen lassen.
Inhaltsverzeichnis
- Lehrplanbezug und Unterrichtszusammenhang
- Sachanalyse
- Didaktische Analyse
- Bedeutungen des Themas für die Schüler - Auswahlfaktoren des Inhalts
- Anthropogene und soziokulturelle Lernvoraussetzungen bei den Schülern
- Lernzielformulierungen
- Methodische Analyse: Artikulation des Unterrichts
- Nachbereitende Reflexion
- Literaturangabe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Unterrichtsstunde zielt darauf ab, die Schüler der zweiten Jahrgangsstufe im Verständnis der Umwandlung von Namenwörtern in Wiewörter und umgekehrt zu schulen. Die Stunde baut auf bereits erworbenem Wissen über Namen- und Wiewörter auf und vertieft das Verständnis ihrer jeweiligen Funktionen.
- Wiederholung und Festigung des Wissens über Namenwörter und Wiewörter
- Untersuchung der Umwandlungsmöglichkeiten zwischen Namenwörtern und Wiewörtern
- Verständnis der Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Namen- und Wiewörtern
- Anwendung des erworbenen Wissens in praktischen Übungen
- Förderung des sprachlichen Verständnisses und der sprachlichen Fähigkeiten
Zusammenfassung der Kapitel
Das Kapitel "Lehrplanbezug und Unterrichtszusammenhang" beschreibt den Kontext der Unterrichtsstunde innerhalb des Lehrplans und der vorherigen Unterrichtsstunden. Die "Sachanalyse" erläutert die grammatikalischen Grundlagen von Namenwörtern (Substantive) und Wiewörtern (Adjektive). Der Abschnitt "Didaktische Analyse" befasst sich mit der Bedeutung des Themas für die Schüler, den Lernvoraussetzungen und der Formulierung der Lernziele. Dieser Abschnitt behandelt die Komplexität des Themas und den Bezug zum bayerischen Lehrplan. Die "Methodische Analyse" (nicht im Auszug enthalten) würde den konkreten Ablauf der Stunde beschreiben. Die "Nachbereitende Reflexion" (nicht im Auszug enthalten) würde die Stunde kritisch auswerten.
Schlüsselwörter
Namenwörter, Wiewörter, Substantive, Adjektive, Wortarten, Grammatik, Rechtschreibung, Umwandlung, Lehrplan, Grundschule, zweite Klasse, Didaktik, Sprachliche Fähigkeiten.
- Quote paper
- Franziska Wilhelm (Author), 2006, Umwandlung - Namenwort in Wiewort, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/124277