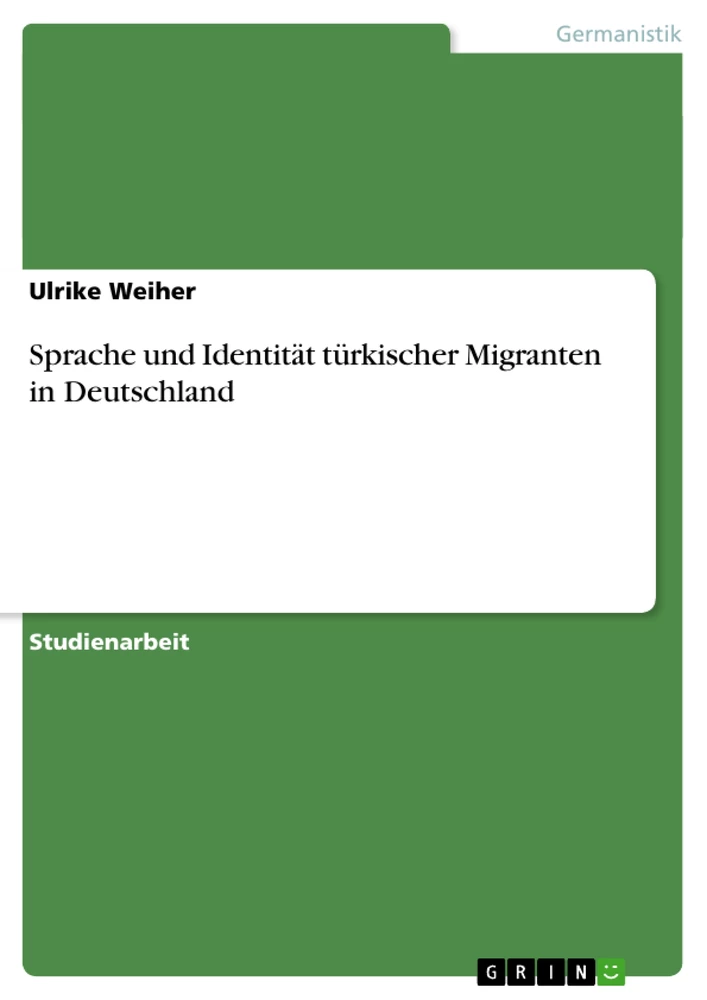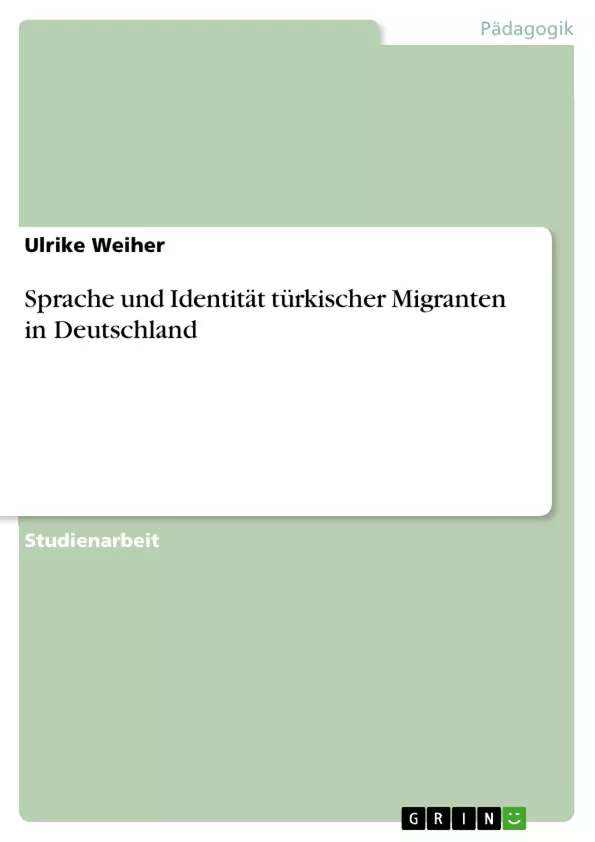Vor mehr als 50 Jahren kamen die ersten so genannten „Gastarbeiter“ nach Deutschland. Damals ging man nicht davon aus, dass viele von ihnen in Deutschland bleiben würden. Seit einiger Zeit aber steht fest: Deutschland ist ein Einwanderungsland. Derzeit leben etwa vier Millionen Migranten in der Bundesrepublik, dennoch ist ein Immigrant heute noch immer „nicht anerkannt, fremd im eigenen Land, kein Ausländer und doch ein Fremder.“ Diese Zeilen aus dem Lied Fremd im eigenen Land der Hip Hop Gruppe Advanced Chemistry macht deutlich, wie in Deutschland lebende Immigranten teilweise von der deutschen Bevölkerung gesehen werden. Auch bezüglich der politischen Maßnahmen hatten Migranten lange Zeit schlechtere Chancen im Rahmen der sozialen Stellung und am Arbeitsmarkt.
Ständig gibt es Diskussionen um Integration, also um die Eingliederung der Immigranten in die deutsche Gesellschaft. Man verlangt von Immigranten, sich zu integrieren, gleichzeitig aber wird ihnen nicht die Chance dazu gegeben. Im Gegenteil, noch immer werden sie nicht als Deutsche anerkannt, obwohl viele bereits in der zweiten, dritten und vierten Generation in Deutschland leben. Sie erfahren Diskriminierungen und Benachteiligungen in jeglichen Lebenslagen. Deutlich wird dies vor allem bei türkischen Migranten. Sie bilden die größte Gruppe der in Deutschland lebenden Zuwanderer und weisen zudem auch relativ große Unterschiede zur deutschen Kultur und Religion auf: „Einerseits haben türkische Jugendliche das Bedürfnis, sich durch das Bekenntnis der eigenen Zukunftsausrichtung nach Deutschland mit dem System der Bundesrepublik zu identifizieren, andererseits müssen sie mit dem auf sie projizierten Bild des -unerwünschten Fremden- leben.“ Welchen Einfluss das negative Fremdbild der Deutschen bezüglich der Migranten auf das Selbstbild der Migranten und somit auch auf die Integration hat und wie Immigranten auf diese vorwiegend negativen Zuschreibungen reagieren, möchte ich in dieser Hausarbeit näher untersuchen. Zudem soll der Zusammenhang von Sprache und Identität türkischer Migranten am Beispiel von Inken Keims Studie „Sozialkulturelle Selbst- und Fremdbestimmung als Merkmal kommunikativen Stils“ verdeutlicht werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Begriffsdefinition von Migration und Migrant
- 2. Die Geschichte der Migration in Deutschland
- Phase 1) „Anwerbephase“ 1955 bis 1973
- Phase 2) „Konsolidierung der Ausländerbeschäftigung“ 1973 bis Ende der 70er Jahre
- Phase 3) „Phase der Intergrationskonzepte“ ab Ende der 70er Jahre
- 3. Deutschland und seine türkischen Migranten
- 4. Migranten zwischen Integration und Ausgrenzung
- 4.1 Soziale Situation der Migranten
- 4.2 Stigmatisierung der Migranten als „Fremde“
- 5. Sprache und Identität türkischer Migranten in Deutschland
- 5.1 Zusammenhang von Sprache und Identität
- 5.2 Sprache türkischer Migranten
- 5.3 Identität türkischer Migranten
- 5.4 Validierung durch die Studie Keim „Die interaktive Konstitution der Kategorie ,,Migrant/Migrantin\" in einer Jugendgruppe ausländischer Herkunft: Sozialkulturelle Selbst- und Fremdbestimmung als Merkmal kommunikativen Stils.” von Inken Keim
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Einfluss des negativen Fremdbildes der deutschen Bevölkerung gegenüber Migranten auf das Selbstbild der Migranten und deren Integration. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Zusammenhang zwischen Sprache und Identität türkischer Migranten in Deutschland. Die Arbeit analysiert die soziale Situation und die Stigmatisierung türkischer Migranten, beleuchtet die Geschichte der Migration in Deutschland und nutzt die Studie von Inken Keim zur Veranschaulichung.
- Soziale Situation und Stigmatisierung türkischer Migranten in Deutschland
- Der Einfluss des negativen Fremdbildes auf das Selbstbild der Migranten
- Der Zusammenhang zwischen Sprache und Identität türkischer Migranten
- Die Geschichte der Migration in Deutschland und die Rolle der Gastarbeiter
- Integration und Ausgrenzung von Migranten in der deutschen Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und skizziert die Problematik der Integration von Migranten in Deutschland, insbesondere türkischer Migranten. Kapitel 1 definiert die Begriffe Migration und Migrant. Kapitel 2 beleuchtet die Geschichte der Migration nach Deutschland, von der Auswanderungswelle des 19. Jahrhunderts bis zum Zuwanderungsgesetz von 2005, unterteilt in drei Phasen: Anwerbung, Konsolidierung und Integrationskonzepte. Kapitel 3 fokussiert auf die Situation türkischer Migranten in Deutschland, ihre Anzahl und geographische Verteilung. Die Kapitel 4.1 und 4.2 befassen sich mit der sozialen Situation und der Stigmatisierung von Migranten als "Fremde". Kapitel 5.1 - 5.3 thematisieren den komplexen Zusammenhang zwischen Sprache und Identität türkischer Migranten.
Schlüsselwörter
Migration, Migranten, Integration, Ausgrenzung, Identität, Sprache, türkische Migranten, Deutschland, Gastarbeiter, Stigmatisierung, soziale Situation, Inken Keim, kommunikativer Stil, Selbst- und Fremdbestimmung.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Fokus hat die Arbeit zum Thema Sprache und Identität türkischer Migranten?
Die Arbeit untersucht den Einfluss des negativen Fremdbildes der deutschen Bevölkerung auf das Selbstbild und die Integration türkischer Migranten, wobei der Zusammenhang zwischen Sprache und Identität im Mittelpunkt steht.
In welche Phasen wird die Geschichte der Migration in Deutschland unterteilt?
Die Geschichte wird in drei Phasen unterteilt: die Anwerbephase (1955-1973), die Konsolidierung der Ausländerbeschäftigung (1973 bis Ende der 70er) und die Phase der Integrationskonzepte (ab Ende der 70er Jahre).
Was ist das Kernproblem der Integration laut dem Abstract?
Migranten werden oft zur Integration aufgefordert, erhalten aber gleichzeitig nicht die Chance dazu und erfahren Diskriminierung, obwohl sie bereits in der vierten Generation in Deutschland leben.
Welche Rolle spielt die Studie von Inken Keim in dieser Arbeit?
Die Studie dient zur Validierung des Zusammenhangs von Sprache und Identität am Beispiel des kommunikativen Stils in einer Jugendgruppe ausländischer Herkunft.
Wie werden türkische Migranten in der deutschen Gesellschaft oft wahrgenommen?
Sie werden oft als „fremd im eigenen Land“ oder als „unerwünschte Fremde“ stigmatisiert, was die Identitätsbildung erheblich erschwert.
Was sind die zentralen Schlüsselwörter dieser Untersuchung?
Zu den Schlüsselwörtern gehören Migration, Integration, Ausgrenzung, Identität, Sprache, Gastarbeiter und Stigmatisierung.
- Citar trabajo
- Ulrike Weiher (Autor), 2006, Sprache und Identität türkischer Migranten in Deutschland, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/124001