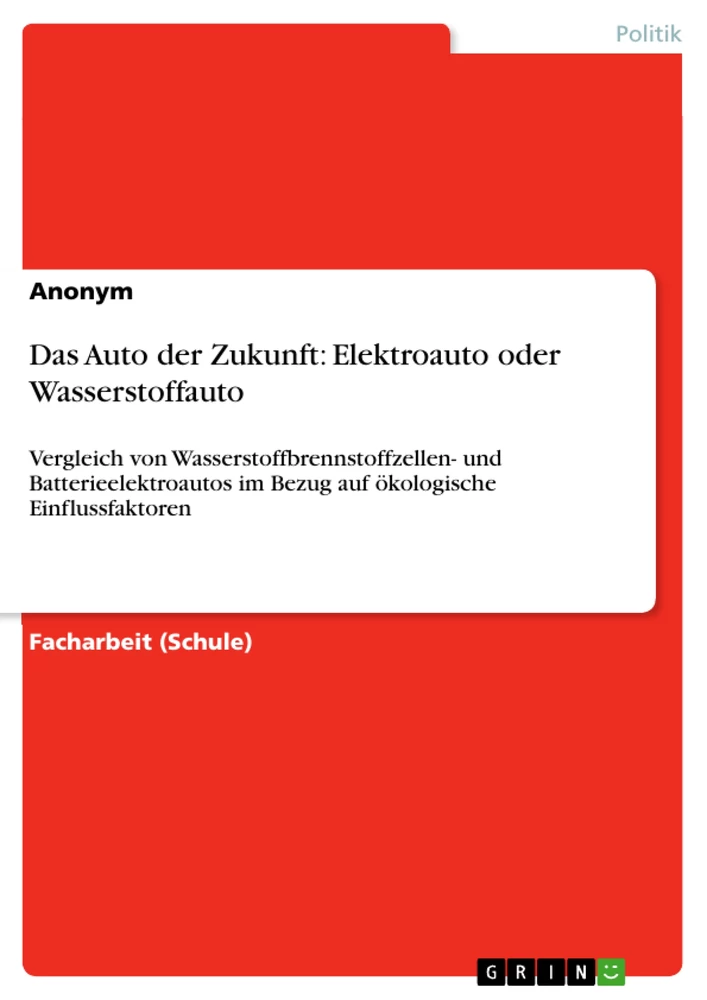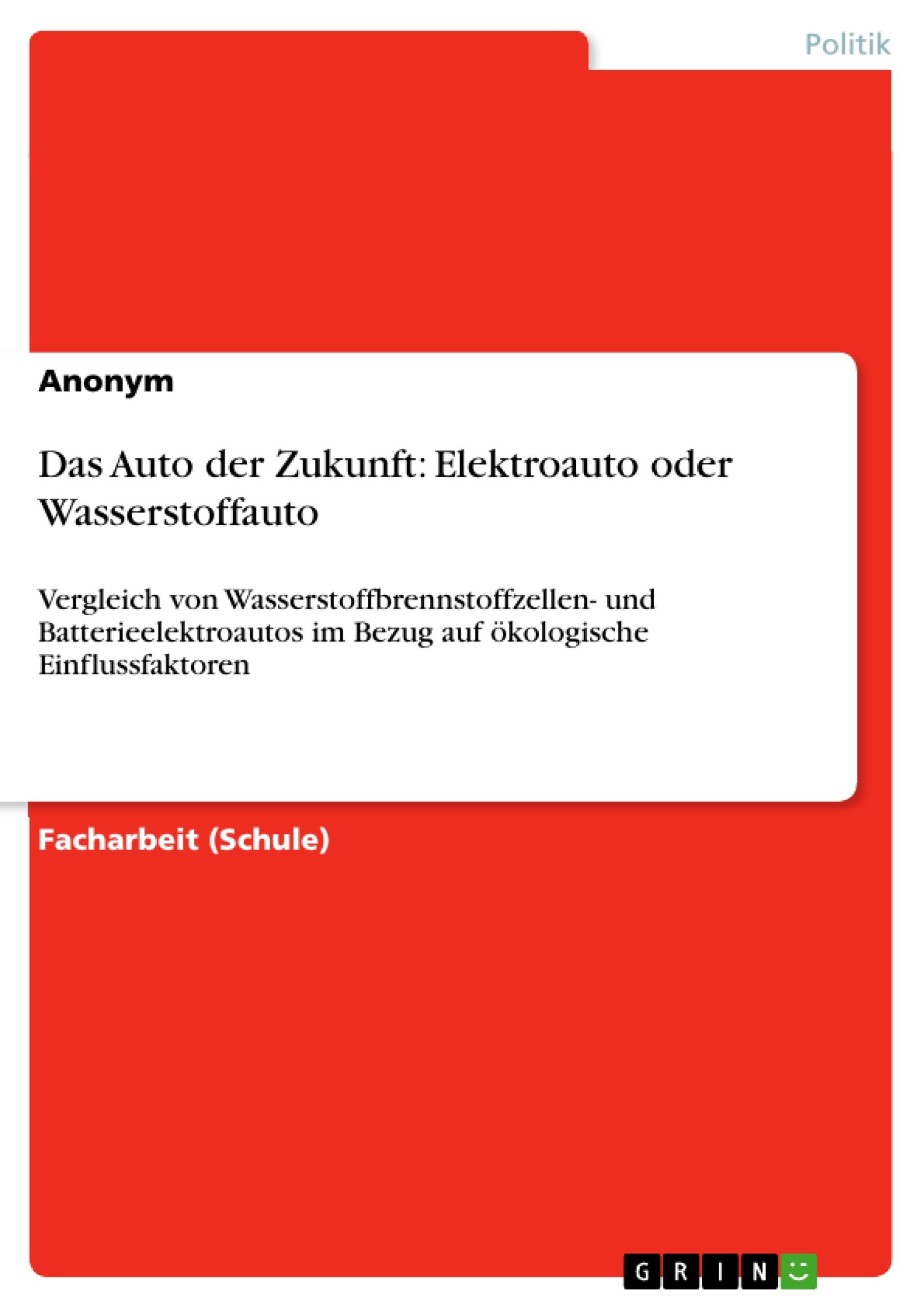Der anthropogene Klimawandel ist die größte Herausforderung unserer Zeit. Um den extremen Folgen entgegenzuwirken, muss der globale Ausstoß an Treibhausgasen reduziert werden. Der Verkehr in der EU ist für 30% der gesamten Kohlenstoffdioxidemissionen der europäischen Mitgliedsstaaten verantwortlich. Anders als Sektoren wie Energie, Wohngebäude, Industrie oder Land-, Forstwirtschaft und Fischerei, hat er im Vergleich zu 1990 seinen CO21-Ausstoß erhöht. 60,7% der CO2-Emissionen aus dem Verkehr stammen von Autos. Aufgrund der enormen Rolle des Verkehrs an den CO2-Emissionen beschäftigt sich diese Arbeit mit dem Vergleich zweier alternativer Antriebsformen zu den herkömmlichen Verbrennern: Zum einen dem mit Wasserstoffbrennstoffzellen betriebenen und zum anderen dem mit Lithium-Ionen-Akkumulatoren betriebenen Personenkraftwagen.
In der Bundesregierung scheint die Wahl der Antriebstechnologie der Zukunft bereits gefallen zu sein: „Batteriezellfertigung und autonomes Fahren sind hier zentral“ heißt es vom Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier in einer Pressemitteilung zum Thema „Zukunft der Mobilität“ in der die Brennstoffzelle nicht einmal namentlich erwähnt wird. Öffentliche Diskussionen über die Vor- und Nachteile von Elektroautos und Wasserstoffautos beziehen sich meist nur auf einzelne Aspekte oder setzen eine hohe Gewichtung auf die Nutzerfreundlichkeit. In dieser Arbeit werden diese Aspekte jedoch nicht betrachtet, denn diese soll die CO2-Bilanz beider Antriebstypen vergleichen. Dieser Vergleich soll die Frage beantworten, wie beide Antriebstechnologien funktionieren und welche der meistdiskutierten alternativen Antriebsformen, BEV und HFCEV, die emissionsärmere Wahl für die Zukunft der privaten personenbezogenen Mobilität sein wird.
Für meine Arbeit werde ich zunächst den Grund für die Nutzung von PKW erläutern. Darauf folgen voneinander unabhängige Darstellungen zu dem BEV und dem HFCEV, welche diese in einem Zwischenfazit mit den aktuellen Verbrennungsmotoren gegenüberstellen. Dafür werden viele Quellen zusammengetragen und verglichen, sowie eigene Berechnungen über die CO2-Bilanz der Technologien erstellt. Der Konsens der Quellen und eigener Berechnungen bildet dann die Datenbasis für das Fazit, welches zukünftige Handlungsempfehlungen enthalten soll.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Private personenbezogene Mobilität heute
- 2.1 Notwendigkeit des Autos
- 2.2 Fossile Energieträger als Kraftstoff der Mobilität
- 3 Batterieelektroauto
- 3.1 Funktionsweise des Antriebs eines Batterieelektroautos
- 3.2 Lithium-Ionen-Akkumulator
- 3.2.1 Funktionsweise eines Lithium-Ionen-Akkumulators
- 3.2.2 Verlauf der Entwicklung von Lithium-Ionen-Akkumulatoren
- 3.2.3 Beschaffung der nötigen Ressourcen
- 3.3 Auswirkungen der Elektromobilität auf das deutsche Stromnetz
- 3.4 CO2-Bilanz über den gesamten Lebenszyklus eines Batterieelektroautos
- 4 Wasserstoffbrennstoffzellenautos
- 4.1 Funktionsweise des Antriebs eines Wasserstoffbrennstoffzellenautos
- 4.2 Brennstoffzelle
- 4.2.1 Funktionsweise einer Brennstoffzelle
- 4.2.2 Verlauf der Entwicklung besserer Brennstoffzellen
- 4.2.3 Verwendung und Beschaffung der nötigen Ressourcen
- 4.3 Wasserstoff als Treibstoff
- 4.3.1 Vorkommen und heutige Produktionsverteilung
- 4.3.2 Herstellung durch Wasserelektrolyse
- 4.3.3 Transport und Lagerung
- 4.4 CO2-Bilanz über den gesamten Lebenszyklus eines Wasserstoffbrennstoffzellenautos
- 5 Vergleich der alternativen Antriebstechnologien als Ersatz heutiger privater personenbezogener Mobilitätsformen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit zielt darauf ab, die ökologische Eignung von Batterieelektroautos (BEV) und Wasserstoffbrennstoffzellenautos (HFCEV) als Alternativen zu Verbrennungsmotoren zu bewerten. Der Fokus liegt auf einem rein ökologischen Vergleich, wobei subjektive Aspekte wie Komfort außen vor bleiben. Die CO2-Bilanz beider Antriebstechnologien bildet das zentrale Bewertungskriterium.
- Vergleich der Funktionsweise von BEV und HFCEV
- Analyse der CO2-Bilanz über den gesamten Lebenszyklus beider Technologien
- Bewertung der Ressourcenbeschaffung für BEV und HFCEV
- Auswirkungen der Elektromobilität auf das deutsche Stromnetz
- Abschätzung der ökologisch besseren Antriebstechnologie für die Zukunft
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung stellt den anthropogenen Klimawandel und die daraus resultierende Notwendigkeit der Reduktion von Treibhausgasemissionen dar. Sie betont die Bedeutung des Verkehrssektoren und die Rolle des Autos als Hauptverursacher von CO2-Emissionen. Die Arbeit kündigt einen Vergleich zwischen Batterieelektroautos und Wasserstoffbrennstoffzellenautos an, wobei der Fokus auf der CO2-Bilanz liegt. Die einleitenden Worte legen dar, dass die Bundesregierung bereits eine Entscheidung für die Batterietechnologie gefällt zu haben scheint und diese Arbeit ein Gegengewicht durch einen objektiveren Vergleich liefern soll.
2 Private personenbezogene Mobilität heute: Dieses Kapitel beleuchtet die Notwendigkeit des Autos als Mittel der privaten Fortbewegung. Es diskutiert die Bedeutung von Mobilität im modernen Leben und die gesellschaftliche Akzeptanz des PKW als Statussymbol. Obwohl der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) als Alternative im urbanen Raum besteht, wird die Dominanz des PKW als Verkehrsmittel bestätigt.
3 Batterieelektroauto: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Funktionsweise des Antriebs eines Batterieelektroautos, fokussiert sich auf den Lithium-Ionen-Akku und dessen Funktionsweise, Entwicklung sowie die Ressourcenbeschaffung. Darüber hinaus wird die Auswirkung der Elektromobilität auf das deutsche Stromnetz und die CO2-Bilanz über den gesamten Lebenszyklus eines BEV analysiert. Die verschiedenen Unterkapitel beleuchten die einzelnen Aspekte der Technologie und ihren Einfluss auf die Umwelt.
4 Wasserstoffbrennstoffzellenautos: Ähnlich wie Kapitel 3, befasst sich dieses Kapitel mit der Funktionsweise des Antriebs eines Wasserstoffbrennstoffzellenautos. Im Fokus steht die Brennstoffzelle, ihre Funktionsweise, Entwicklung und der benötigte Wasserstoff als Treibstoff. Das Kapitel analysiert das Vorkommen von Wasserstoff, seine Produktion, Transport, Lagerung und die CO2-Bilanz über den gesamten Lebenszyklus eines HFCEV. Die Unterschiede zwischen der Herstellung und der Anwendung von Wasserstoff im Vergleich zum BEV werden deutlich herausgearbeitet.
Schlüsselwörter
Batterieelektroauto, Wasserstoffbrennstoffzellenauto, CO2-Bilanz, Elektromobilität, Lebenszyklusanalyse, Treibhausgase, Ressourcen, Nachhaltigkeit, Verkehr, Mobilität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Ökologischer Vergleich von Batterieelektroautos und Wasserstoffbrennstoffzellenautos
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht die ökologische Eignung von Batterieelektroautos (BEV) und Wasserstoffbrennstoffzellenautos (HFCEV) als Alternativen zu Verbrennungsmotoren. Der Fokus liegt auf einem rein ökologischen Vergleich, der die CO2-Bilanz beider Antriebstechnologien als zentrales Bewertungskriterium nutzt.
Welche Aspekte werden im Vergleich betrachtet?
Der Vergleich umfasst die Funktionsweise von BEV und HFCEV, die Analyse der CO2-Bilanz über den gesamten Lebenszyklus beider Technologien, die Bewertung der Ressourcenbeschaffung, die Auswirkungen der Elektromobilität auf das deutsche Stromnetz und eine abschliessende Einschätzung der ökologisch besseren Antriebstechnologie für die Zukunft.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Private personenbezogene Mobilität heute, Batterieelektroauto, Wasserstoffbrennstoffzellenauto und ein Kapitel zum Vergleich der alternativen Antriebstechnologien. Jedes Kapitel enthält detaillierte Informationen zu den jeweiligen Aspekten der Technologie und deren Umweltauswirkungen.
Was wird im Kapitel "Private personenbezogene Mobilität heute" behandelt?
Dieses Kapitel beleuchtet die Notwendigkeit des Autos als Verkehrsmittel, seine gesellschaftliche Akzeptanz und die Dominanz des PKW trotz Alternativen wie dem öffentlichen Nahverkehr.
Was wird im Kapitel "Batterieelektroauto" behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Funktionsweise des Antriebs, den Lithium-Ionen-Akku (Funktionsweise, Entwicklung, Ressourcenbeschaffung), die Auswirkungen der Elektromobilität auf das deutsche Stromnetz und die CO2-Bilanz über den gesamten Lebenszyklus eines BEV.
Was wird im Kapitel "Wasserstoffbrennstoffzellenauto" behandelt?
Ähnlich wie Kapitel 3, befasst sich dieses Kapitel mit der Funktionsweise des Antriebs, der Brennstoffzelle (Funktionsweise, Entwicklung, benötigte Ressourcen), dem Wasserstoff als Treibstoff (Vorkommen, Produktion, Transport, Lagerung) und der CO2-Bilanz über den gesamten Lebenszyklus eines HFCEV.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Batterieelektroauto, Wasserstoffbrennstoffzellenauto, CO2-Bilanz, Elektromobilität, Lebenszyklusanalyse, Treibhausgase, Ressourcen, Nachhaltigkeit, Verkehr, Mobilität.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Arbeit liefert einen objektiven Vergleich der ökologischen Eignung von BEV und HFCEV, mit dem Fokus auf der CO2-Bilanz über den gesamten Lebenszyklus, und bietet eine fundierte Grundlage zur Bewertung der ökologisch besseren Antriebstechnologie für die Zukunft. (Die konkrete Schlussfolgerung ist im bereitgestellten Text nicht explizit genannt und muss aus der vollständigen Arbeit entnommen werden.)
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke bestimmt und dient der Analyse von Themen im Bereich der Elektromobilität und Nachhaltigkeit.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2021, Das Auto der Zukunft: Elektroauto oder Wasserstoffauto, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1239992