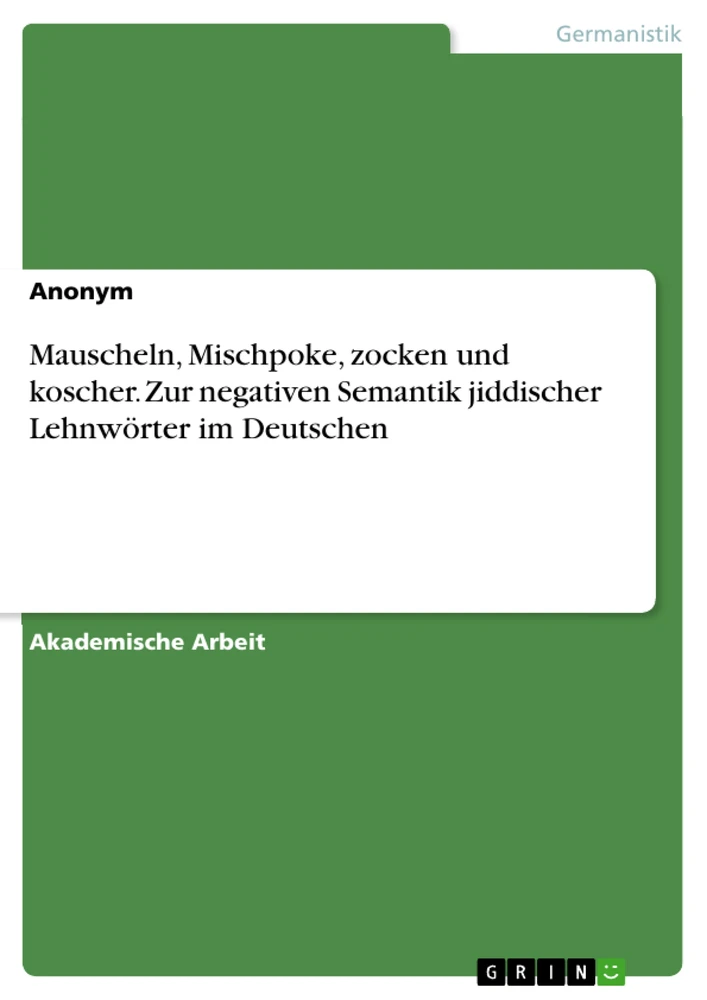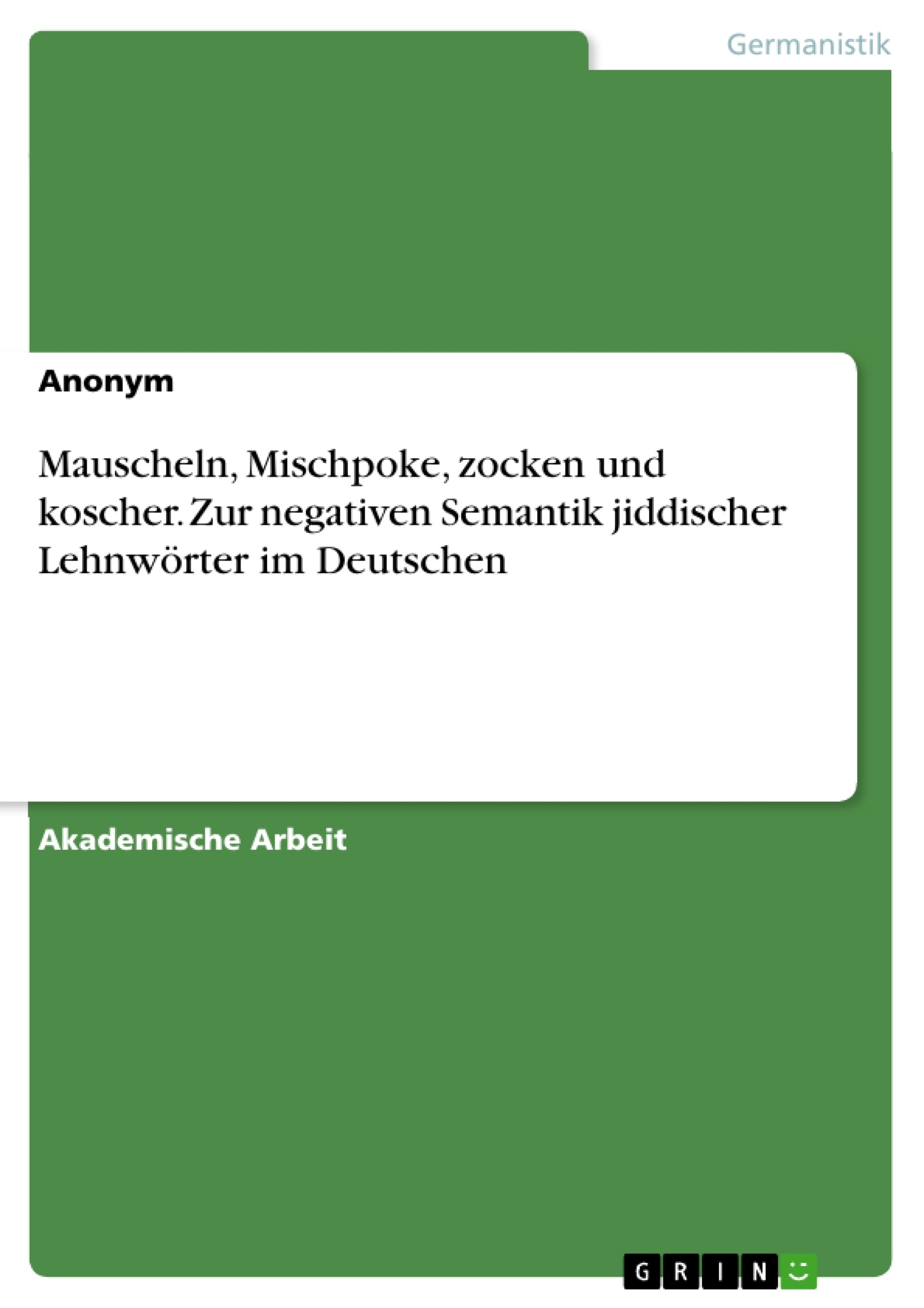Die nachfolgende Arbeit untersucht insbesondere die „abgewandelte, negative“ Semantik der jiddischen Lehnwörter mauscheln, Mischpoke, zocken und koscher. Dabei soll der Fokus darauf gelegt werden, welche Bedeutungskomponenten für das jeweilige Lehnwort im Deutschen Referenz Korpus (DeReKo) gefunden werden können.
Mauscheln, zocken, malochen, pleite, Mischpoke. Alle diese Wörter wurden aus dem Jiddischen in die deutsche Sprache entlehnt und teilen eine auffällige Gemeinsamkeit: ihre negative, teils pejorative Semantik. Diese wurde ihnen durch die Entlehnung in die deutsche Sprache zugeschrieben.
Die ersten jiddischen Worte fanden Ende des 15. Jahrhunderts Einzug in deutsche Texte. Der Sprachkontakt betraf nicht nur die obere soziale Schicht sondern auch die vagantes, eine Bezeichnung für fahrende Studenten, die unter anderem Diebes- und Gauner-Kreisen angehörten. Jiddische Wörter wurden in deren Jargon und dadurch in das Rotwelsche aufgenommen. Der religiös motivierte Antisemitismus gegen Juden trug dazu bei, dass die Semantik der Wörter teilweise stark ins Negative verschoben wurde. Im 18. Jahrhundert wurden westjiddische Begriffe zudem von Christen in Parodien und Polemiken verwendet.
Die Propaganda der Nationalsozialisten verstärkte die negative Haltung gegenüber dem Jiddischen – sie sahen in den entlehnten jiddischen Wörtern des Rotwelschen einen Beweis für die Kriminalität der Juden. Nicht zuletzt glaubten sie an die Verhunzung und „Verstümmelung“ (Schleicher 2007) der deutschen Sprache durch den Einfluss der Juden. Sie bezeichneten den Klang des Jiddischen als mauscheln und als jüdeln/jiddeln.
Auch heute wird auf die problematische Verwendung von Wörtern jiddischen Ursprungs hingewiesen. In dem Artikel „Antisemitismus in der Sprache Mauscheln, Mischpoke, Semit*innen: Wie judenfeindlich ist unsere Sprache?“ (Die Zeit 2020) unterscheidet Ronen Steinke zwischen „guten“ und „unguten jiddischen Slangwörtern“. Der Unterschied bestehe darin, dass die Wörter so verwendet werden, wie sie Jiddischsprechende verwenden würden, oder dass sie „im Deutschen eine abgewandelte, negative Bedeutung haben.“ (Die Zeit 2020)
Inhaltsverzeichnis
- Einführende Überlegungen
- Linguistische Analyse
- Mauscheln
- „Mauscheln in Hinterzimmern“
- Betrügen und Tricksen
- Mischpoke
- „Wir sind keine Mischpoke, sondern das mündige Volk.“
- Zocken
- „Zocken im Netz“
- Wortfeld „eine höllische Sucht“
- „Gnadenloses“ Abzocken
- Koscher
- „Nicht ganz koscher“
- Mauscheln
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die negative Semantik jiddischer Lehnwörter im Deutschen, insbesondere die Wörter „mauscheln“, „Mischpoke“, „zocken“ und „koscher“. Die Zielsetzung ist die Analyse der Bedeutungskomponenten dieser Wörter im Deutschen Referenzkorpus (DeReKo), um den Wandel und die Konnotationen ihrer Bedeutung zu beleuchten.
- Negative Konnotationen jiddischer Lehnwörter im Deutschen
- Sprachlicher Antisemitismus und die Beeinflussung der Wortbedeutung
- Entwicklung der Bedeutung von „mauscheln“, „Mischpoke“, „zocken“ und „koscher“ im Laufe der Zeit
- Analyse der Kookkurrenzen im DeReKo
- Der Einfluss des historischen Kontextes auf die Semantik der Lehnwörter
Zusammenfassung der Kapitel
Einführende Überlegungen: Der einführende Abschnitt legt die Grundlage der Arbeit dar. Er beschreibt die negative Semantik verschiedener jiddischer Lehnwörter im Deutschen, wie z.B. „mauscheln“, „zocken“, „malochen“ und „Mischpoke“, und ihre Entstehung im Kontext des Sprachkontakts zwischen Jiddisch und Deutsch. Es wird auf den Einfluss von Antisemitismus und die Verwendung dieser Wörter in verschiedenen historischen Kontexten, inklusive der nationalsozialistischen Propaganda, hingewiesen. Der Abschnitt betont die problematische Verwendung dieser Wörter heute und verweist auf den Unterschied zwischen der ursprünglichen Bedeutung und der negativ konnotierten Verwendung im modernen Deutsch. Die Arbeit fokussiert sich auf eine detaillierte Analyse der Wörter „mauscheln“, „Mischpoke“, „zocken“ und „koscher“ im DeReKo.
Linguistische Analyse: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der Analyse, die auf dem Deutschen Referenzkorpus (DeReKo) und dem Kookkurrenz-Tool von COSMAS II basiert. Es werden sowohl qualitative als auch quantitative Methoden zur Analyse der semantischen Aspekte der ausgewählten Lehnwörter angewendet. Die Auswertung einer zufälligen Stichprobe von 200 Treffern aus dem DeReKo liefert die Grundlage für die detaillierte Untersuchung der Bedeutungskomponenten jedes einzelnen Wortes. Die Verwendung des LLR-Werts zur Bestimmung der Signifikanz von Kookkurrenzen wird ebenfalls erläutert. Der Anhang enthält exemplarische Beispiele aus dem Korpus.
2.1 Mauscheln: Dieses Unterkapitel befasst sich mit der Etymologie und der Bedeutung des Wortes „mauscheln“. Es wird der historische Sprachwandel von der ursprünglichen Bedeutung über rotwelsche Bezeichnungen bis hin zur heutigen Verwendung im Deutschen analysiert. Der Fokus liegt auf der Entwicklung der negativen Konnotation des Wortes. Durch die Analyse von Korpusdaten wird die Verbreitung und die Verwendung von „mauscheln“ im Kontext verschiedener Ausdrucksweisen aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Jiddische Lehnwörter, negative Semantik, Antisemitismus, Sprachwandel, DeReKo, COSMAS II, Kookkurrenzen, Mauscheln, Mischpoke, Zocken, Koscher, historischer Kontext, Bedeutungskomponenten.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse Jiddischer Lehnwörter
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit analysiert die negative Semantik von vier jiddischen Lehnwörtern im Deutschen: „mauscheln“, „Mischpoke“, „zocken“ und „koscher“. Sie untersucht die Bedeutungskomponenten dieser Wörter, ihren Wandel im Laufe der Zeit und die Einflüsse von Antisemitismus auf ihre Konnotationen.
Welche Methoden werden in der Analyse verwendet?
Die Analyse basiert auf dem Deutschen Referenzkorpus (DeReKo) und dem Kookkurrenz-Tool von COSMAS II. Es werden sowohl qualitative als auch quantitative Methoden angewendet, inklusive der Auswertung einer Stichprobe von 200 Treffern im DeReKo und der Verwendung des LLR-Werts zur Bestimmung der Signifikanz von Kookkurrenzen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die negativen Konnotationen der untersuchten jiddischen Lehnwörter, den Einfluss von sprachlichem Antisemitismus auf deren Bedeutung, die Entwicklung ihrer Bedeutung im Zeitverlauf, die Analyse ihrer Kookkurrenzen im DeReKo und den Einfluss des historischen Kontextes auf ihre Semantik.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in einen einführenden Teil, eine linguistische Analyse (mit Unterkapiteln zu den einzelnen Lehnwörtern), und ein Fazit. Der einführende Teil beschreibt die negative Semantik der Lehnwörter und ihren historischen Kontext, während die linguistische Analyse die Methodik und die Ergebnisse der Korpusanalyse detailliert darstellt. Jedes Unterkapitel der linguistischen Analyse fokussiert sich auf ein spezifisches Lehnwort.
Welche konkreten Aspekte von „mauscheln“ werden untersucht?
Das Unterkapitel zu „mauscheln“ untersucht die Etymologie und den historischen Sprachwandel des Wortes, von der ursprünglichen Bedeutung bis zu seiner heutigen, negativ konnotierten Verwendung. Die Analyse von Korpusdaten zeigt die Verbreitung und Verwendung des Wortes in verschiedenen Kontexten.
Wo findet man Beispiele aus dem Korpus?
Exemplarische Beispiele aus dem Korpus sind im Anhang der Arbeit zu finden.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Jiddische Lehnwörter, negative Semantik, Antisemitismus, Sprachwandel, DeReKo, COSMAS II, Kookkurrenzen, Mauscheln, Mischpoke, Zocken, Koscher, historischer Kontext, Bedeutungskomponenten.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Zielsetzung ist die Analyse der Bedeutungskomponenten der vier ausgewählten jiddischen Lehnwörter im Deutschen Referenzkorpus (DeReKo), um den Wandel und die Konnotationen ihrer Bedeutung zu beleuchten.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2022, Mauscheln, Mischpoke, zocken und koscher. Zur negativen Semantik jiddischer Lehnwörter im Deutschen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1239225