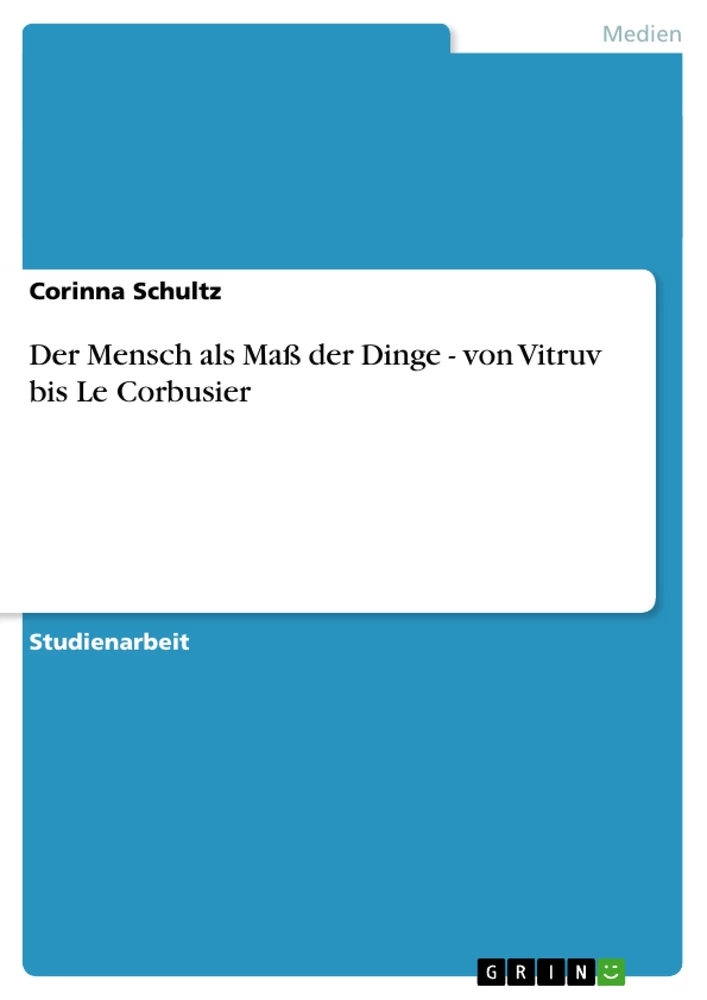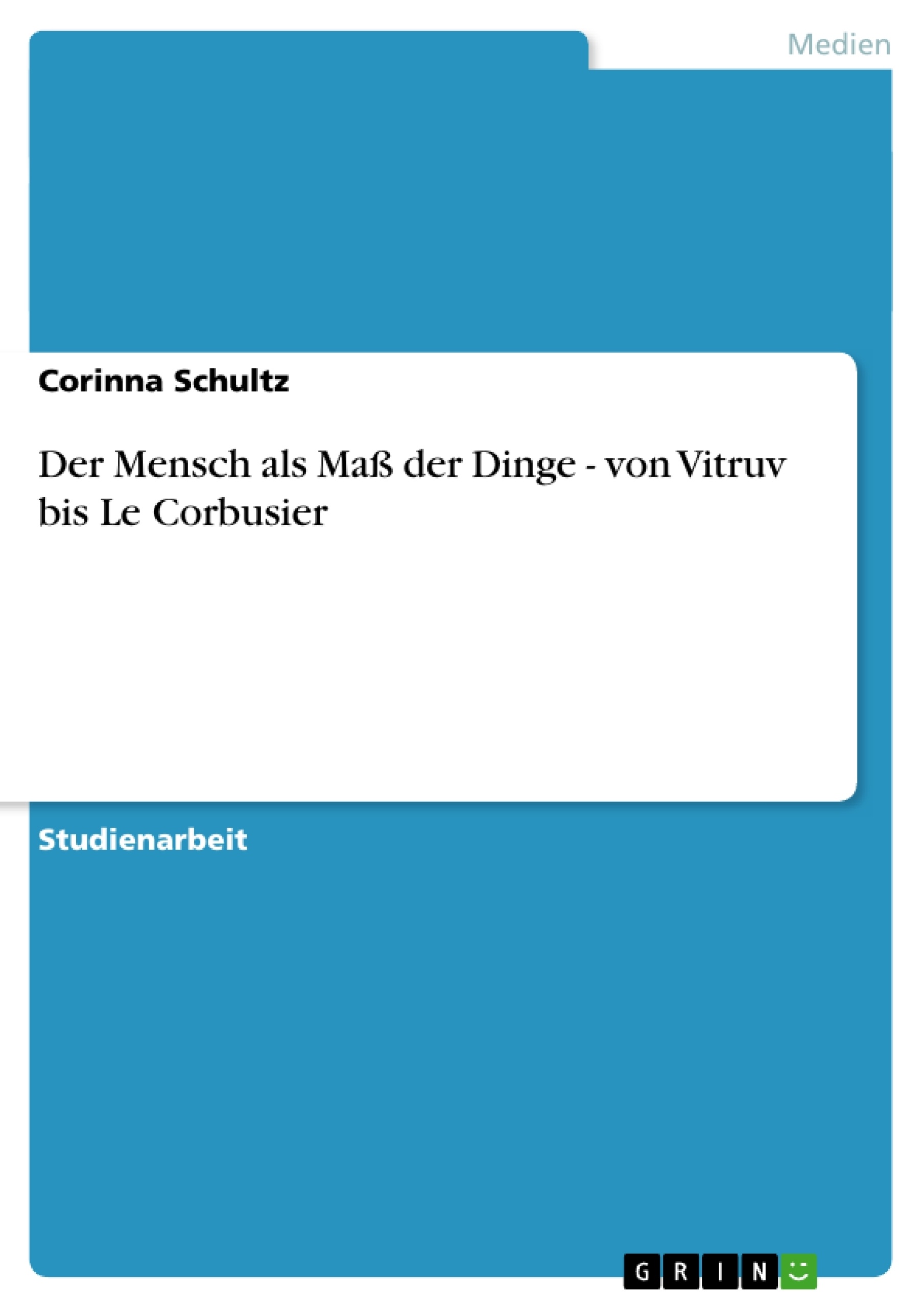Dass der Mensch seine Gestalt, sein Denken, Fühlen und Handeln auf andere Dinge überträgt, ob nun auf abstrakte oder direkte Art und Weise, scheint ein ur-menschliches Vorgehen zu sein. Anthropomorphe Vorstellungen sind in der abendländischen Kultur zu allen Zeiten auffindbar. In der Sprache, der Literatur, in politischen Theorien, in der Philosophie, der Theologie und der bildenden Kunst treten diese Grundmuster menschlichen Denkens auf. Je weiter man schließlich „zeitlich zurückgeht, desto mehr Anthropomorphismen sind zu finden, ebenso mehr irrtümliche Erklärungen. Ihre außerordentliche Verbreitung verdankt die Menschenanalogie wohl dem Verfahren, unbekannte neue Dinge oder auf andere Weise Unsagbares durch etwas Vertrautes auszudrücken, in einer Metapher also – nichts liegt näher, als dabei auf den menschlichen Körper zurückzugreifen.“(1)
Ein Maß- und Proportionssystem auf der Grundlage des menschlichen Körper zu entwickeln durchzieht die gesamte Entwicklung der Künste, sowohl Architektur und Malerei als auch die Bildhauerei. Die im folgenden besprochenen Künstler und Architekten sollen zeitbezogene Beispiele dafür geben, wie mit dem Gedanken, den Mensch als das Maß aller Dinge einzusetzen, umgegangen wird.
(1)Frings, 1998. S.11.
Inhaltsverzeichnis
- Der Mensch als Maß
- Vitruv und die Architekturtheorie
- Die Symbolik des menschlichen Körpers im Mittelalter
- In der Renaissance
- Leon Battista Alberti
- Leonardo da Vinci
- Albrecht Dürer und die ideale Schönheit in der deutschen Renaissance
- Giorgione und die Malerei
- Das 17., 18. und 19. Jahrhundert
- Le Corbusier und der Mensch in der Moderne
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Verwendung des menschlichen Körpers als Maßstab in der Architektur und Kunstgeschichte, von der Antike bis zur Moderne. Sie analysiert, wie der anthropomorphe Ansatz die Architekturtheorie und künstlerische Praxis beeinflusst hat und wie sich dieser Einfluss im Laufe der Zeit verändert hat.
- Der anthropomorphe Ansatz in der Architekturtheorie
- Die Entwicklung des menschlichen Proportionskanons
- Der Einfluss klassischer Autoren wie Vitruv
- Die Rolle der Mathematik in der Gestaltung
- Der Wandel des anthropomorphen Denkens in der Moderne
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die grundlegende Idee des Menschen als Maß aller Dinge und seine Bedeutung in verschiedenen kulturellen Bereichen. Kapitel zwei behandelt Vitruvs Architekturtheorie und die Bedeutung des homo vitruvianus. Kapitel drei fokussiert auf die Symbolik des menschlichen Körpers im Mittelalter, insbesondere im Kontext von Kirchenbauten. Kapitel vier analysiert die Renaissance, mit Unterkapiteln zu Alberti, Da Vinci, Dürer und Giorgione, und deren jeweilige Auseinandersetzung mit dem menschlichen Körper als Maßstab. Kapitel fünf gibt einen Überblick über die Entwicklungen im 17., 18. und 19. Jahrhundert, während Kapitel sechs Le Corbusier und den Modulor im Kontext der modernen Architektur behandelt.
Schlüsselwörter
Anthropomorphismus, Architekturtheorie, Vitruv, menschliche Proportionen, Renaissance, Modulor, Le Corbusier, Ideal Schönheit, Mathematik in der Kunst, Baukunst.
- Quote paper
- M.A. Corinna Schultz (Author), 2007, Der Mensch als Maß der Dinge - von Vitruv bis Le Corbusier, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/123776