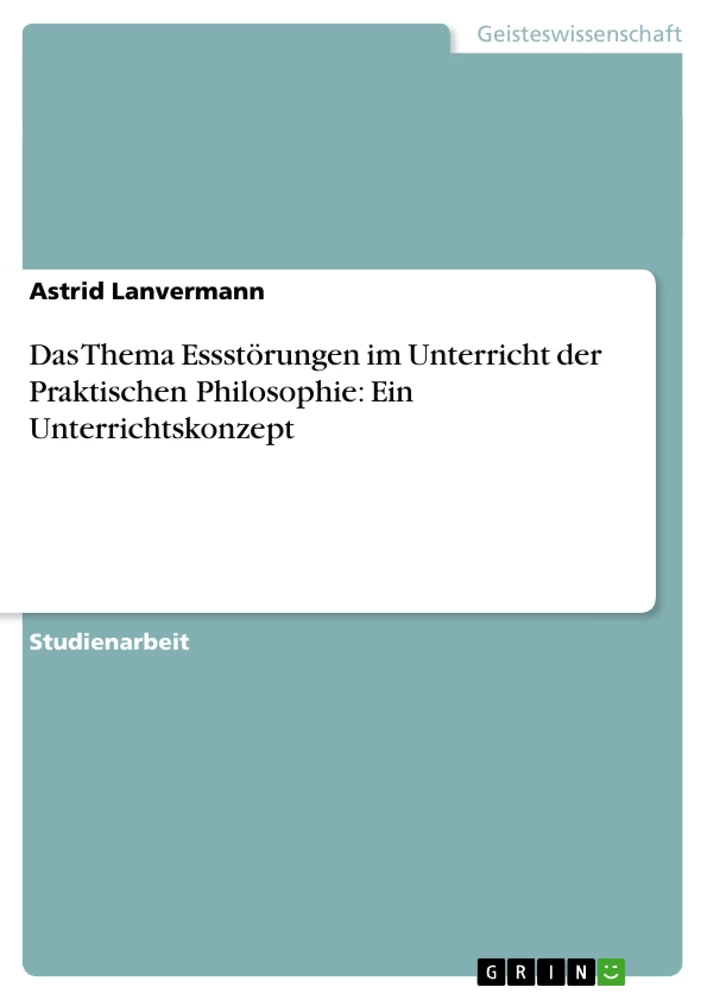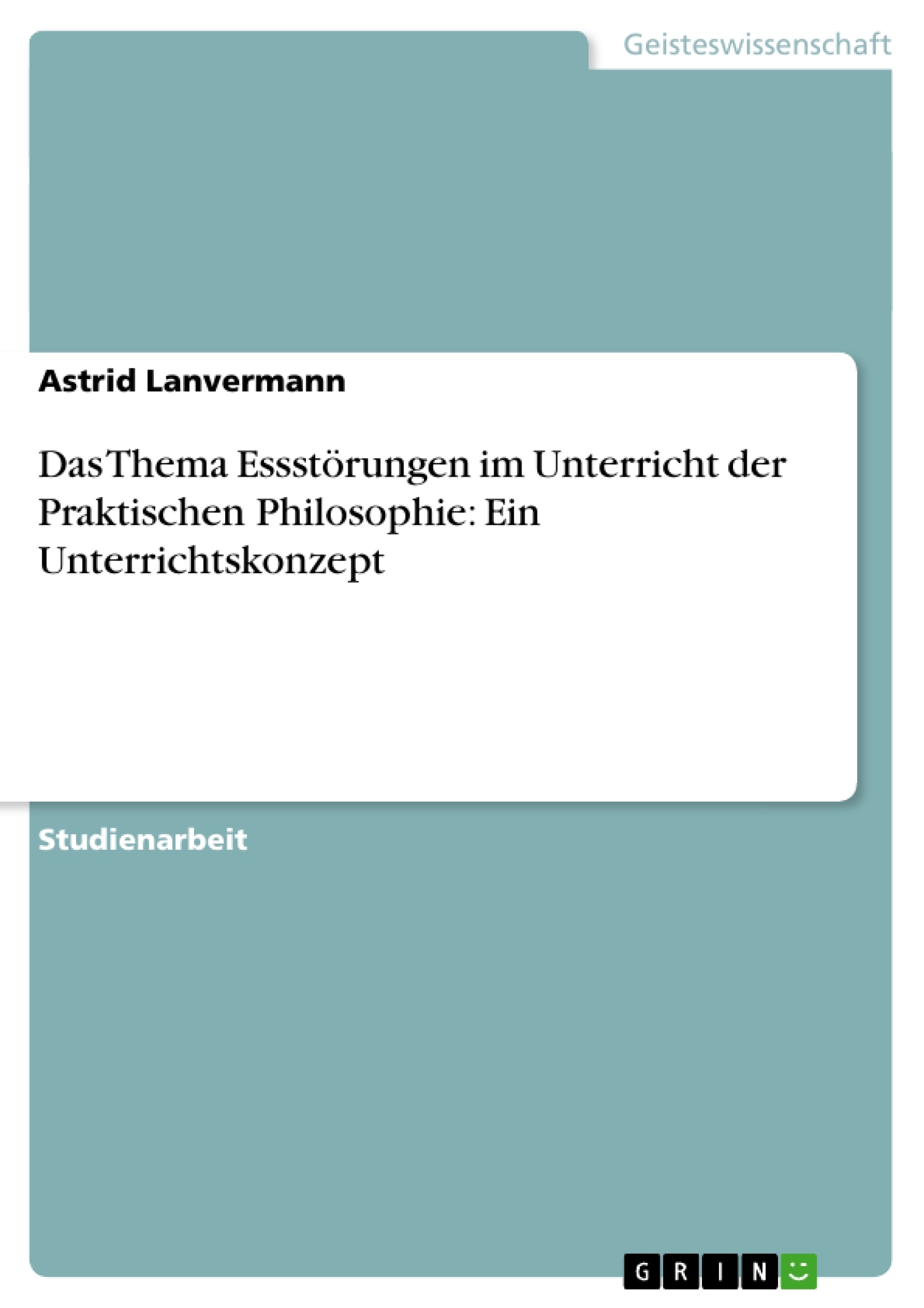Essen und Trinken sind natürliche Bedürfnisse, die in den industriellen Überflussgesellschaften jedoch nicht mehr als Solche erfahren werden. Die kulturellen Überformungen bezüglich der Essenszeiten, der kulturell abhängigen Lebensmittel und der normierten Essensmengen, die gegessen werden, überdecken die Tatsache, dass Essen und Trinken physiologische Notwendigkeiten sind. Das Natürliche des Essens geht verloren. Es kommt häufiger zu Essstörungen als früher, als der Einzelne noch den Weg seiner Mahlzeiten von der Wahl der Lebensmittel über den Vorgang des Kochens hin zum Essen selbst bestimmt hat.
Diese Essstörungen, welche in verschiedenen Formen auftreten können, sind heute ein zunehmend gerade Schüler in der Pubertätszeit betreffendes Problem. Daher ist eine behutsame Behandlung dieses Themenkomplexes in der Schule notwendig. Es gibt verschiedene Herangehensweisen an diese Problematik. Eine mögliche Variante soll an dieser Stelle expliziert werden.
Die Kernfrage bezieht sich dabei auf das eigene Selbst, sowie den eigenen Leib und die eigene Seele. Der Ausgangspunkt muss dabei die Erfahrungswelt des Schülers sein. Einige Fragen, die bei einem ersten Brainstorming aufkommen können, sind die nach dem Gefühl des Hungers, des eigenen Geschmacks oder auch nach den eigenen Essgewohnheiten. Diesen Fragen der personalen Perspektive entsprechend, wird die vorliegende Arbeit zunächst auf die Entwicklung der (westlichen) Esskultur, bis hin zu den heutigen Essgewohnheiten, eingehen. Hier wird auch die gesellschaftliche Perspektive integriert – die Industrialisierung der Lebensmittel, die Internationalisierung des Lebensmittelhandels, die Rationalisierung der Essenseinnahme etc. Die personalen und gesellschaftlichen Bedingungen des eigenen Essverhaltens werden auf diese Weise näher beleuchtet.
In einem zweiten Schritt wird auf den Einfluss der Ernährung auf den Leib eingegangen. Welche Gefühle weckt das Essen und welchen Einfluss hat es auf den Körper? Von diesen Fragen aus geht es weiter zur wissenschaftlichen Betrachtung des gestörten Essverhaltens. Zu nennen wären hier die Anorexie, die Bulimie, die Adipositas und das Binge- eating. Konkret dargestellt werden an dieser Stelle jedoch nur die beiden ersten Formen. Eine angemessene Behandlung aller vier Formen der Essstörungen kann aufgrund des Umfanges dieser Arbeit nicht erfolgen. In einer Unterrichtsreihe wären sie jedoch auf jeden Fall zu behandeln.
Der letzte Schritt dieser Arbeit geht auf die ideengeschichtliche Perspektive ein. Eine Sensibilisierung bezüglich der Themen Essen und Essstörungen erfolgt hier über die Betrachtung zweier leibphilosophischer Positionen, welche alternative Blickwinkel bieten können. Das Ziel der Unterrichtsreihe muss es dabei sein, den Schülern ein Gefühl von Verantwortung für den eigenen Körper zu vermitteln und alternative Lebenswege aufzuweisen. Am Ende der Reihe liegt es dann am Schüler - bzw. im Fall dieser Arbeit - am Leser selbst zu entscheiden, ob eine dieser Alternativen für ihn praktikabel ist oder nicht. Die Entscheidung für sich selbst zu sorgen oder nicht, liegt allein beim Individuum und kann – und darf – von Außen lediglich angeregt, jedoch keinesfalls erzwungen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Die Entwicklung der Esskultur
- Die Essstörungen
- Anorexia nervosa
- Bulimia nervosa
- Die leibphilosophische Betrachtung
- Robert Gernhardt: Mein Körper
- Der Dualismus
- Der Monismus
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit entwickelt ein Unterrichtskonzept zum Thema Essstörungen für den praktischen Philosophie-Unterricht. Ziel ist es, Schüler für die Problematik zu sensibilisieren und ihnen ein Gefühl der Verantwortung für den eigenen Körper zu vermitteln, sowie alternative Lebensweisen aufzuzeigen.
- Entwicklung der westlichen Esskultur und deren Einfluss auf Essstörungen
- Beschreibung verschiedener Essstörungen (Anorexia nervosa und Bulimia nervosa)
- Leibphilosophische Betrachtung des Körper-Geist-Verhältnisses (Dualismus und Monismus)
- Analyse von Robert Gernhardts Gedicht "Mein Körper" im Kontext des Leib-Seele-Problems
- Reflexion über verschiedene Perspektiven im Umgang mit Essstörungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beschreibt die Problematik von Essstörungen, insbesondere im Kontext des Übergangs von natürlichen Bedürfnissen zu kulturell geprägten Essgewohnheiten. Der Hauptteil beleuchtet zunächst die Entwicklung der westlichen Esskultur, fokussiert auf Aspekte, die Essstörungen begünstigen. Anschließend werden Anorexia nervosa und Bulimia nervosa hinsichtlich ihrer Symptome und Ursachen dargestellt. Der leibphilosophische Teil analysiert Robert Gernhardts Gedicht "Mein Körper" und diskutiert dualistische und monistische Ansätze im Verhältnis von Körper und Geist. Die Kapitel zum Fazit werden hier nicht zusammengefasst.
Schlüsselwörter
Essstörungen, Anorexia nervosa, Bulimia nervosa, Leibphilosophie, Dualismus, Monismus, Esskultur, Körper-Geist-Verhältnis, Robert Gernhardt, Selbstwahrnehmung, Selbstkontrolle, gesellschaftliche Normen.
- Quote paper
- Magistra Artium Astrid Lanvermann (Author), 2005, Das Thema Essstörungen im Unterricht der Praktischen Philosophie: Ein Unterrichtskonzept, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/123753