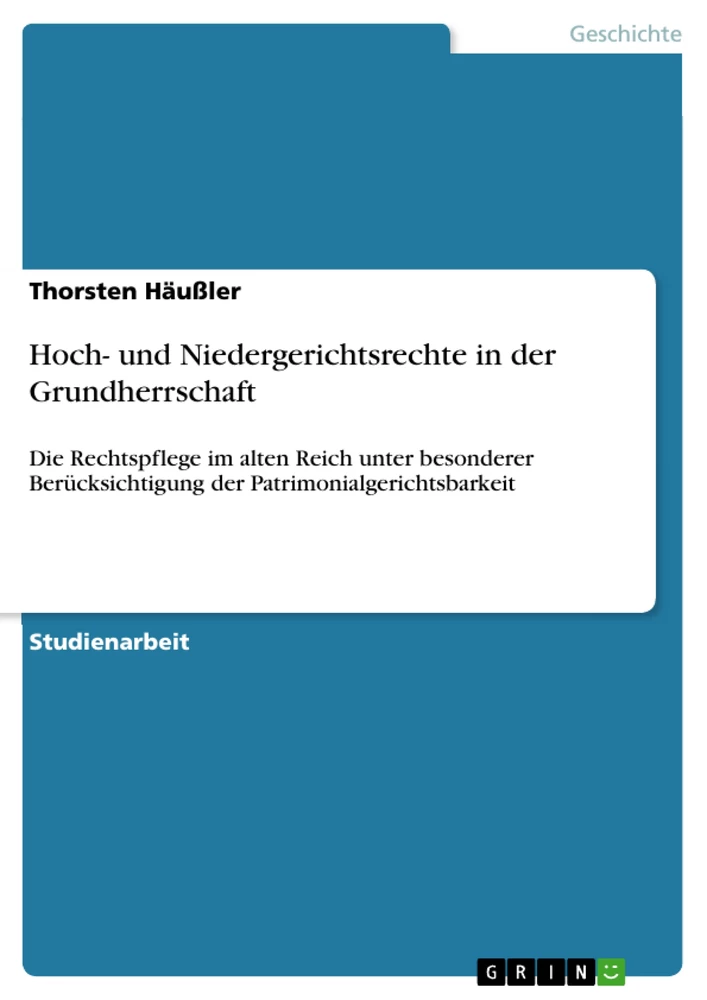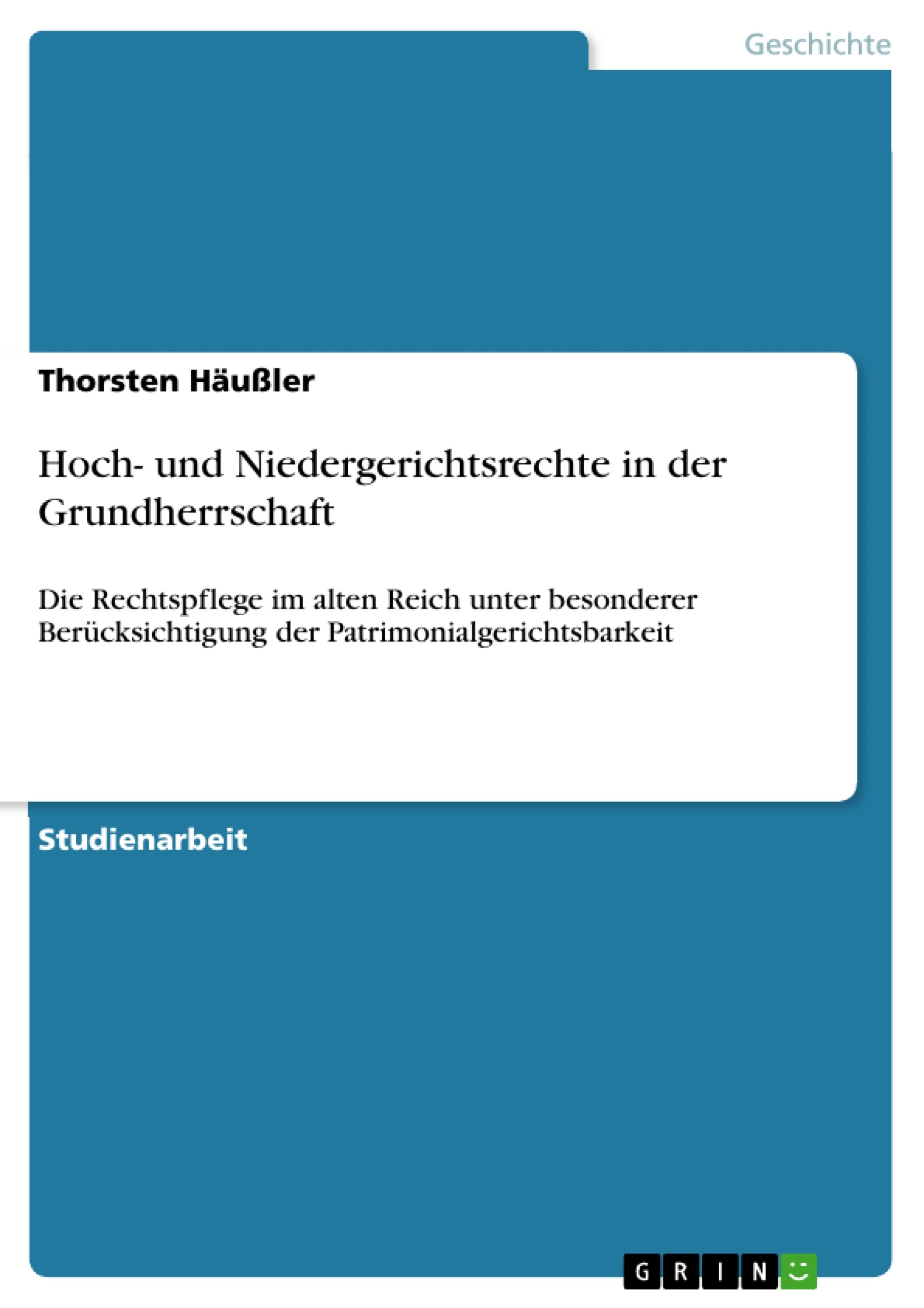Aufgrund der Vielzahl an sich häufig wandelnden Institutionen, deren Grundlagen, Träger und Kompetenzen ist es äußerst schwierig, eine befriedigende Darstellung der Rechtspflege im römisch-deutschen König- und Kaiserreich zu erstellen, ohne den Rahmen einer solchen Arbeit zu sprengen. Da es meiner Meinung nach jedoch von größter Wichtigkeit ist, die jahrhundertealten und seit dem frühen Mittelalter gewachsenen Strukturen aufzuzeigen, um so die Tragweite des Wandels in der deutschen Rechtslandschaft bis in die Neuzeit hinein voll zu erfassen, habe ich mich bewusst entschieden, zum Ausgangspunkt dieser Arbeit diejenigen Strukturen und Prinzipien zu machen, welche seit der Zeit Karls des Großen im Reich bestand hatten. Ausgehend davon skizziere ich die Entwicklungen der Gerichtsverfassung des Reiches vom Mittelalter bis in die Frühe Neuzeit, um aufzuzeigen, wie immer mehr exklusive richterliche Kompetenzen dem Monarchen durch die erstarkenden Reichsstände entzogen wurden. Ich möchte hier bewusst den Schwerpunkt auf die Organe der ordentlichen Reichsgerichtsbarkeit legen, da diese aufgrund der hervorragenden Quellenlage zu den am Besten erforschten Facetten der Rechtspflege im alten Reich zählen und eine Darstellung landesherrlicher Gerichtsbarkeit aufgrund der Fülle unterschiedlicher Institutionen in diesem Rahmen nur äußerst oberflächlich und ungenau erfolgen könnte. Der zweite Schwerpunkt dieser Arbeit liegt neben der ordentlichen Reichsgerichtsbarkeit auf der Rechtspflege der Patrimonialgerichte, welche sich bis zum Ende des alten Reiches zur wichtigsten Form privater Rechtsprechung entwickelt hatten. Da noch im Jahre 1800 ca. 80 Prozent der Gesamtbevölkerung der deutschen Staaten auf dem Lande lebten und von diesen Menschen die meisten vor jenen Gerichten ihr Recht zu suchen hatten, hat wohl keine andere Art von Gerichtshof den rechtlichen Alltag der Deutschen im Zeitalter der Staatenbildungen stärker geprägt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Reichsgerichtsverfassung
- Bedeutungsverlust der Grafengerichte des Königs: Vom Landgericht zum Femegericht
- Der oberste Gerichtshof des Reiches: Vom königlichen Hofgericht zu Reichskammergericht und Reichshofrat
- Die Patrimonialgerichte: Ländliche Privatgerichte des 18. u. 19. Jahrhunderts
- Kompetenzen: Die Patrimonialgerichte als erste Instanz der Niedergerichtsbarkeit
- Die politisch-soziale Dimension: Patrimonialgerichtsbarkeit ausschließlich als Unterdrückungsapparat?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der Rechtspflege im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation bis ca. 1800. Der Fokus liegt auf der Reichsgerichtsverfassung und der Patrimonialgerichtsbarkeit. Ziel ist es, die Strukturen und Prinzipien der Rechtspflege aufzuzeigen und den Wandel in der deutschen Rechtslandschaft zu erfassen.
- Entwicklung der Reichsgerichtsverfassung vom Mittelalter bis zur Frühen Neuzeit
- Entzug richterlicher Kompetenzen vom Monarchen zugunsten der Reichsstände
- Entwicklung und Bedeutung der Patrimonialgerichte
- Kompetenzen und Aufgaben der Patrimonialgerichte
- Politisch-soziale Dimension der Patrimonialgerichtsbarkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert die Komplexität der Darstellung der Rechtspflege im alten Reich und begründet die Fokussierung auf die Strukturen seit der Zeit Karls des Großen sowie auf die Reichsgerichtsbarkeit und die Patrimonialgerichte. Das Kapitel Die Reichsgerichtsverfassung beschreibt die Zweiteilung in Hoch- und Niedergerichtsbarkeit und deren Entwicklung im Mittelalter. Bedeutungsverlust der Grafengerichte des Königs beleuchtet den Wandel der Grafengerichte und deren Entwicklung zu Femegerichten. Das Kapitel Der oberste Gerichtshof des Reiches beschreibt die Entwicklung vom königlichen Hofgericht zum Reichskammergericht und Reichshofrat. Die Patrimonialgerichte behandelt die Entstehung und Ausbreitung dieser privaten Gerichte. Das Kapitel Kompetenzen: Die Patrimonialgerichte beschreibt die Kompetenzen der Patrimonialgerichte und deren Aufgaben als erste Instanz der Niedergerichtsbarkeit. Das Kapitel Die politisch-soziale Dimension untersucht die Rolle der Patrimonialgerichte als Instrument der sozialen Kontrolle und deren tatsächliche Funktion im ländlichen Alltag.
Schlüsselwörter
Reichsgerichtsverfassung, Hochgerichtsbarkeit, Niedergerichtsbarkeit, Patrimonialgerichtsbarkeit, Femegerichte, Reichskammergericht, Reichshofrat, Königsbann, Bannleihe, ländliche Rechtsprechung, soziale Kontrolle.
- Quote paper
- Thorsten Häußler (Author), 2009, Hoch- und Niedergerichtsrechte in der Grundherrschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/123701