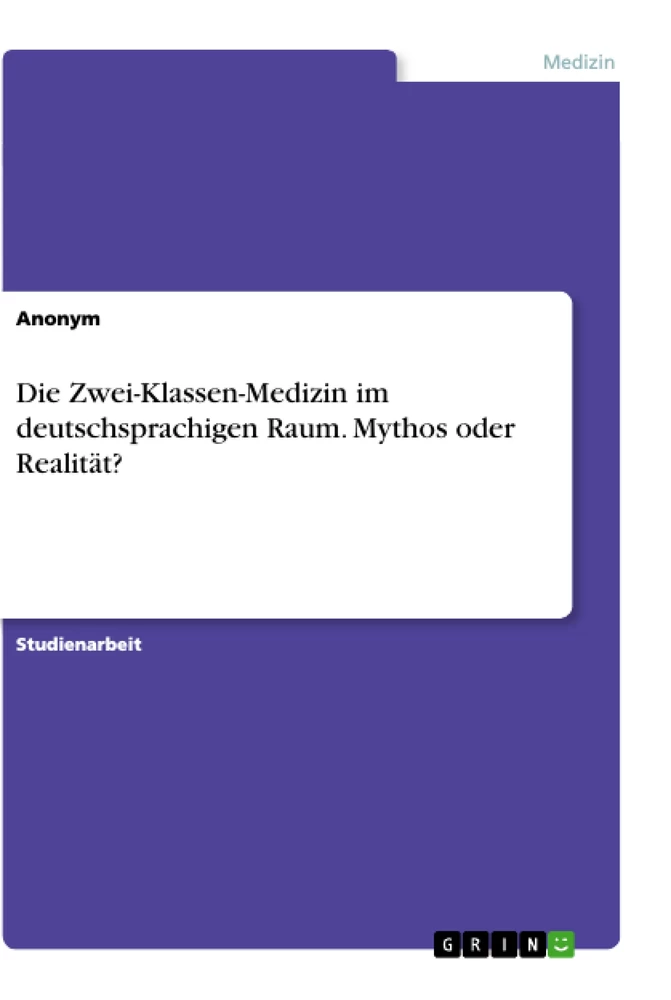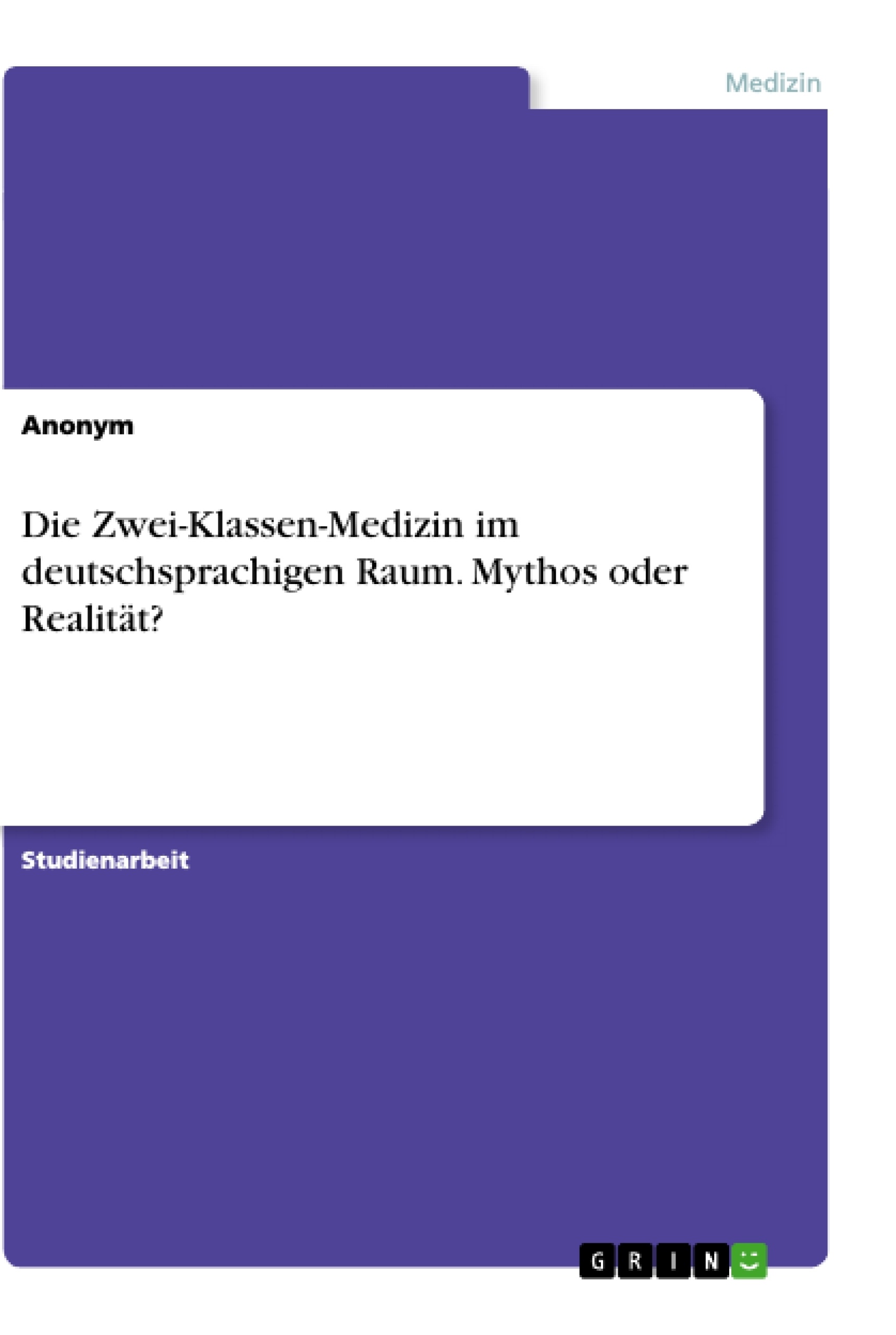Inwiefern wird in der Literatur aufgrund von Vergleichen zwischen der gesetzlichen und privaten Krankenversicherung eine Zwei-Klassen-Medizin im deutschsprachigen Raum beschrieben? Das Ziel dieser Arbeit ist es, Beispiele für eine Zwei-Klassen-Medizin im deutschsprachigen Raum, anhand wissenschaftlich fundierter Literatur, aufzuzeigen.
Das Gesundheitssystem im deutschsprachigen Raum verfolgt das Prinzip der Solidarität. Dieses Prinzip beruht darauf, dass eine einzelne Person im Bedarfsfall eine Hilfestellung von der Gemeinschaft erhält und umgekehrt genauso. Es wird nach dem Grundsatz „Einer für alle und alle für einen“ gehandelt. Die Solidarität im Gesundheitswesen sollte dabei im Zuge der medizinischen Versorgung und der Finanzierung dieser hervortreten. Hierbei entsteht jedoch eine Problematik aufgrund der Versicherungsstrukturen, da neben der gesetzlichen Krankenversicherung, auch GKV genannt, eine private Krankenversicherung, kurz PKV, abgeschlossen werden kann. Kritisiert wird diesbezüglich vor allem, dass private Krankenversicherungen, vor allem was die Finanzierung des Gesundheitssystems angeht, nicht in ausreichendem Ausmaß involviert werden, obwohl deren Klientel von bestimmten Leistungen ebenso Gebrauch machen können. Somit kommt es zu einem Ungleichgewicht zwischen der gesetzlichen und der privaten Krankenversicherung, welche sowohl das Gesundheits- als auch das Versicherungssystem zwangsläufig in zwei Klassen teilt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Hauptteil / Ergebnisse
- 2.1 Schnellere Termine und geringere Wartezeiten
- 2.2 Lücken bei der Steuerung von Leistungen und deren Ausgaben
- 2.3 Patienten/Innen als Wirtschaftsgut
- 2.4 Soziales Ungleichgewicht
- 3 Zusammenfassung der Ergebnisse und Fazit
- 4 Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert, inwiefern die Literatur eine Zwei-Klassen-Medizin im deutschsprachigen Raum aufgrund von Unterschieden zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung beschreibt. Sie zielt darauf ab, anhand wissenschaftlich fundierter Literatur Beispiele für diese Diskrepanz aufzuzeigen.
- Unterschiede in der Terminvergabe und Wartezeiten zwischen gesetzlich und privat Versicherten
- Finanzielle Ungleichgewichte zwischen den Versicherungsgruppen
- Patienten/Innen als Wirtschaftsgut und deren Einfluss auf die Gesundheitsversorgung
- Soziale Ungleichheit und die Benachteiligung einkommensschwacher Bevölkerungsgruppen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Prinzip der Solidarität im deutschen Gesundheitssystem und die daraus resultierende Problematik der Zwei-Klassen-Medizin dar, die durch das Nebeneinander von gesetzlicher und privater Krankenversicherung entsteht. Der Hauptteil untersucht die Auswirkungen dieser Diskrepanz auf verschiedene Aspekte der medizinischen Versorgung, beginnend mit den Themen Schnellere Termine und geringere Wartezeiten für privat Versicherte.
Weiterhin analysiert das Kapitel 2.2 die Lücken in der Steuerung von Leistungen und Ausgaben, die durch die unterschiedlichen Finanzierungssysteme der beiden Versicherungsgruppen entstehen. Kapitel 2.3 untersucht die Problematik der Behandlung von Patienten/Innen als Wirtschaftsgut, während Kapitel 2.4 die Auswirkungen der Zwei-Klassen-Medizin auf die soziale Ungleichheit betrachtet.
Schlüsselwörter
Zwei-Klassen-Medizin, Solidarität, gesetzliche Krankenversicherung, private Krankenversicherung, Terminvergabe, Wartezeiten, Finanzierung, Gesundheitsleistungen, Patienten/Innen als Wirtschaftsgut, soziale Ungleichheit, deutschsprachiger Raum.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2022, Die Zwei-Klassen-Medizin im deutschsprachigen Raum. Mythos oder Realität?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1234653