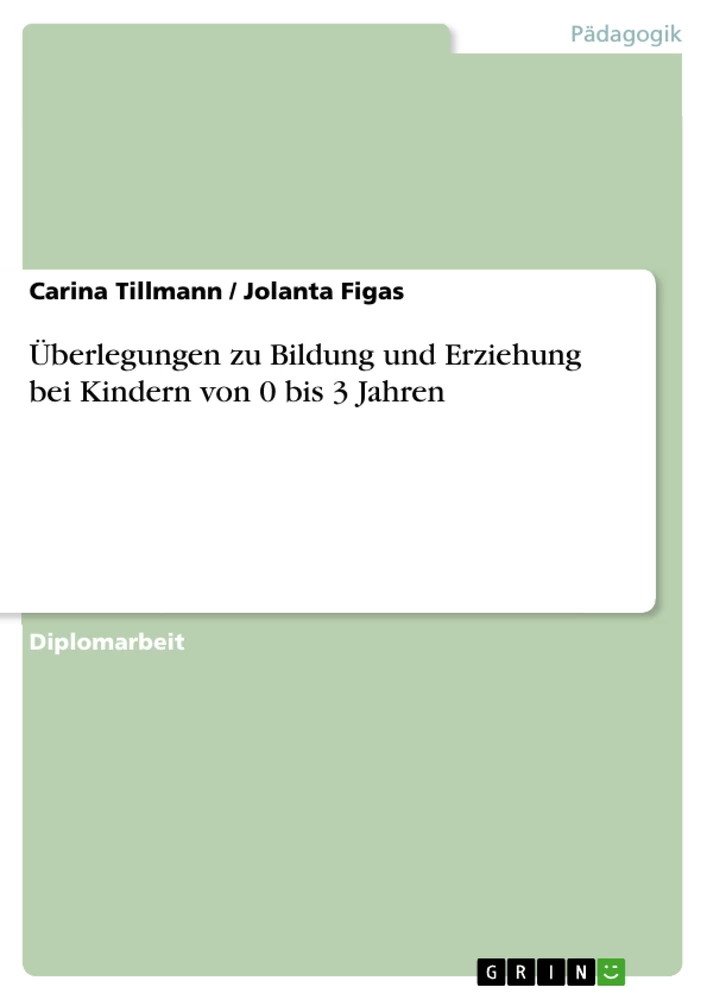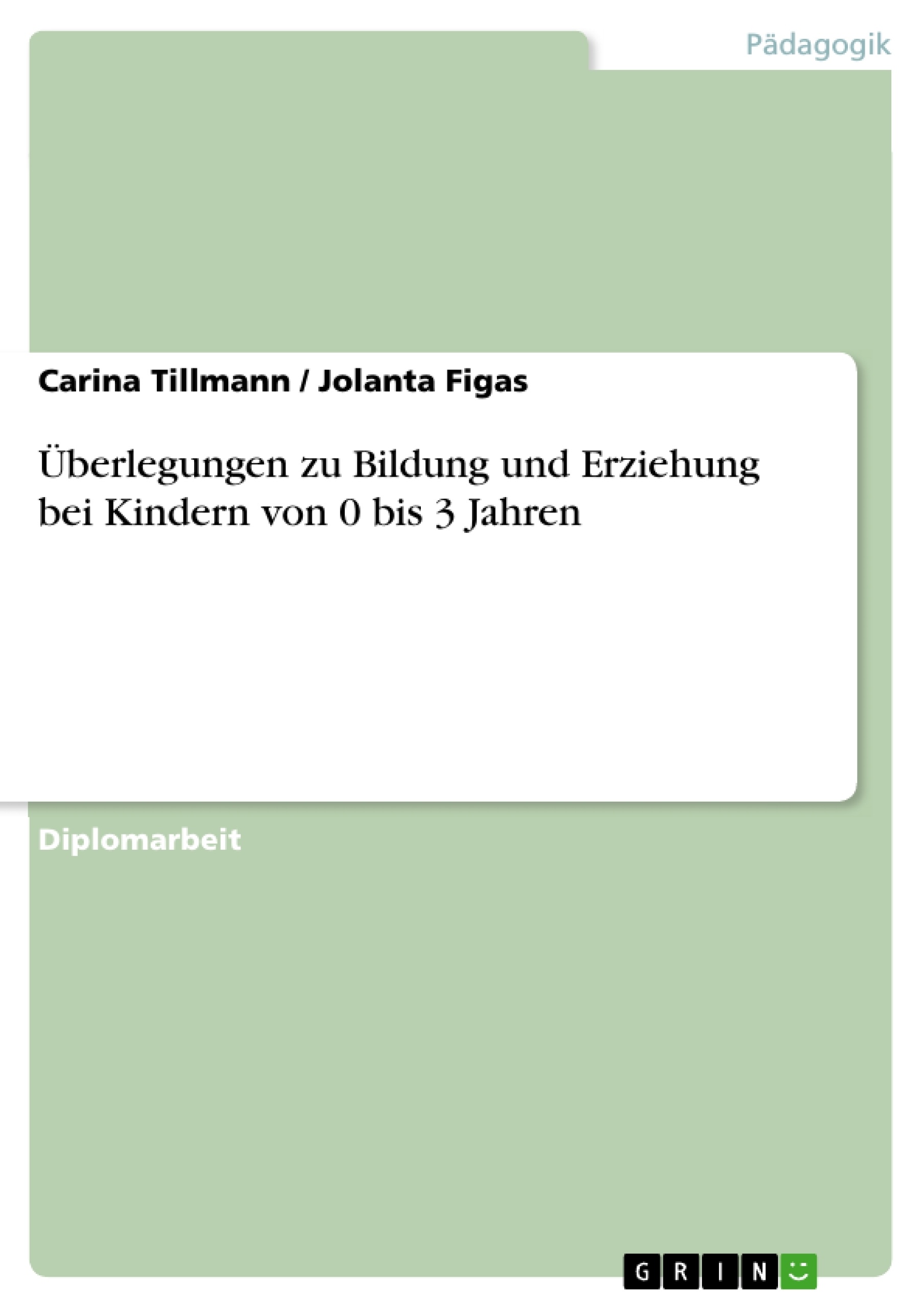Ein Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder von 0 bis 3 Jahren ist auf dem Vormarsch. Wie im Zuge dieser Entwicklung gleichzeitig Qualität mitgeschaffen werden kann, versucht die vorliegende Diplomarbeit zu beantworten. Sie stellt Überlegungen zu Bildung und Erziehung bei Kindern von 0 bis 3 Jahren an, um zu vermeiden, dass der Ausbau des Krippenwesens „übers Knie gebrochen“ oder „aus dem Bauch heraus“ vollzogen wird. Um Qualität in Erziehung und Bildung zu sichern, ist es wichtig zu fragen, was der aktuelle Bildungsgedanke überhaupt bedeutet. Diese Arbeit nimmt eine Gegenüberstellung theoretischer Anforderungen einer gelungenen Bildungsinitiative, wie sie von Gerd E. Schäfer (Professor für Frühpädagogik an der Universität zu Köln, Herausgeber "Bildung beginnt mit der Geburt") vertreten wird, mit den praktischen Möglichkeiten der Umsetzung vor.
Wichtig ist sich klarzumachen, dass – ebenso wie der Kindergarten keine „verkleinerte Art der Schule“ ist – die Krippe auch keine „verkleinerte Art des Kindergartens“ darstellen darf. Inhalte und Konzeptionen aus der Kindergartenpädagogik dürfen nicht einfach als Krippenpädagogik adaptiert werden.
Was das für die Praxis der Krippenpädagogik bedeutet und wie wir als Pädagogen einen geeigneten Rahmen dafür schaffen können, wird in der vorliegenden Arbeit erörtert.
Sie beginnt mit einem historischen Rückblick. Unter Berücksichtigung der Ideen und Erkenntnisse der Vergangenheit zum Bildungsgedanken folgt eine Bestandsaufnahme der Gegenwart. Was ist es, das Gerd E. Schäfer unter Bildung versteht? Dass es bereits pädagogische Konzepte gibt, die die Anforderungen an den heutigen Bildungsgedanken bemerkenswert gut in die Praxis umsetzen, zeigen die Reggio-Pädagogik und die Pädagogik Emmi Piklers. Beide Konzepte beschäftigen sich explizit mit unter Dreijährigen Kindern und ihrer Selbstbildung. Es folgt der Blick nach Hamburg. Im Rahmen unseres Studiums hospitierten wir in zwei Hamburger Einrichtungen, die gelungene Krippenpädagogik schon jetzt richtungsweisend leben. Unsere dort gemachten Beobachtungen und das Bildmaterial, das wir vor Ort anfertigen durften, dienen dem besseren Verständnis und der Veranschaulichung, wenn wichtige Säulen der Krippenpädagogik auf dem Prüfstand im Praxisbezug stehen (Spiel, ästhetische Bildung, Bewegung, Raumgestaltung, personelle Anforderungen, Beobachtung, Eingewöhnung). Was ändert der Schäfersche Bildungsbegriff an Bestehendem, was kann wie neu geschaffen werden?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung und Begründung des Themas (J. F. / C. T.)
- 2. Historische Herleitung der Kleinkinderziehung (J. F.)
- 2.1. Die Geburtsstunde einer neuen Gesellschaftsordnung
- 2.2. Kinderbewahranstalten - Anfänge institutioneller Kleinkinderziehung
- 2.3. Fröbels Einfluss auf die Kleinkinderziehung
- 2.4. Wie die Weimarer Republik einen gesetzlichen Rahmen schafft
- 2.5. Das dritte Reich – ein Rückschritt für die Kleinkinderziehung
- 2.6. Die Entwicklung des Kindergartens von der Nachkriegszeit bis heute
- 2.7. Neue Ideen und Konzepte werden zu Wegweisern
- 2.8. Von verpassten Gelegenheiten
- 3. Der Bildungsgedanke als roter Faden der frühkindlichen Pädagogik im geschichtlichen Rückblick (J. F.)
- 4. Was bedeutet Bildung im Elementarbereich? (J. F.)
- 4.1. Der Bildungsbegriff nach Gerd E. Schäfer
- 4.2. 15 Thesen zu Bildungsprozessen
- 5. Bildung und Erziehung bei Kindern von 0 bis 3 Jahren – Vorstellung zweier gelungener Konzepte (C. T. / J. F.)
- 5.1. Kleinkinderziehung in der Reggio-Pädagogik (C. T.)
- 5.1.1. Entstehung, Inhalte und Ziele der Kleinkindpädagogik
- 5.1.2. Das Bild vom Kind
- 5.1.3. Wahrnehmen, Lernen und Gestalten als Grundgedanken
- 5.1.4. Die Räume in Reggio Emilia
- 5.1.5. Die reggianischen Erzieherinnen
- 5.1.6. Die Eltern
- 5.1.7. Die Eingewöhnung der Kinder
- 5.1.8. Ästhetische Bildung in Reggio Emilia
- 5.1.9. Abschließende Gedanken zur Reggio-Pädagogik
- 5.2. Das Konzept von Emmi Pikler (J. F.)
- 5.2.1. Einführung in die Pädagogik von Emmi Pikler
- 5.2.2. Schwerpunkte in der Piklerschen Pädagogik
- 5.2.3. Die Rolle der Erzieherin oder: Mütterliche Betreuung ohne Mutter
- 5.2.4. Das freie Spiel des Kindes
- 5.2.5. Bewegungsentwicklung
- 5.2.6. Abschließende Gedanken zur Pädagogik von Emmi Pikler
- 5.1. Kleinkinderziehung in der Reggio-Pädagogik (C. T.)
- 6. Zu Besuch in Hamburg – Die Krippen Kind & Kegel e. V. und Kegelhofstraße e. V. (C. T.)
- 7. Krippenpädagogische Säulen auf dem Prüfstand im Praxisbezug (J. F. / C. T.)
- 7.1. Kindliche Aktivitäten im Zentrum des Krippengeschehens
- 7.1.1. Das Spiel
- 7.1.1.1. Was macht das Spiel zum Spiel?
- 7.1.1.2. Formen des Spiels
- 7.1.1.3. Konsequenzen für die Praxis
- 7.1.2. Ästhetische Bildung
- 7.1.2.1. Begriffsklärung
- 7.1.2.2. Gestalten als frühkindliche Tätigkeit
- 7.1.2.3. Materialien zum Experimentieren und Gestalten
- 7.1.2.4. Projektarbeit in der Krippe
- 7.1.3. Bewegung
- 7.1.3.1. Bewegung und ihre Multifunktionalität
- 7.1.3.2. Bewegung als erste Denkform des Kindes
- 7.1.3.3. Differenzierung von Wahrnehmungserfahrungen – Bewegungsentwicklung im Praxisbezug
- 7.1.3.4. Hamburg „bewegt“
- 7.1.1. Das Spiel
- 7.2. Der Raum als Quelle zur Selbstbildung
- 7.2.1. Die Bedeutung des Raumes für Bildung und Erziehung
- 7.2.2. Der Eingangsbereich in der Krippe
- 7.2.3. Der Gruppenraum in der Krippe
- 7.2.4. Sinnesanregende Gestaltung: Farben, Licht, Akustik und Gerüche
- 7.2.5. Drei Funktionen des Sanitärraumes: Atelier, Ort zum Spielen und Experimentieren und Körperpflege
- 7.2.6. Ein Raum zum Essen und Genießen
- 7.2.7. Ruhen, Schlafen und Träumen
- 7.2.8. Raum für Angebote und Arbeitsplatz der Erzieherinnen
- 7.2.9. Übergänge zwischen Räumen und Bereichen und Räumen und Räumen
- 7.2.10. Abschließende Gedanken zum Thema Raumgestaltung
- 7.3. Personelle Anforderungen und Konsequenzen für die Praxis
- 7.3.1. Die Erzieherin im Schäferschen Sinne
- 7.3.1.1. Wie personelle Qualität geschaffen werden kann – ein Beispiel aus Hamburg
- 7.3.2. Beobachten und Dokumentieren als Praxisinstrument
- 7.3.3. Die ersten Tage in der Krippe – Der sanfte Übergang
- 7.3.3.1. Die Notwendigkeit der Eingewöhnung
- 7.3.3.2. Das Berliner Eingewöhnungsmodell und seine praktische Umsetzung
- 7.3.3.3. Die Rollen der Beteiligten
- 7.3.3.4. Abschließende Gedanken zum Thema Eingewöhnung
- 7.1. Kindliche Aktivitäten im Zentrum des Krippengeschehens
- 8. Fazit (J. F. / C. T.)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht Bildung und Erziehung von Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren, insbesondere im Kontext des Ausbaus von Krippenplätzen. Sie analysiert den aktuellen Bildungsgedanken und prüft, wie dieser in der Krippenpraxis umgesetzt werden kann, um qualitativ hochwertige Betreuung zu gewährleisten.
- Historische Entwicklung der Kleinkinderziehung
- Der Bildungsbegriff nach Gerd E. Schäfer und seine Implikationen für die Krippenpädagogik
- Analyse gelungener Konzepte wie der Reggio-Pädagogik und der Pikler-Pädagogik
- Praxisbeispiele aus Hamburger Krippen
- Personelle Anforderungen und Qualitätsentwicklung in der Krippenarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in das Thema ein und begründet die Relevanz der frühkindlichen Bildung. Kapitel 2 beleuchtet die historische Entwicklung der Kleinkinderziehung, von den Anfängen bis zur Gegenwart. Kapitel 3 und 4 befassen sich mit dem Bildungsgedanken in der frühkindlichen Pädagogik, insbesondere mit Schäfers Ansatz. Kapitel 5 stellt zwei erfolgreiche Konzepte (Reggio-Pädagogik und Pikler-Pädagogik) vor. Kapitel 6 beschreibt zwei Hamburger Krippen als Praxisbeispiele. Kapitel 7 analysiert krippenpädagogische Säulen im Praxisbezug, inklusive Spiel, ästhetischer Bildung, Bewegung, und Raumgestaltung.
Schlüsselwörter
Frühkindliche Bildung, Krippenpädagogik, Reggio-Pädagogik, Pikler-Pädagogik, Gerd E. Schäfer, Selbstbildung, Bewegungsentwicklung, Raumgestaltung, Qualitätsentwicklung, Beobachtung, Dokumentation, Eingewöhnung.
- Quote paper
- Carina Tillmann (Author), Jolanta Figas (Author), 2008, Überlegungen zu Bildung und Erziehung bei Kindern von 0 bis 3 Jahren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/123438