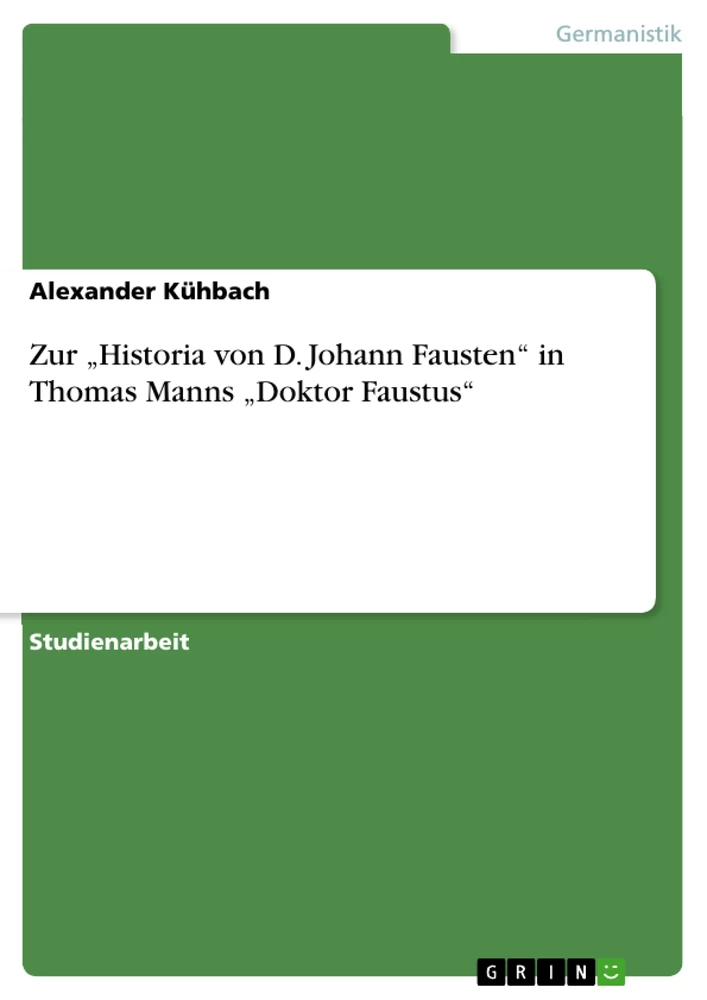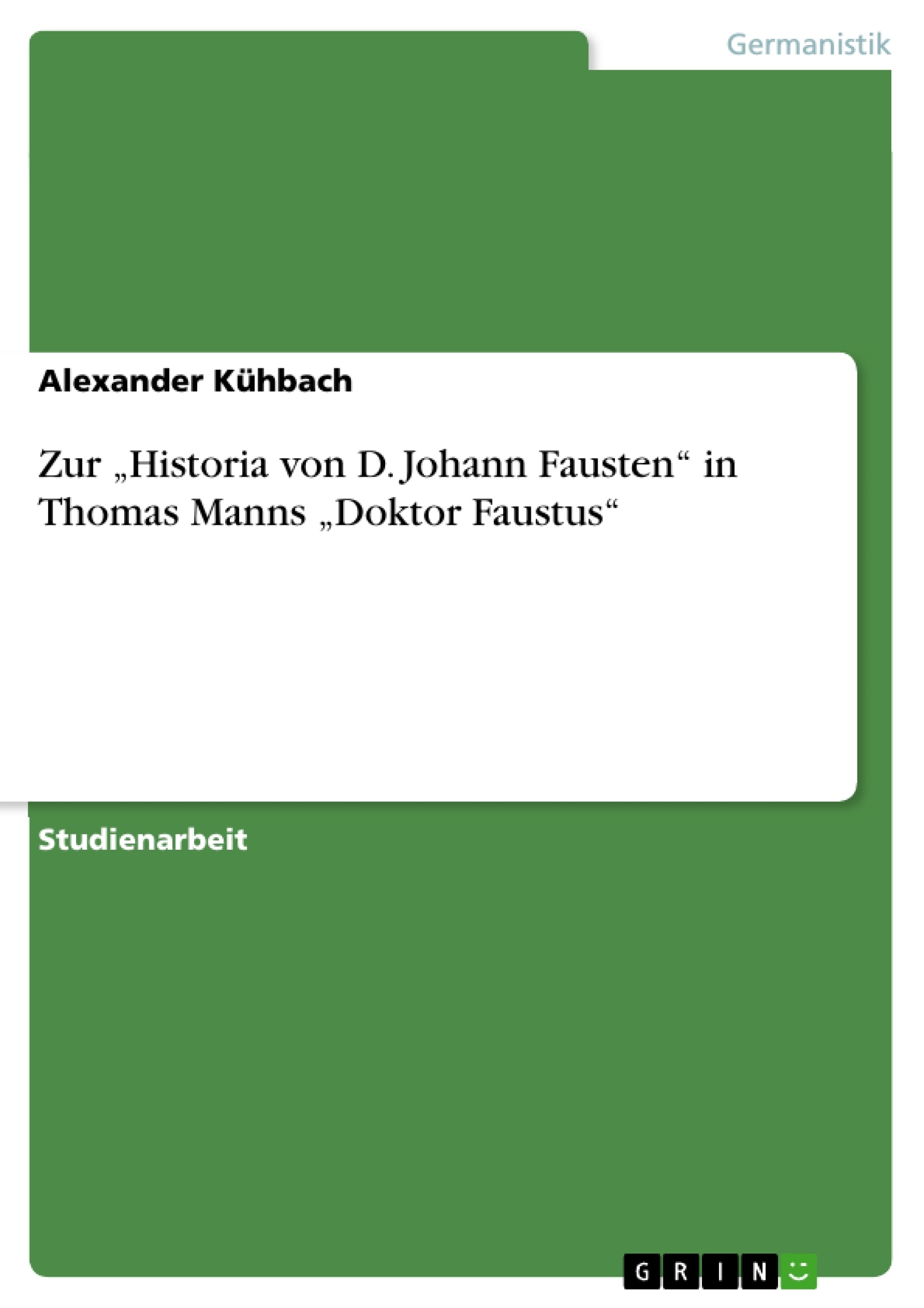In der folgenden Arbeit wird zunächst das Teufelsgespräch aus dem Roman „Doktor Faustus“ von Thomas Mann mit der Teufelsverschreibung in der „Historia von D. Johann Fausten“, die 1587 von dem Verleger Johann Spies veröffentlicht wurde, verglichen. Das Hauptaugenmerk liegt auf den textuellen Übereinstimmungen zwischen diesen Werken. Auf diesen Übereinstimmungen basierend, setzt sich die Arbeit weiterhin zum Ziel, auch andere Gründe dafür zu suchen, was Thomas Mann dazu veranlasst hat, das Volksbuch als Hauptquelle für den Faust-Stoff zu wählen.
Das erste Kapitel vergleicht die „Historia“ und den „Doktor Fautus“ auf textlicher Ebene. Dabei soll vor allem die mittelalterlich geprägte Sprache im Vordergrund stehen, die bei Thomas Mann gerade im Teufelsgespräch immer wieder auftaucht.
Das zweite Kapitel ist bestimmt durch die Suche nach weiteren Hinweisen, die für die „Historia“ als Hauptquelle sprechen. Dazu wird auf die Figur des Ehrenfried Kumpf und seine Funktion als Luther-Karikatur eingegangen. Weiterhin wird auch Albrecht Dürer angeführt, der ebenfalls in „Doktor Faustus“ eingebunden wurde.
Das dritte Kapitel geht auf den Text „Faust im Faustus“ von Heinz Gockel ein, der ein Verfechter der These ist, dass Thomas Mann sich stärker auf Goethes „Faust“ als auf das Volksbuch bezogen hat.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Textuelle Übereinstimmungen
- 3. Weitere Faktoren
- 4. Kritische Auseinandersetzung mit Heinz Gockel
- 5. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Einfluss der „Historia von D. Johann Fausten“ auf Thomas Manns „Doktor Faustus“. Sie vergleicht die beiden Texte auf textlicher Ebene, sucht nach weiteren Belegen für die „Historia“ als Hauptquelle und setzt sich kritisch mit der Gegenmeinung auseinander, die Goethes „Faust“ als stärkere Einflussquelle sieht.
- Textuelle Übereinstimmungen zwischen „Historia von D. Johann Fausten“ und „Doktor Faustus“
- Weitere Faktoren, die für die „Historia“ als Hauptquelle sprechen
- Kritische Auseinandersetzung mit der These von Heinz Gockel, der Goethes „Faust“ als Hauptquelle sieht
- Analyse der mittelalterlichen Sprache in Manns Werk
- Bedeutung der Figur des Ehrenfried Kumpf und Albrecht Dürer in „Doktor Faustus“
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses einleitende Kapitel beschreibt den Forschungsansatz der Arbeit. Es kündigt den Vergleich des Teufelsgesprächs aus Manns „Doktor Faustus“ mit der Teufelsverschreibung in der „Historia von D. Johann Fausten“ an, wobei der Fokus auf textuellen Übereinstimmungen und weiteren Faktoren liegt, die Manns Wahl des Volksbuchs als Hauptquelle erklären sollen. Das Kapitel skizziert die Struktur der Arbeit und die Forschungsfragen, die in den folgenden Kapiteln behandelt werden.
2. Textuelle Übereinstimmungen: Dieses Kapitel analysiert die textlichen Gemeinsamkeiten zwischen „Doktor Faustus“ und der „Historia von D. Johann Fausten“. Es widerlegt die Annahme, dass Mann sich stärker an Goethes „Faust“ orientiert hat, unter anderem durch die Zitierweise und die Aussage Manns in einem Brief an Hilde Zaloscer. Der Fokus liegt auf der hohen Zitatendichte, insbesondere im Kapitel „Das Teufelsgespräch“, wo Mann zahlreiche Formulierungen und Ausdrücke aus der „Historia“ übernimmt. Beispiele werden genannt, die die enge Beziehung zwischen beiden Texten belegen und die mittelalterlich geprägte Sprache in Manns Werk verdeutlichen. Die Analyse umfasst sowohl wortwörtliche Übernahmen als auch Adaptionen des ursprünglichen Textes.
3. Weitere Faktoren: Dieses Kapitel erweitert die Analyse, indem es weitere Aspekte untersucht, die für die „Historia“ als Hauptquelle sprechen. Es beleuchtet die Rolle der Figur Ehrenfried Kumpf als Luther-Karikatur und die Einbindung Albrecht Dürers in „Doktor Faustus“, was zusätzliche Parallelen zum Volksbuch aufzeigt. Die Berücksichtigung dieser zusätzlichen Faktoren soll die These der „Historia“ als primäre Inspirationsquelle weiter festigen.
4. Kritische Auseinandersetzung mit Heinz Gockel: In diesem Kapitel wird die Argumentation von Heinz Gockel kritisch beleuchtet. Gockel vertritt die These, dass Mann sich stärker auf Goethes „Faust“ als auf das Volksbuch bezogen hat. Die Arbeit konfrontiert Gockels These mit den in den vorherigen Kapiteln dargestellten Beweisen und argumentiert gegen dessen Schlussfolgerung. Sie präsentiert Gegenargumente und stärkt somit die These der „Historia“ als zentrale Quelle für Manns Werk.
Schlüsselwörter
Thomas Mann, Doktor Faustus, Historia von D. Johann Fausten, Textvergleich, mittelalterliche Sprache, Goethes Faust, Heinz Gockel, Teufelsgespräch, Quellenanalyse, Volksbuch.
Häufig gestellte Fragen zu "Doktor Faustus" und der "Historia von D. Johann Fausten"
Was ist der Fokus dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Einfluss der „Historia von D. Johann Fausten“ auf Thomas Manns „Doktor Faustus“. Sie vergleicht beide Texte, sucht nach Belegen für die „Historia“ als Hauptquelle und widerlegt die Gegenmeinung, die Goethes „Faust“ als stärkere Einflussquelle sieht.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt textuelle Übereinstimmungen zwischen beiden Werken, weitere Faktoren, die die „Historia“ als Hauptquelle stützen, eine kritische Auseinandersetzung mit Heinz Gockels These (der Goethes „Faust“ als Hauptquelle sieht), die Analyse der mittelalterlichen Sprache in Manns Werk und die Bedeutung von Ehrenfried Kumpf und Albrecht Dürer in „Doktor Faustus“.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit besteht aus fünf Kapiteln: einer Einleitung, einem Kapitel zu textuellen Übereinstimmungen, einem Kapitel zu weiteren Faktoren, die für die „Historia“ sprechen, einer kritischen Auseinandersetzung mit Heinz Gockel und einer Schlussbetrachtung. Die Einleitung beschreibt den Forschungsansatz und die Forschungsfragen. Die Kapitel 2 und 3 liefern Beweise für die These der „Historia“ als Hauptquelle. Kapitel 4 widerlegt die Gegenmeinung von Heinz Gockel.
Welche textlichen Übereinstimmungen werden analysiert?
Das Kapitel zu den textuellen Übereinstimmungen analysiert Gemeinsamkeiten zwischen „Doktor Faustus“ und der „Historia von D. Johann Fausten“, insbesondere im „Teufelsgespräch“. Es zeigt wortwörtliche Übernahmen und Adaptionen aus dem Volksbuch auf und widerlegt die Annahme einer stärkeren Orientierung an Goethes „Faust“ durch Zitierweisen und Aussagen Manns.
Welche weiteren Faktoren unterstützen die These der "Historia" als Hauptquelle?
Zusätzliche Faktoren, die die „Historia“ als Hauptquelle stützen, sind die Rolle der Figur Ehrenfried Kumpf als Luther-Karikatur und die Einbindung Albrecht Dürers in „Doktor Faustus“. Diese Parallelen zum Volksbuch festigen die These weiter.
Wie wird die These von Heinz Gockel kritisiert?
Das Kapitel zur kritischen Auseinandersetzung mit Heinz Gockel konfrontiert dessen These (Goethes „Faust“ als Hauptquelle) mit den in den vorherigen Kapiteln dargestellten Beweisen. Gegenargumente werden präsentiert, um die These der „Historia“ als zentrale Quelle zu stärken.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Thomas Mann, Doktor Faustus, Historia von D. Johann Fausten, Textvergleich, mittelalterliche Sprache, Goethes Faust, Heinz Gockel, Teufelsgespräch, Quellenanalyse, Volksbuch.
- Quote paper
- Alexander Kühbach (Author), 2007, Zur „Historia von D. Johann Fausten“ in Thomas Manns „Doktor Faustus“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/123328