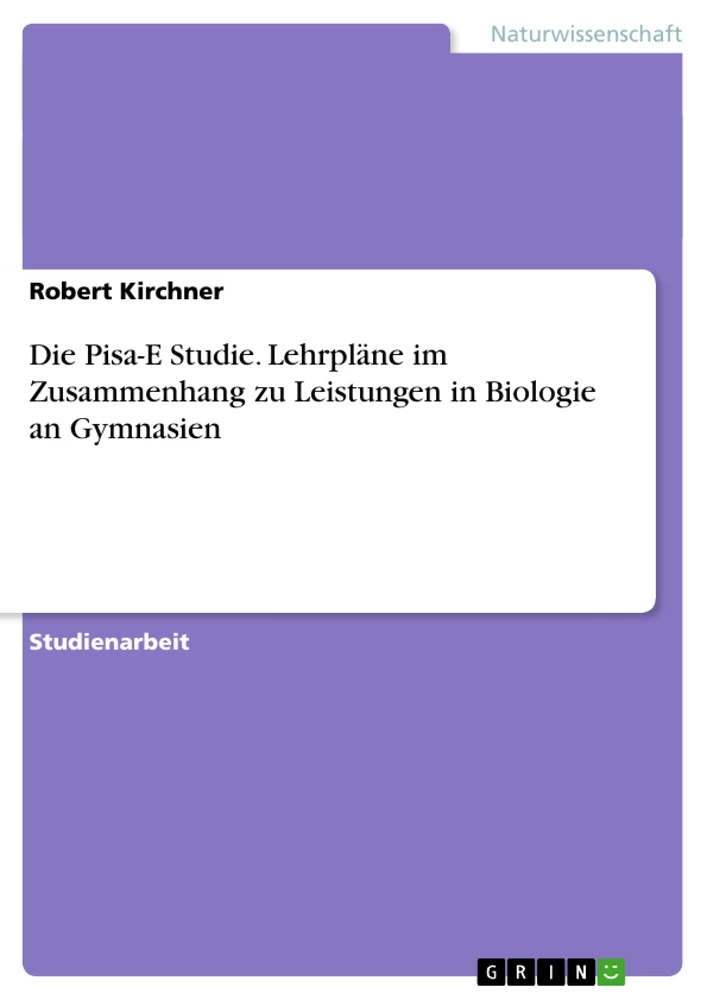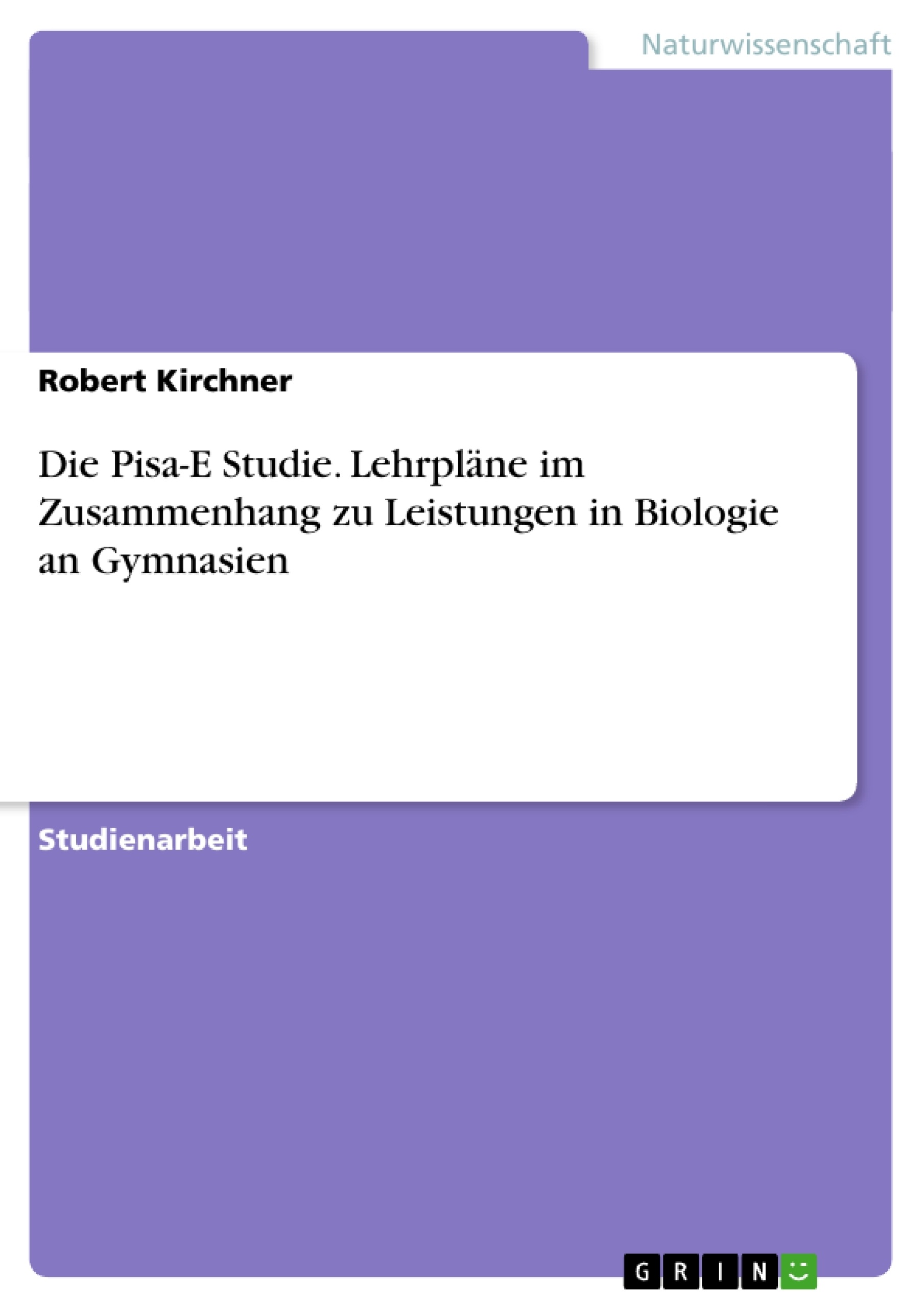Im Winter des Jahres 2001/2002 wurde die Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland ein weiteres Mal schockiert. Neben einer der höchsten Arbeitslosigkeiten und schwächstem Wirtschschaftswachstum in der EU, einem gerade noch abgewendeten „blauen Brief“ aus Brüssel wegen überschreiten der Staatsverschuldung wurde den Deutschen gezeigt, dass auch die Bildung ihrer nachwachsenden Generation nur noch im Mittelfeld, im Vergleich zu vielen Ländern der OECD- Staaten liegt. In diesem Winter wurde die PISA- Studie 2000 veröffentlicht. PISA steht dabei für: „Programme for International Student Assessment“. Dabei handelt es sich um ein Programm zur zyklischen Erfassung basaler Kompetenzen der nachwachsenden Generation, das von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) durchgeführt, und von allen Mitgliedsstaaten gemeinschaftlich getragen und verantwortet wird. PISA ist Teil des Indikatorenprogramms der OECD, dessen Ziel es ist, den OECD-Mitgliedsstaaten vergleichende Daten über die Ressourcenausstattung, individuelle Nutzung sowie Funktions- und Leistungsfähigkeit ihrer Bildungssysteme zur Verfügung zu stellen (OECD, 1999). Die Bundesrepublik Deutschland beteiligt sich an diesem Programm gemäß einer Vereinbarung zwischen dem Bundesministerium für Bildung und Forschung und der ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder.[1]
In der PISA- Studie 2000 wurden drei Kernbereiche geprüft: Lesekompetenz, sowie mathematische und naturwissenschaftliche Grundbildung. Dabei wurden stichprobenartig in 32 Ländern zwischen 5000 und 10000 Schülerinnen und Schüler zu einem standardisierten anonymen Test herangezogen. Dieser Test hat den Anspruch kein Fachwissen in den einzelnen Bereichen abzuprüfen, sondern anwendungsbezogenes Wissen. Dazu wurden den Schülerinnen und Schülern Aufgaben vorgelegt, die verschiedenen Schwierigkeitsgraden entsprechen und verschieden viele Punkte, je nach Schwierigkeitsgrad, enthalten. Aus dem Erreichen der Punkte lassen sich die Schülerinnen und Schüler dann in unterschiedliche Kategorien einordnen.
Wie bereits erwähnt hat Deutschland dabei mittelmäßig abgeschnitten. In den drei Kategorien war der Durchschnitt der erreichten Punkte 500. Deutschland erreichte in den drei Kompetenzbereichen durchschnittlich zwischen 484 und 490 Punkte (Lesekompetenz: 484; mathematische Grundbildung: 490; naturwissenschaftliche Grundbildung: 487). [...]
Inhaltsverzeichnis
-
Die PISA- Studie- International
- Die PISA- Studie- International
- Die PISA-E- Studie
- Auswahl der Bundesländer
-
Bedingungen der Bundesländer
- Soziale Unterschiede
- Wirtschaftliche Unterschiede
- Bildungsfinanzielle Unterschiede
- Zusammenfassung und Interpretation der unterschiedlichen Bedingungen
-
Lehrpläne
- Die Lehrpläne
- Zusammenfassung der Lehrpläne
- Auswertung der Lehrpläne
- Vergleich der Methoden
- Umfang der Biologiestunden in den Bundesländern von Klasse 5 bis 10
-
Die PISA- Aufgaben
- Die Aufgabe für den Bereich der Biologie in der PISA- Studie International
- Die Aufgabe für den Bereich der Biologie in der PISA- Studie International
- Analyse der Aufgabe in Hinsicht auf die Inhalte
- Bezug der Frage zu den Lehrplänen
- Zusammenfassung
- Die Aufgabe für den Bereich der Biologie in der PISA- Studie National
- Die Aufgabe für den Bereich der Biologie in der PISA- Studie National
- Analyse der Aufgabe in Hinsicht auf die Lehrpläne
- Bezug der Frage zu den Lehrplänen
- Zusammenfassung
- Die Aufgabe für den Bereich der Biologie in der PISA- Studie International
- Ergebnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Ergebnisse der PISA-E-Studie, einem deutschen Ländervergleich, im Kontext der naturwissenschaftlichen Grundbildung in Biologie. Sie untersucht insbesondere den Einfluss von Lehrplänen auf die Leistungen an Gymnasien, fokussiert auf Bremen, das in der Studie die schlechtesten Ergebnisse erzielt hat.
- Analyse der PISA-E-Studie in Bezug auf Leistungen in Biologie
- Beurteilung des Einflusses von Lehrplänen auf die Ergebnisse
- Vergleich der Lehrpläne verschiedener Bundesländer
- Untersuchung der Bedingungen der Bundesländer, insbesondere in Bremen
- Einordnung der Ergebnisse im Kontext des Bildungsföderalismus
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 beleuchtet die PISA-Studie International und die PISA-E-Studie. Es werden die Studiendesigns, die untersuchten Kompetenzen und die Ergebnisse im internationalen und nationalen Kontext dargestellt. Kapitel 2 analysiert die Ergebnisse der PISA-E-Studie für die einzelnen Bundesländer und stellt Bremen als Untersuchungsobjekt vor. Kapitel 3 beschäftigt sich mit den Lehrplänen der einzelnen Bundesländer, insbesondere mit den biologischen Inhalten. Kapitel 4 untersucht den Umfang des Biologiestudiums in den Bundesländern von Klasse 5 bis 10. Kapitel 5 analysiert die PISA-Aufgaben im Bereich der Biologie und stellt den Bezug zu den Lehrplänen her.
Schlüsselwörter
PISA-E-Studie, Biologie, naturwissenschaftliche Grundbildung, Lehrpläne, Bundesländer, Bremen, Bildungsföderalismus, Gymnasien, Leistungsunterschiede, Schülerleistungen.
- Arbeit zitieren
- Robert Kirchner (Autor:in), 2003, Die Pisa-E Studie. Lehrpläne im Zusammenhang zu Leistungen in Biologie an Gymnasien, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/12320