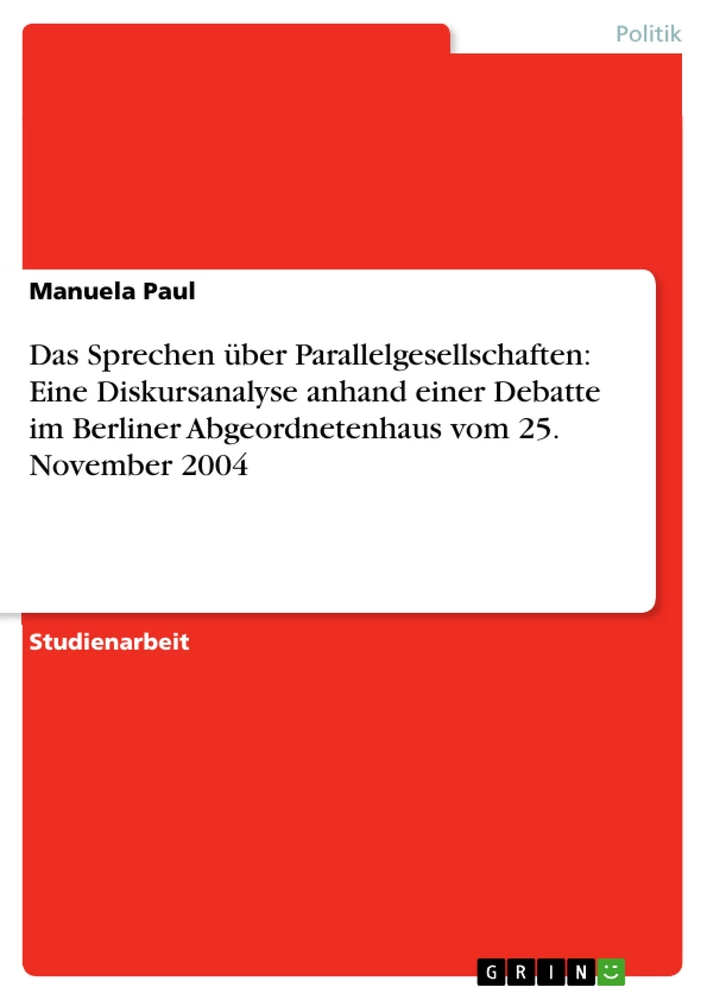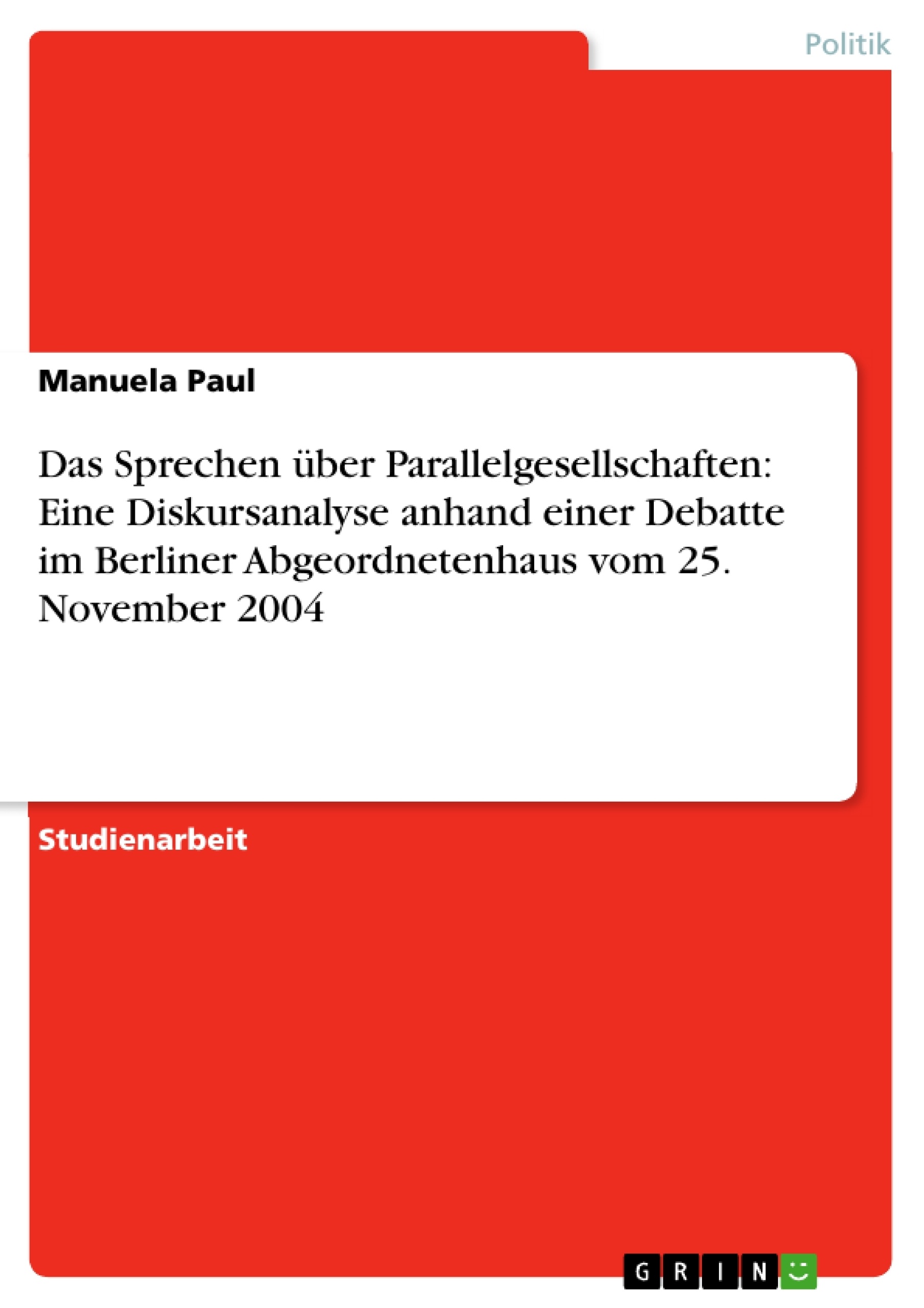Ins Zentrum der Debatte um Integration in Deutschland ist in den vergangenen Jahren eine Warnung vor Parallelgesellschaften gerückt.
„Integration? In Katernberg scheint sie im Großen und Ganzen gescheitert zu sein. Hier hat sich in den vergangenen vier Jahrzehnten eine Parallelgesellschaft entwickelt, in der Türken Türken bleiben und die Deutschen Deutsche sein lassen.“
So stellt ein Artikel aus der Zeit vom 28.08.2003 mit dem Titel „Ghetto im Kopf“ die Integrationsthematik anhand eines Stadtteils in Essen dar. Gleichzeitig beteiligen sich Politiker an der Rede über Parallelgesellschaften und sind in die Konstruktion eines undurcschaubar anmutenden Begriffgeflechts involviert. Als der stellvertretende Grünen-Fraktionsvorsitzende Christian Ströbele im November 2004 im Bundestag die Einführung eines gesetzlichen muslimischen Feiertags forderte, kritisierte Brandenburgs Innenminister Jörg Schönbohm (CDU) islamistische Hassprediger, die "mit deutschem Pass hier in ihrer Parallelgesellschaft leben.
Obwohl der Begriff fester Bestandteil des medialen und politischen Diskurses ist, findet doch keine öffentliche Diskussion statt, in der man ihm eindeutige Inhalte zuordnet oder ihn definiert. Stattdessen bleibt das Bild undifferenziert und verallgemeinernd. Mit dem zunemenden Gebrauch des Wortes Parallelgesellschaft in der öffentlichen Debatte verstärkt sich der Eindruck einer willkürlichen Verwendung des Begriffes in Form eines inhaltsleeren Schlagworts. Aus dem Interesse heraus zu erfassen, aus welchen Elementen der Terminus Parallelgesellschaft formiert wird, versucht diese Arbeit das Geflecht der Redeweisen über Parallelgesellschaft zu entwirren, indem sie sich im Speziellen dem politischen Diskurs auf Berliner Ebene widmet. Mit der Methode der Diskursanalyse sollen anhand einer Debatte aus dem Berliner Abgeordnetenhaus folgende Fragen beantwortet werden: Wie konstruieren politische Diskurseliten den Begriff Parallelgesellschaft? Welche Machtwirkungen ergeben sich aus solch einer diskursiven Formation bzw. welche gesellschaftliche Realität ist damit verbunden? Welche politischen Ziele werden damit verfolgt?
Bei einer Analyse des Textes vermute ich auf folgende Sachverhalte zu stoßen: Die meisten Politiker distanzieren sich aus politischer Korrektheit von dem stark umstrittenen Terminus Parallelgesellschaft, verwenden ihn aber dennoch und sind damit an einer Produktion des Diskurses maßgeblich beteiligt. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vom Ghetto zur Parallelgesellschaft - Diskursiver Kontext
- Analyse der Parlamentarischen Debatte im Abgeordnetenhaus vom 25.11.2004
- Den Diskurs konstruierende Elemente
- „Wir“, die „Mehrheitsgesellschaft“, und die „Migranten“
- Ein „geschlossener Kosmos an Geschäften und Dienstleistungen“ - Metaphern
- Diskurstragende Kategorien und ihre Einbettung in die gesellschaftliche Realität
- Die stadträumliche Dimension
- Die kulturelle Dimension
- Die moralische Dimension
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Konstruktion des Begriffs „Parallelgesellschaft“ im politischen Diskurs. Sie analysiert eine Debatte im Berliner Abgeordnetenhaus vom 25. November 2004, um die Machtwirkungen dieser diskursiven Formation und die damit verbundene gesellschaftliche Realität zu erforschen. Die Arbeit beleuchtet die politischen Ziele, die mit der Verwendung des Begriffs verfolgt werden.
- Konstruktion des Begriffs „Parallelgesellschaft“ im politischen Diskurs
- Analyse der Machtwirkungen und der gesellschaftlichen Realität im Zusammenhang mit dem Diskurs
- Identifizierung der politischen Ziele hinter der Verwendung des Begriffs „Parallelgesellschaft“
- Entwicklung des Begriffs „Parallelgesellschaft“ im Vergleich zum Begriff „Ghetto“
- Der Einfluss des Mordes an Theo van Gogh auf die öffentliche Debatte um Parallelgesellschaften
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Parallelgesellschaften ein und beschreibt den uneinheitlichen und oft inhaltsleeren Gebrauch des Begriffs in der öffentlichen und politischen Debatte. Sie stellt die Forschungsfrage nach der Konstruktion des Begriffs durch politische Diskurseliten und den damit verbundenen Machtwirkungen und gesellschaftlichen Realitäten. Die Autorin kündigt ihre These an, dass Politiker den Begriff zwar aus politischer Korrektheit oft ablehnen, ihn aber dennoch verwenden und somit an seiner Konstruktion maßgeblich beteiligt sind.
Vom Ghetto zur Parallelgesellschaft - Diskursiver Kontext: Dieses Kapitel beleuchtet den historischen Kontext des Begriffs „Parallelgesellschaft“ im Vergleich zum Begriff „Ghetto“. Es wird der Wandel in der Verwendung und Bedeutung beider Begriffe dargestellt, beginnend mit dem räumlichen Ursprung des Begriffs „Ghetto“ im 16. Jahrhundert bis hin zur Verwendung von „Parallelgesellschaft“ im Kontext des islamischen Fundamentalismus und dem Mord an Theo van Gogh. Der Mord wird als diskursives Ereignis dargestellt, welches die öffentliche Debatte über Parallelgesellschaften maßgeblich beeinflusste und den Begriff in den Fokus rückte. Das Kapitel verdeutlicht die Verschiebung der Bedeutung von räumlicher Segregation hin zu einer kulturellen und sozialen Distanzierung.
Analyse der Parlamentarischen Debatte im Abgeordnetenhaus vom 25.11.2004: Dieses Kapitel analysiert die gewählte parlamentarische Debatte als Beispiel für den politischen Diskurs über Parallelgesellschaften. Es untersucht, wie der Begriff in der Debatte konstruiert wird, welche Akteure beteiligt sind und welche Sprechweisen verwendet werden. Die Analyse fokussiert vermutlich auf die verwendeten Metaphern und die sprachlichen Strategien, mit denen ein bestimmtes Bild von Migranten und der Mehrheitsgesellschaft geschaffen wird. Der Schwerpunkt liegt darauf, wie diese sprachlichen Praktiken zu bestimmten Machtwirkungen und gesellschaftlichen Realitäten führen.
Diskurstragende Kategorien und ihre Einbettung in die gesellschaftliche Realität: Dieser Abschnitt untersucht die verschiedenen Dimensionen, die mit dem Diskurs um Parallelgesellschaften verbunden sind. Es werden die stadträumliche, die kulturelle und die moralische Dimension analysiert und deren Bedeutung für die Konstruktion des Begriffs „Parallelgesellschaft“ herausgearbeitet. Die Kapitel ergründen vermutlich, wie diese Dimensionen miteinander verknüpft sind und wie sie zu einer spezifischen Wahrnehmung von Migrantengemeinschaften beitragen.
Schlüsselwörter
Parallelgesellschaft, Diskursanalyse, Integration, Migration, Ghetto, Multikulturalismus, politische Diskurseliten, Medien, Islamismus, Theo van Gogh, Deutschland, Berlin, gesellschaftliche Realität, Machtwirkungen.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: Konstruktion des Begriffs „Parallelgesellschaft“ im politischen Diskurs
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Konstruktion des Begriffs „Parallelgesellschaft“ im politischen Diskurs und analysiert dessen Machtwirkungen auf die gesellschaftliche Realität. Sie konzentriert sich auf die politische Debatte um diesen Begriff und die dahinterliegenden Ziele.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verwendet die Diskursanalyse, um eine parlamentarische Debatte im Berliner Abgeordnetenhaus vom 25. November 2004 zu untersuchen. Die Analyse fokussiert auf die verwendeten sprachlichen Strategien, Metaphern und die Konstruktion von „Wir“ (Mehrheitsgesellschaft) und „die Anderen“ (Migranten).
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Konstruktion des Begriffs „Parallelgesellschaft“, seine Machtwirkungen und die damit verbundene gesellschaftliche Realität. Weitere Schwerpunkte sind die politischen Ziele hinter der Verwendung des Begriffs, der Vergleich mit dem Begriff „Ghetto“, und der Einfluss des Mordes an Theo van Gogh auf die öffentliche Debatte.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum diskursiven Kontext (vom Ghetto zur Parallelgesellschaft), eine Analyse der parlamentarischen Debatte vom 25.11.2004, ein Kapitel zu den diskurs-tragenden Kategorien und deren Einbettung in die gesellschaftliche Realität (stadträumliche, kulturelle und moralische Dimension) und eine Schlussbemerkung.
Wie wird der Begriff „Parallelgesellschaft“ in der Arbeit definiert?
Die Arbeit untersucht, wie der Begriff „Parallelgesellschaft“ im politischen Diskurs konstruiert wird, und hinterfragt seinen oft uneinheitlichen und inhaltsleeren Gebrauch. Sie beleuchtet, wie er von politischen Akteuren verwendet und instrumentalisiert wird.
Welche Rolle spielt der Mord an Theo van Gogh?
Der Mord an Theo van Gogh wird als diskursives Ereignis dargestellt, welches die öffentliche Debatte über Parallelgesellschaften maßgeblich beeinflusste und den Begriff in den Fokus rückte.
Welche Dimensionen der „Parallelgesellschaft“ werden analysiert?
Die Arbeit analysiert die stadträumliche, die kulturelle und die moralische Dimension, die mit dem Diskurs um Parallelgesellschaften verbunden sind, und deren Bedeutung für die Konstruktion des Begriffs.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss (die genaue These ist im Detail der Einleitung zu entnehmen), dass Politiker den Begriff „Parallelgesellschaft“ zwar aus politischer Korrektheit oft ablehnen, ihn aber dennoch verwenden und somit an seiner Konstruktion maßgeblich beteiligt sind. Die detaillierte Schlussfolgerung findet sich in der Schlussbemerkung.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Parallelgesellschaft, Diskursanalyse, Integration, Migration, Ghetto, Multikulturalismus, politische Diskurseliten, Medien, Islamismus, Theo van Gogh, Deutschland, Berlin, gesellschaftliche Realität, Machtwirkungen.
- Quote paper
- Manuela Paul (Author), 2008, Das Sprechen über Parallelgesellschaften: Eine Diskursanalyse anhand einer Debatte im Berliner Abgeordnetenhaus vom 25. November 2004, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/123198