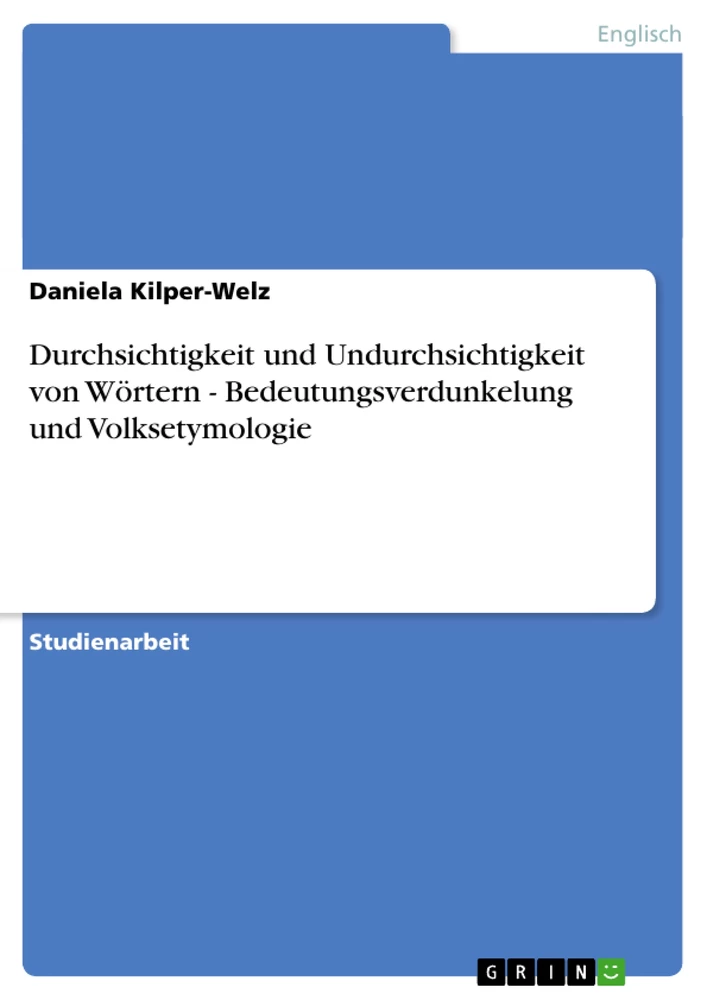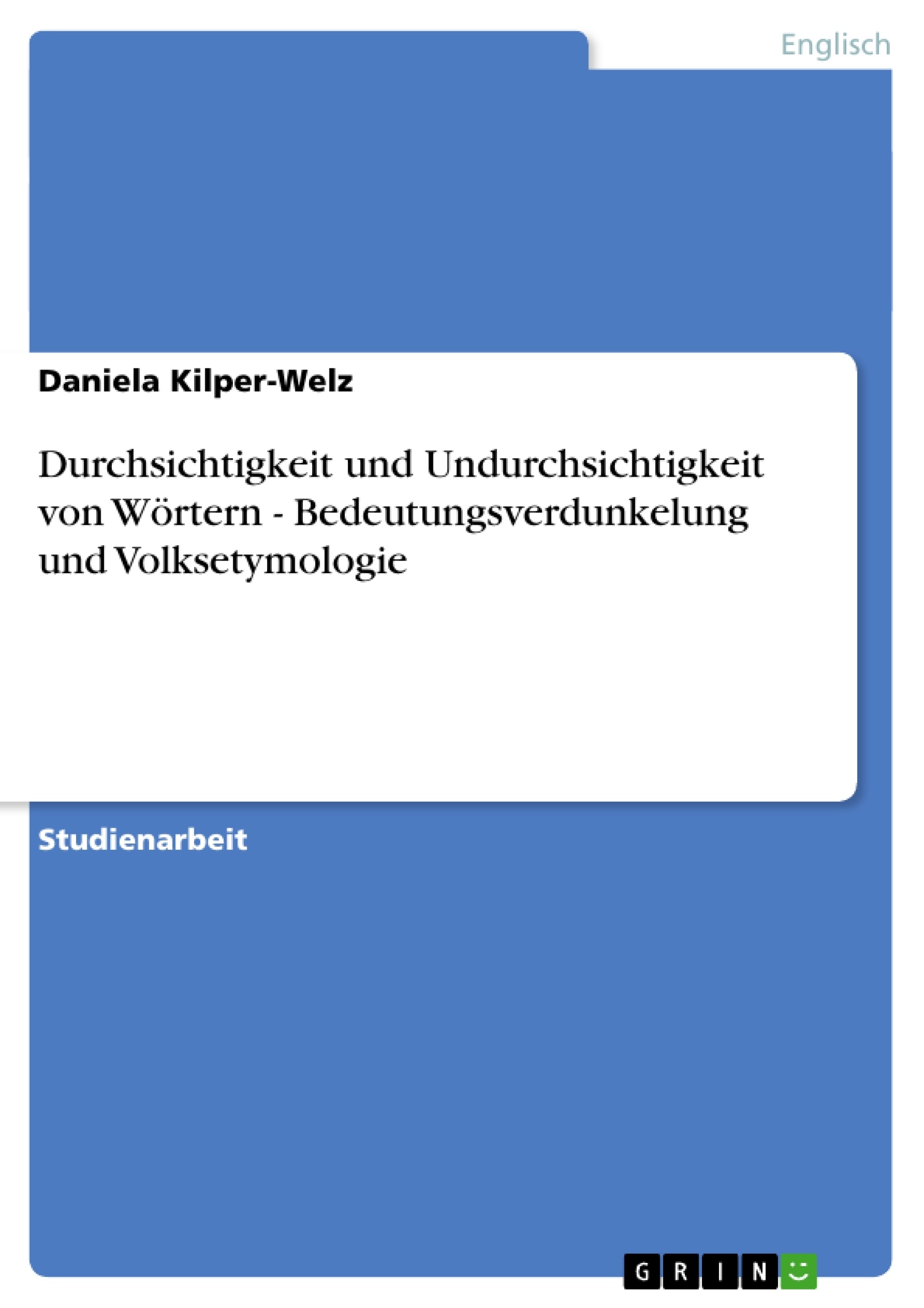Ein typisches Charakteristikum des englischen Wortschatzes ist die Dissoziation. Das bedeutet, dass die Strukturierung durch größere Wortfamilien, innerhalb derer die Verwandtschaft der einzelnen Wörter durch Mittel der Wortbildung wie etwa Ableitungssilben, Wortzusammensetzungen, Umlaut usw. leicht erkennbar ist, nach dem Altenglischen verloren ging. Die Hauptursache dafür war die Übernahme insbesondere lateinischer und französischer Wörter in großem Umfang, welche isoliert blieben, da sie etymologisch ungestützt waren. Diese, mit anderen Worten, „fremden Wörter“ nennt man auch „Hard Words“, da sie aufgrund ihrer Undurchsichtigkeit ohne fremdsprachliche Kenntnisse nur schwer zu verstehen sind. Da aber jede Sprache bzw. deren Sprecher das Bestreben haben, Wörter zu motivieren, ist also das Englische aufgrund seiner bewegten Sprachgeschichte, in der zahlreiche fremde Sprachen Einfluss nahmen, besonders anfällig für Erscheinungen wie Volksetymologie bzw. Sekundäre Motivation.
Im folgenden soll es nun zum einen um die Abgrenzung und Erläuterung der Begriffe „Durchsichtigkeit“ und „Undurchsichtigkeit“ von Wörtern gehen. Zum anderen sollen die zahlreichen Möglichkeiten der Bedeutungsverdunkelung von Wörtern, die nicht zu den Hard Words zählen, da sie aus dem Altenglischen stammen, dargestellt werden. Weiterhin soll die Folge von Dissoziation oder Bedeutungsverdunkelung, also die Remotivierung oder die Volksetymologie bzw. die sekundäre Motivation, mit Beispielen näher beleuchtet werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Durchsichtige und undurchsichtige Wörter
- 2.1 Durchsichtige Wörter
- 2.1.1 Die formale Konstitution des durchsichtigen Wortes
- 2.2 Undurchsichtige Wörter
- 3 Bedeutungsverdunkelung
- 3.1 Verdunkelung durch Schwachtonigkeit eines Kompositionsgliedes oder schwachtonige Verwendung von Wörtern
- 3.2 Bedeutungsverdunkelung durch lautliche Assimilation
- 3.3 Bedeutungsverdunkelung durch Aussterben eines oder mehrerer Kompositionsglieder als Simplizia
- 3.4 Weitere mögliche Ursachen für eine Bedeutungsverdunkelung
- 3.5 Folgen von Bedeutungsverdunkelungen
- 4 Volksetymologie bzw. Sekundäre Motivation
- 4.1 Phonologische Motivation
- 4.1.1 Motivation durch phonologische Angleichung an bestehende Wortformen
- 4.1.2 Motivation durch Lautersatz
- 4.1.3 Motivation durch Umgehung fremder Lautverbindungen
- 4.1.4 Motivation durch Akzentverlagerung
- 4.1.5 Motivation durch neue Aufgliederung eines Wortes
- 4.1.6 Motivation durch Wortkürzung
- 4.2 Phonologisch-semantische Motivation
- 4.2.1 Sekundäre lautsymbolische Motivation
- 4.3 Semantische Motivation
- 4.4 Abgrenzung gegenüber ähnlichen Erscheinungen
- 4.4.1 Malaprops
- 4.4.2 Agglutination und Deglutination des Artikels
- 4.4.3 Kontamination
- 4.4.4 Back-formation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht die Durchsichtigkeit und Undurchsichtigkeit von Wörtern im Englischen, insbesondere die Bedeutungsverdunkelung und die daraus resultierende Volksetymologie oder sekundäre Motivation. Der Fokus liegt auf der Erklärung dieser Phänomene und ihrer Auswirkungen auf die Wortbildung und -bedeutung.
- Definition und Abgrenzung von durchsichtigen und undurchsichtigen Wörtern
- Analyse verschiedener Ursachen für Bedeutungsverdunkelung
- Erläuterung des Prozesses der Volksetymologie und sekundären Motivation
- Untersuchung der formalen Konstitution durchsichtiger Wörter
- Abgrenzung zu ähnlichen sprachlichen Phänomenen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und beschreibt die Dissoziation im Englischen als ein typisches Charakteristikum, welches durch die Übernahme lateinischer und französischer Wörter entstand. Sie erklärt den Begriff "Hard Words" und die Anfälligkeit des Englischen für Volksetymologie aufgrund seiner Sprachgeschichte. Die Arbeit kündigt die bevorstehende Abgrenzung und Erläuterung der Begriffe „Durchsichtigkeit“ und „Undurchsichtigkeit“, die Darstellung der Bedeutungsverdunkelung und die Analyse der Volksetymologie an.
2 Durchsichtige und undurchsichtige Wörter: Dieses Kapitel definiert und differenziert zwischen durchsichtigen und undurchsichtigen Wörtern. Durchsichtige Wörter werden als Wörter beschrieben, deren Ableitung oder Zusammensetzung für den Sprecher transparent ist, während undurchsichtige Wörter diese Transparenz vermissen lassen. Der Text erläutert den Begriff der "Durchsichtigkeit" anhand von Beispielen wie "driver" (von "to drive"), "crossword puzzle" und "pancake", wobei die Bedeutung der Konstituenten die Bedeutung des Gesamtwortes erklärt. Komposita werden als sekundär motiviert beschrieben, da die Bedeutung des Ganzen in einem durchsichtigen Verhältnis zu den Inhalten der Konstituenten steht. Es wird auch gezeigt, dass das "Ursprungswort" nicht immer vollständig enthalten sein muss, um ein Wort als durchsichtig zu klassifizieren.
3 Bedeutungsverdunkelung: Dieses Kapitel befasst sich mit den verschiedenen Ursachen für Bedeutungsverdunkelung. Es werden Faktoren wie die Schwachtonigkeit von Kompositionsgliedern, lautliche Assimilation und das Aussterben von Kompositionsgliedern als Simplizia diskutiert. Die verschiedenen Arten der Bedeutungsverdunkelung werden detailliert erklärt und mit Beispielen veranschaulicht. Die Kapitel fasst die möglichen Ursachen für Bedeutungsänderungen zusammen und diskutiert die Konsequenzen dieser Veränderungen für das Verständnis und die Verwendung der betroffenen Wörter.
4 Volksetymologie bzw. Sekundäre Motivation: Dieses Kapitel analysiert die Volksetymologie und sekundäre Motivation als Folge der Bedeutungsverdunkelung. Es unterteilt die Motivation in phonologische und semantische Aspekte, wobei die phonologische Motivation verschiedene Arten der Angleichung an bestehende Wortformen, Lautersatz, Umgehung fremder Lautverbindungen, Akzentverlagerung, neue Aufgliederung und Wortkürzung umfasst. Der Text unterscheidet weiter zwischen phonologisch-semantischer Motivation und rein semantischer Motivation, und beleuchtet zudem die Abgrenzung zu ähnlichen Erscheinungen wie Malaprops, Agglutination/Deglutination des Artikels, Kontamination und Back-formation. Es wird dargelegt wie durch Volksetymologie und sekundäre Motivation Wörter eine neue Bedeutung oder Motivation erhalten, oft durch die Anpassung an bereits existierende sprachliche Muster.
Schlüsselwörter
Durchsichtigkeit, Undurchsichtigkeit, Wörter, Bedeutungsverdunkelung, Volksetymologie, Sekundäre Motivation, Wortbildung, Komposita, Englisch, Sprachgeschichte, Phonologie, Semantik.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Durchsichtigkeit und Undurchsichtigkeit von Wörtern im Englischen
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Durchsichtigkeit und Undurchsichtigkeit von Wörtern im Englischen, mit besonderem Fokus auf Bedeutungsverdunkelung und die daraus resultierende Volksetymologie oder sekundäre Motivation. Es werden die Ursachen dieser Phänomene und ihre Auswirkungen auf die Wortbildung und -bedeutung analysiert.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Abgrenzung von durchsichtigen und undurchsichtigen Wörtern, die Analyse verschiedener Ursachen für Bedeutungsverdunkelung (z.B. Schwachtonigkeit, lautliche Assimilation, Aussterben von Wortbestandteilen), die Erläuterung der Volksetymologie und sekundären Motivation (inklusive phonologischer und semantischer Aspekte), die Untersuchung der formalen Konstitution durchsichtiger Wörter und die Abgrenzung zu ähnlichen sprachlichen Phänomenen wie Malaprops, Kontamination und Back-formation.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu durchsichtigen und undurchsichtigen Wörtern, Bedeutungsverdunkelung und Volksetymologie/sekundärer Motivation. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Erklärung der jeweiligen Thematik mit Beispielen. Die Einleitung beschreibt den Hintergrund und die Zielsetzung, während ein abschließendes Kapitel Schlüsselbegriffe zusammenfasst.
Was versteht man unter „durchsichtigen“ und „undurchsichtigen“ Wörtern?
Durchsichtige Wörter sind Wörter, deren Zusammensetzung und Ableitung für den Sprecher transparent ist (z.B. "driver"). Undurchsichtige Wörter hingegen lassen diese Transparenz vermissen, ihre Herkunft und Bedeutung sind nicht unmittelbar ersichtlich.
Was ist Bedeutungsverdunkelung und welche Ursachen gibt es?
Bedeutungsverdunkelung beschreibt den Prozess, bei dem die ursprüngliche Zusammensetzung und Bedeutung eines Wortes im Laufe der Zeit nicht mehr erkennbar ist. Ursachen hierfür sind unter anderem die Schwachtonigkeit von Wortbestandteilen, lautliche Assimilation und das Aussterben einzelner Wortteile.
Was ist Volksetymologie bzw. sekundäre Motivation?
Volksetymologie oder sekundäre Motivation beschreibt die Neubedeutung oder -motivation eines Wortes aufgrund von Ähnlichkeiten zu anderen Wörtern oder aufgrund von Fehlinterpretationen. Dies kann durch phonologische (lautliche) oder semantische (bedeutungsmäßige) Angleichungen geschehen.
Welche ähnlichen sprachlichen Phänomene werden abgegrenzt?
Die Arbeit grenzt Volksetymologie von ähnlichen Phänomenen wie Malaprops (Verwechslung ähnlicher Wörter), Agglutination/Deglutination des Artikels, Kontamination (Vermischung von Wörtern) und Back-formation (Ableitung eines Wortes durch Rückbildung) ab.
Welche Rolle spielt die englische Sprachgeschichte?
Die englische Sprachgeschichte, insbesondere die Übernahme lateinischer und französischer Wörter, spielt eine wichtige Rolle, da sie die Anfälligkeit des Englischen für Volksetymologie und Bedeutungsverdunkelung erklärt. Die Arbeit erwähnt den Begriff "Hard Words" und die Dissoziation im Englischen als typisches Charakteristikum.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Durchsichtigkeit, Undurchsichtigkeit, Wörter, Bedeutungsverdunkelung, Volksetymologie, Sekundäre Motivation, Wortbildung, Komposita, Englisch, Sprachgeschichte, Phonologie, Semantik.
- Quote paper
- Daniela Kilper-Welz (Author), 2002, Durchsichtigkeit und Undurchsichtigkeit von Wörtern - Bedeutungsverdunkelung und Volksetymologie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/12318