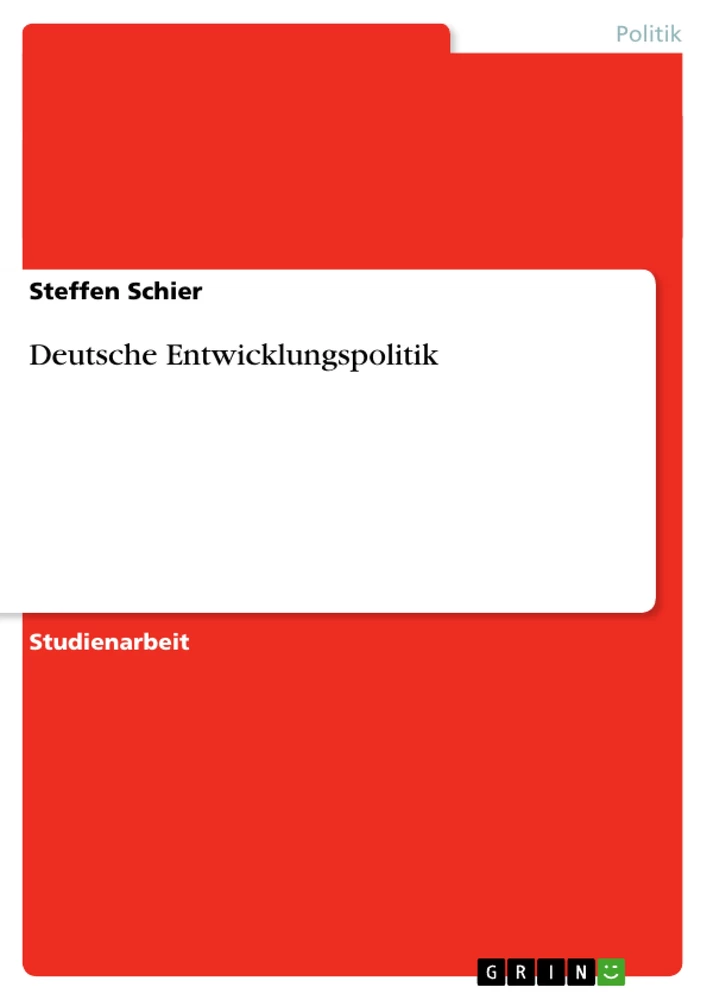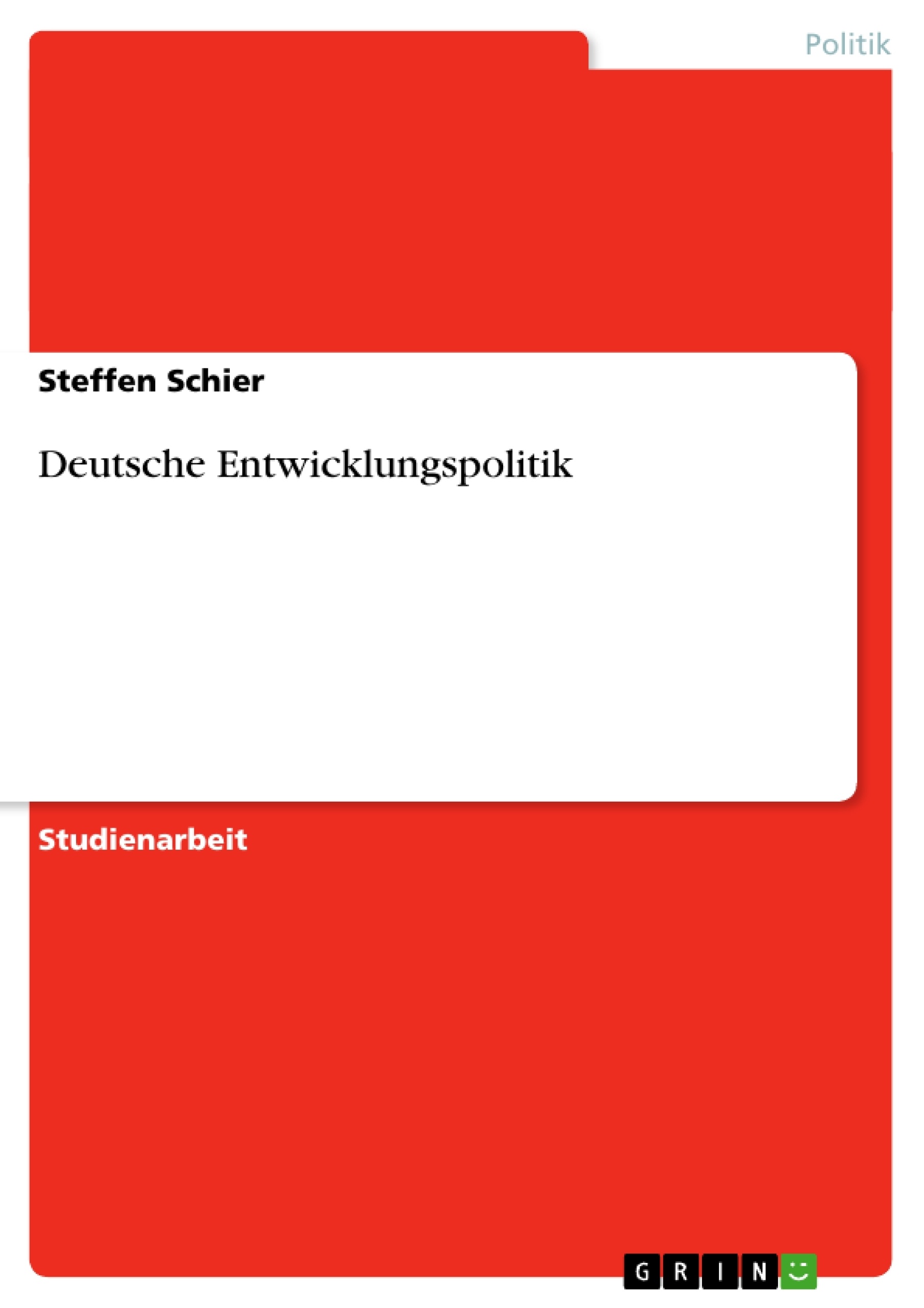taatliche Entwicklungspolitik begann in Deutschland 1952 mit einer finanziellen Unterstützung an einem Beistandsprogramm der UN zur wirtschaftlichen Entwicklung von Ländern der Dritten Welt, sowie eines 1956 eingerichteten “50-Millionen-Fonds“ des Auswärtigen Amtes. 1961 wurde das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (seit 1993 Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung), auf Grund des steigenden Hilfsvolumens der Bundesrepublik, mit Walter Scheel als ersten Minister, gegründet. Drei Jahre später, 1964, wurde dem BMZ die Zuständigkeit für Grundsätze und Programme der Entwicklungspolitik sowie für die Technische Zusammenarbeit (TZ) erteilt. Als das BMZ die Zuständigkeit für die bi- und multilaterale Finanzielle Zusammenarbeit (FZ) erhielt, war das BMZ nicht mehr nur mit der Aufgabenkoordinierung beauftragt. Auch war die Entwicklungspolitik ab 1972 als eigenständiger Politikbereich anerkannt.
Parallel zur staatlichen Entwicklungshilfe entstanden Entwicklungshilfeprogramme von Nichtregierungsorganisationen (NGO), wie zum Beispiel Kirchen, Stiftungen oder Verbänden. Diese werden nur durch Eigenmittel und vor allem durch Spenden gewährleistet bzw. finanziert. Historisch ist diese Spendenbereitschaft der deutschen Bevölkerung mit der umfangreiche Auslandshilfe beim Aufbau des zerstörten Nachkriegsdeutschland zu erklären. Das heißt, seit der Zeit des deutschen Wirtschaftswunders und dem damit verbundenen Wohlstand, wollte man nun selbst ärmeren Ländern helfen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Deutsche Entwicklungspolitik - eine kurze Einführung
- 2.1. Wer leistet Entwicklungshilfe (NGO's ausgenommen)?
- 2.2. Deutsche Entwicklungshilfe in Zahlen
- 3. Fakten zur deutschen Entwicklungspolitik
- 3.1. Gründe
- 3.2. Kriterien
- 3.3. Ziele
- 4. Fallbeispiel VR China
- 5. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die deutsche staatliche Entwicklungshilfe. Das Ziel ist es, einen Überblick über die Akteure, das Volumen, die Gründe, Kriterien und Ziele der deutschen Entwicklungspolitik zu geben. Die Arbeit analysiert auch, inwieweit sich Deutschland an seine eigenen Vergabekriterien hält, indem sie das Beispiel der VR China heranzieht.
- Akteure der deutschen Entwicklungshilfe
- Volumen der deutschen Entwicklungshilfe im internationalen Vergleich
- Gründe, Kriterien und Ziele der deutschen Entwicklungspolitik
- Analyse der Vergabekriterien anhand des Fallbeispiels VR China
- Machtstaatliche, handelsstaatliche und zivilstaatliche Aspekte der deutschen Entwicklungspolitik
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung skizziert den Beginn der deutschen staatlichen Entwicklungspolitik im Jahr 1952 und ihren Ausbau bis zur Anerkennung als eigenständiger Politikbereich 1972. Sie beschreibt den parallel entstandenen Sektor der Entwicklungshilfe durch Nichtregierungsorganisationen und kündigt den Fokus der Arbeit auf die staatliche Entwicklungshilfe an. Die Arbeit verspricht eine Untersuchung der Akteure, des Volumens, der Gründe, Kriterien und Ziele der deutschen Entwicklungspolitik, untermauert durch ein Fallbeispiel (VR China), welches die Anwendung der Vergabekriterien beleuchten soll.
2. Deutsche Entwicklungspolitik - eine kurze Einführung: Dieses Kapitel bietet zunächst einen Überblick über die Institutionen, die in Deutschland Entwicklungshilfe leisten, mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) an der Spitze. Es wird der Anteil des BMZ am Gesamtbudget der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit (ODA) dargestellt und weitere beteiligte Ministerien (Auswärtiges Amt, Wissenschaftsministerium, Wirtschaftsministerium) sowie Bundesländer und Kommunen genannt. Der Abschnitt über die deutschen Zuwendungen im internationalen Vergleich positioniert Deutschland als eines der größten Geberländer.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Deutsche Entwicklungspolitik
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die deutsche staatliche Entwicklungshilfe. Sie analysiert die Akteure, das Volumen, die Gründe, Kriterien und Ziele dieser Politik und beleuchtet anhand des Fallbeispiels VR China die Anwendung der Vergabekriterien.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Akteure der deutschen Entwicklungshilfe, Volumen der deutschen Entwicklungshilfe im internationalen Vergleich, Gründe, Kriterien und Ziele der deutschen Entwicklungspolitik, Analyse der Vergabekriterien anhand des Fallbeispiels VR China, sowie machtstaatliche, handelsstaatliche und zivilstaatliche Aspekte der deutschen Entwicklungspolitik.
Welche Akteure der deutschen Entwicklungshilfe werden betrachtet?
Die Hausarbeit betrachtet das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) als zentralen Akteur, aber auch weitere beteiligte Ministerien (Auswärtiges Amt, Wissenschaftsministerium, Wirtschaftsministerium), Bundesländer und Kommunen. Der Unterschied zu den nicht-staatlichen Akteuren (NGOs) wird hervorgehoben.
Wie wird das Volumen der deutschen Entwicklungshilfe dargestellt?
Die Arbeit quantifiziert das Volumen der deutschen Entwicklungshilfe und vergleicht es im internationalen Kontext, um Deutschlands Position als eines der größten Geberländer zu verdeutlichen. Der Anteil des BMZ am Gesamtbudget der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit (ODA) wird ebenfalls dargestellt.
Welche Gründe, Kriterien und Ziele der deutschen Entwicklungspolitik werden untersucht?
Die Hausarbeit untersucht die Beweggründe, die Kriterien für die Vergabe von Entwicklungshilfe und die damit verfolgten Ziele der deutschen Politik. Diese werden im Detail analysiert und im Kontext des Fallbeispiels VR China beleuchtet.
Wie wird das Fallbeispiel VR China in die Analyse eingebunden?
Das Fallbeispiel VR China dient der Analyse, inwieweit sich Deutschland an seine eigenen Vergabekriterien für Entwicklungshilfe hält. Es ermöglicht eine konkrete Anwendung der theoretischen Überlegungen.
Welche Aspekte der deutschen Entwicklungspolitik werden besonders betrachtet?
Die Hausarbeit beleuchtet machtstaatliche, handelsstaatliche und zivilstaatliche Aspekte der deutschen Entwicklungspolitik, um die verschiedenen Dimensionen dieser Politik zu erfassen.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel, welche die wesentlichen Inhalte und Erkenntnisse jedes Kapitels prägnant zusammenfasst. Die Einleitung skizziert dabei den historischen Kontext und den Fokus der Arbeit, während die Zusammenfassung der weiteren Kapitel die jeweiligen Analyseergebnisse zusammenfasst.
Was beinhaltet das Inhaltsverzeichnis?
Das Inhaltsverzeichnis umfasst eine Einleitung, eine kurze Einführung in die deutsche Entwicklungspolitik (inkl. Akteure und Zahlen), Fakten zur deutschen Entwicklungspolitik (Gründe, Kriterien, Ziele), ein Fallbeispiel VR China und eine abschließende Zusammenfassung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Hausarbeit?
Die Hausarbeit zielt darauf ab, einen umfassenden Überblick über die deutsche staatliche Entwicklungshilfe zu geben und deren Praxis anhand eines Fallbeispiels zu analysieren.
- Quote paper
- Steffen Schier (Author), 2002, Deutsche Entwicklungspolitik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/12314