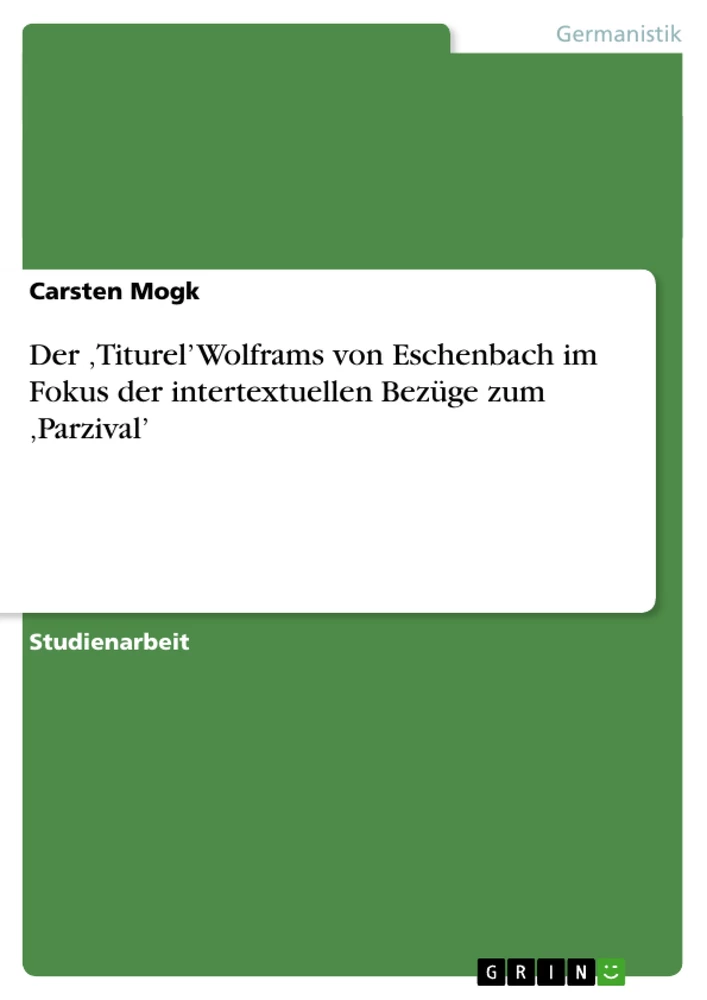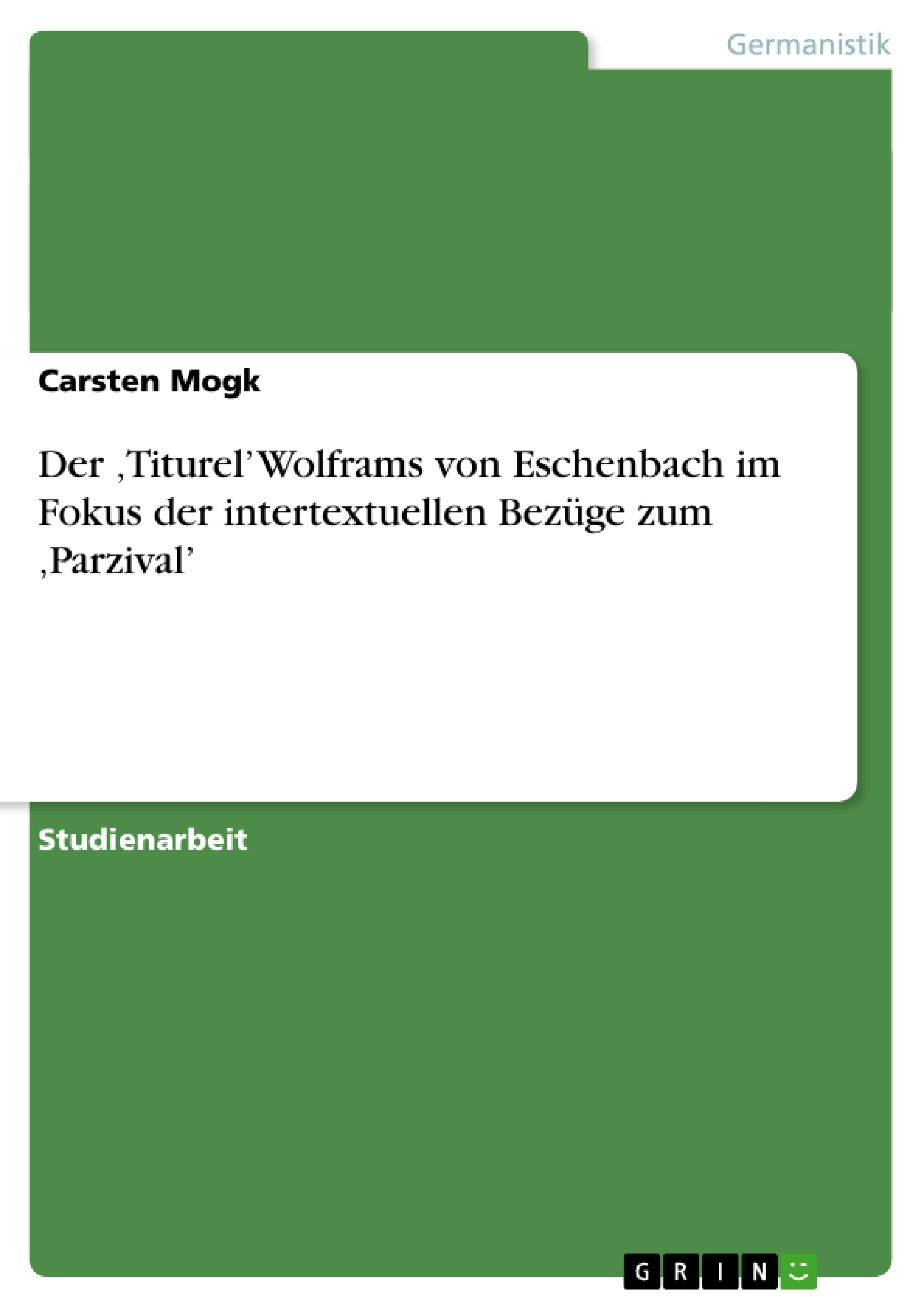Der ‚Titurel’ Wolframs von Eschenbach nimmt innerhalb der mittelalterlichen Epik in mehrfacher Hinsicht eine besondere Stellung ein. Zum einen ist es der Fragmentcharakter, der auch in der Lektüre immer wieder Rätsel aufgibt, zum anderen ist es seine sprachliche Vielschichtigkeit, die zuweilen den Eindruck des Verschlüsselten hinterlässt. Und nicht zuletzt die Thematik der höfischen Minne, die am Beispiel der jungen Liebenden Sigune und Schionatulander vorgeführt wird, macht das Werk zu einem der meistbeachteten seiner Zeit. Diese Minnebeziehung wird auch in vier bedeutenden Szenen des wolframschen Parzival, den sogenannten Sigunebegegnungen, am Rande thematisiert. Sigune betrauert in diesen Szenen den Tod ihres geliebten Schionatulander, sodass der ‚Titurel’ eine Art nachgeschobene Vorgeschichte dieser Szenen darstellt.
Die vorliegende Arbeit soll das Verhältnis zwischen dem ‚Titurel’ und dem ‚Parzival’, am Beispiel intertextueller Bezüge beleuchten. Ausgehend von einer allgemeinen, literatur- und sprachwissenschaftlichen Annäherung an den Intertextualitätsbegriff sollen dessen Besonderheiten im Bezug auf das mittelalterliche Literaturverständnis erläutert werden. Die Untersuchung intertextueller Bezüge soll dabei anhand zentraler Themenkreise und wesentlicher Strukturmerkmale erfolgen, die gleichsam nur eine Auswahl an möglichen Untersuchungsgegenständen darstellt.
Die Schwerpunkt der Untersuchung liegt dabei stets auf der Frage, was der Erfahrungshorizont des ‚Parzival’ für das Verständnis des ‚Titurel’ leisten kann und wo die Grenzen einer Rezeption unter intertextuellen Gesichtspunkten liegen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Zum Intertextualitätsbegriff
- 2.1 Allgemeine Begriffsdeutungen
- 2.2 Intertextualität in mittelalterlicher Literatur
- 3 Zur Intertextualität im Titurel
- 3.1 Intertextualität in Form und Struktur – Wolframs Erzählkonzept im Parzival-Kontext
- 3.1.1 Die Prologizität der Titurel-Strophen
- 3.1.2 Das Bogen-Motiv als Mittel der Perspektiverweiterung
- 3.2 Intertextualität in den Handlungssequenzen
- 3.2.1 Die Sigunehandlung
- 3.2.2 Zu den Minneexkurse
- 3.2.3 Die Gahmuret-Handlung – Zur Intertextualität der Amflise-Figur
- 3.1 Intertextualität in Form und Struktur – Wolframs Erzählkonzept im Parzival-Kontext
- 4 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die intertextuellen Bezüge zwischen Wolframs von Eschenbachs Titurel und seinem Parzival. Das Ziel ist es, das Verhältnis der beiden Werke anhand zentraler Themen und Strukturmerkmale zu beleuchten und den Beitrag des Parzival-Erfahrungshorizonts zum Verständnis des fragmentarischen Titurel zu ergründen. Die Grenzen einer rein intertextuellen Rezeption werden dabei ebenfalls thematisiert.
- Intertextualität als literaturwissenschaftlicher Begriff und seine Anwendung auf mittelalterliche Literatur
- Formale und strukturelle Intertextualität zwischen Titurel und Parzival (z.B. Prolog, Bogenmotiv)
- Intertextuelle Bezüge in den Handlungssequenzen (z.B. Sigunehandlung, Minneexkurse, Gahmuret-Handlung)
- Der Beitrag des Parzival zum Verständnis des Titurel
- Grenzen einer intertextuellen Rezeption des Titurel
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt den besonderen Status des Titurel innerhalb der mittelalterlichen Epik aufgrund seines fragmentarischen Charakters, seiner sprachlichen Komplexität und seiner Thematik der höfischen Minne, exemplarisch dargestellt an der Liebesgeschichte Sigunes und Schionatulanders. Die Arbeit kündigt die Untersuchung des Verhältnisses zwischen Titurel und Parzival unter dem Aspekt intertextueller Bezüge an und skizziert den methodischen Ansatz.
2 Zum Intertextualitätsbegriff: Dieses Kapitel nähert sich dem vielschichtigen Begriff der Intertextualität an. Es diskutiert verschiedene Definitionsansätze, insbesondere die Bedeutung von Textbeziehungen, Autorenintention und den unterschiedlichen Dimensionen der Intertextualität (vertikal und horizontal). Es werden verschiedene Formen intertextueller Bezüge erläutert, wie Zitate, Mottos, Anspielungen, Parodien und Travestien, und es wird der Grad der Intertextualität anhand von Kriterien wie Sinnkomplexion, Dialogizität und Referentialität differenziert.
3 Zur Intertextualität im Titurel: Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit und untersucht die intertextuellen Bezüge zwischen Titurel und Parzival. Es analysiert sowohl formale und strukturelle Parallelen als auch inhaltliche Bezüge in den Handlungssequenzen. Die Analyse berücksichtigt die Prologizität der Titurel-Strophen, das Bogenmotiv als Mittel der Perspektiverweiterung, die Sigunehandlung, die Minneexkurse und die Gahmuret-Handlung mit besonderem Fokus auf die Figur der Amflise. Der Fokus liegt auf der Frage, wie der Parzival zum Verständnis des Titurel beiträgt und wo die Grenzen einer solchen intertextuellen Betrachtung liegen.
Schlüsselwörter
Titurel, Parzival, Wolfram von Eschenbach, Intertextualität, Mittelalterliche Epik, Minne, Höfische Literatur, Erzählstruktur, Form und Inhalt, Textanalyse, Literaturwissenschaft.
Titurel und Parzival: Ein intertextueller Vergleich - FAQs
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die intertextuellen Bezüge zwischen Wolframs von Eschenbachs Titurel und seinem Parzival. Ziel ist es, das Verhältnis der beiden Werke anhand zentraler Themen und Strukturmerkmale zu beleuchten und den Beitrag des Parzival-Erfahrungshorizonts zum Verständnis des fragmentarischen Titurel zu ergründen. Dabei werden auch die Grenzen einer rein intertextuellen Rezeption thematisiert.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: Intertextualität als literaturwissenschaftlicher Begriff und seine Anwendung auf mittelalterliche Literatur; formale und strukturelle Intertextualität zwischen Titurel und Parzival (z.B. Prolog, Bogenmotiv); intertextuelle Bezüge in den Handlungssequenzen (z.B. Sigunehandlung, Minneexkurse, Gahmuret-Handlung); der Beitrag des Parzival zum Verständnis des Titurel; und die Grenzen einer intertextuellen Rezeption des Titurel.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zum Intertextualitätsbegriff, ein zentrales Kapitel zur Intertextualität im Titurel und ein Fazit. Das Kapitel zur Intertextualität im Titurel analysiert sowohl formale und strukturelle Parallelen als auch inhaltliche Bezüge in den Handlungssequenzen zwischen Titurel und Parzival.
Welche Aspekte der Intertextualität werden untersucht?
Die Analyse umfasst formale und strukturelle Parallelen wie die Prologizität der Titurel-Strophen und das Bogenmotiv als Mittel der Perspektiverweiterung. Inhaltlich werden die Sigunehandlung, die Minneexkurse und die Gahmuret-Handlung (mit Fokus auf Amflise) untersucht. Die Arbeit differenziert verschiedene Formen intertextueller Bezüge wie Zitate, Anspielungen, Parodien und Travestien.
Welche Bedeutung hat der Parzival für das Verständnis des Titurel?
Ein zentrales Anliegen der Arbeit ist es, zu ergründen, inwiefern das Verständnis des fragmentarischen Titurel durch den Parzival erweitert werden kann. Die Analyse untersucht, wie der Parzival-Erfahrungshorizont zum Verständnis des Titurel beiträgt und wo die Grenzen einer solchen intertextuellen Betrachtung liegen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Titurel, Parzival, Wolfram von Eschenbach, Intertextualität, Mittelalterliche Epik, Minne, Höfische Literatur, Erzählstruktur, Form und Inhalt, Textanalyse, Literaturwissenschaft.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt den besonderen Status des Titurel innerhalb der mittelalterlichen Epik aufgrund seines fragmentarischen Charakters, seiner sprachlichen Komplexität und seiner Thematik der höfischen Minne (exemplarisch dargestellt an der Liebesgeschichte Sigunes und Schionatulanders). Die Arbeit kündigt die Untersuchung des Verhältnisses zwischen Titurel und Parzival unter dem Aspekt intertextueller Bezüge an und skizziert den methodischen Ansatz.
Was wird im Kapitel zum Intertextualitätsbegriff behandelt?
Dieses Kapitel diskutiert verschiedene Definitionsansätze des Begriffs Intertextualität, die Bedeutung von Textbeziehungen, Autorenintention und die unterschiedlichen Dimensionen der Intertextualität (vertikal und horizontal). Es werden verschiedene Formen intertextueller Bezüge erläutert und der Grad der Intertextualität anhand von Kriterien wie Sinnkomplexion, Dialogizität und Referentialität differenziert.
- Quote paper
- Carsten Mogk (Author), 2006, Der ‚Titurel’ Wolframs von Eschenbach im Fokus der intertextuellen Bezüge zum ‚Parzival’, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/123099