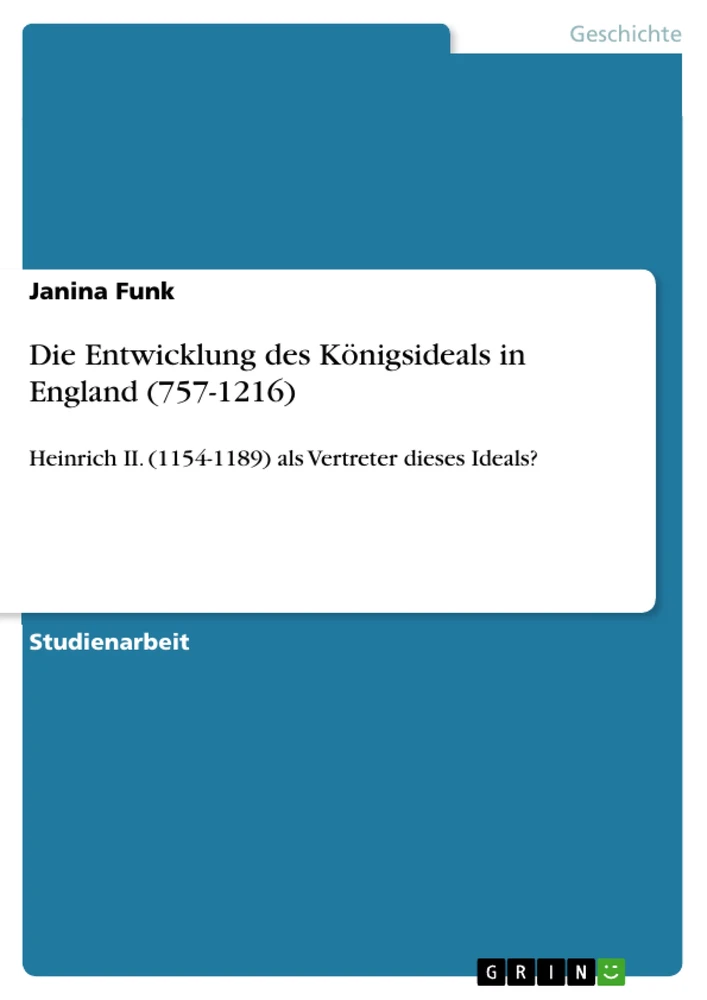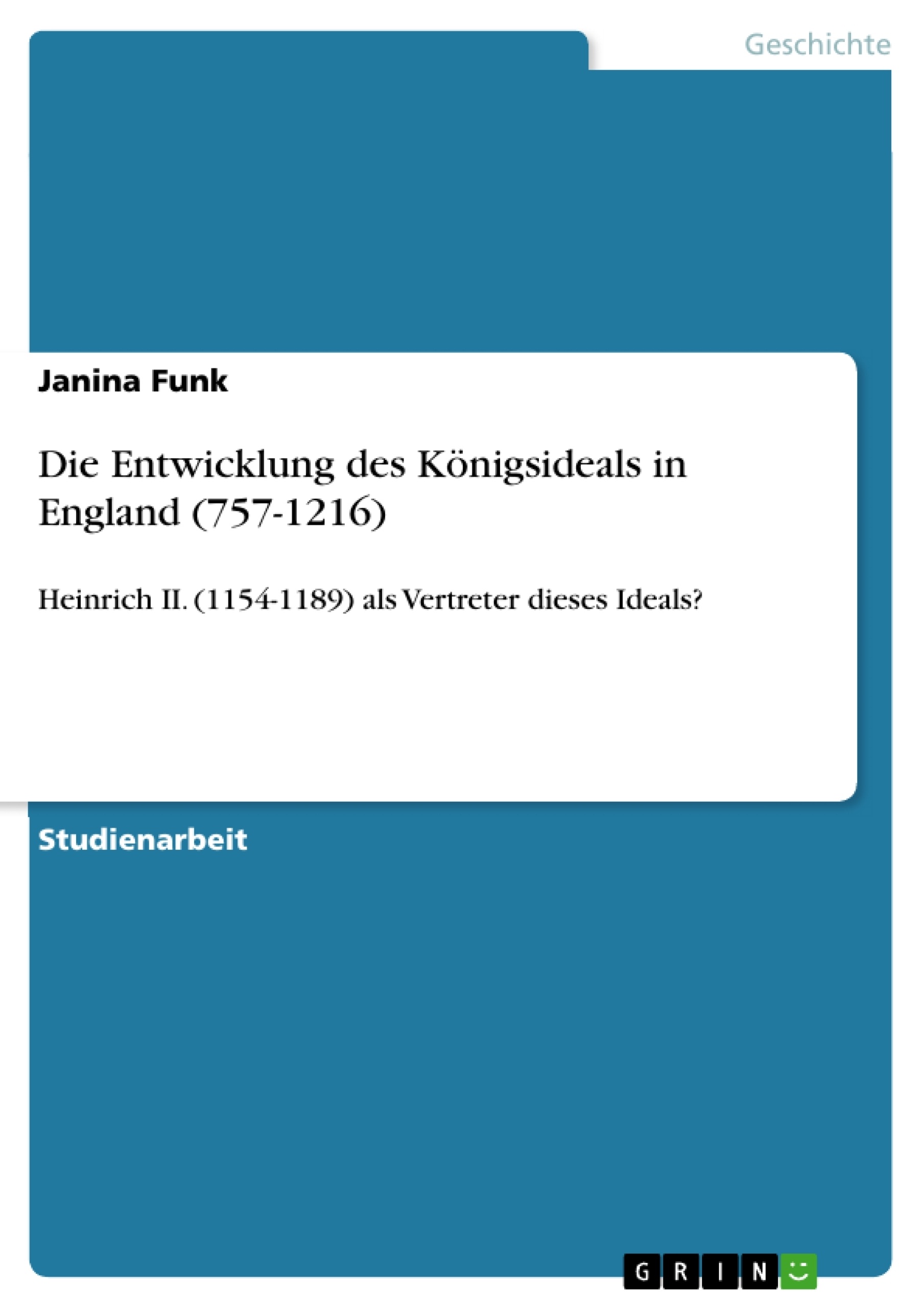Das Königtum in England im Mittelalter erweist sich als interessanter Untersuchungsgegenstand, da sich auf den Britischen Inseln das Verhältnis zwischen dem Königtum und der Stellung der Kirche deutlich von den Verhältnissen auf dem Kontinent unterschieden. Während sich auf dem Kontinent durch den Investiturstreit allmählich die Machtaufteilung zwischen weltlicher und klerikaler Herrscher zu regeln versuchte, galt in England noch die traditionelle Stellung des Königs über der Kirche. In einem solchen Staatsverhältnis ist es besonders lohnenswert zu betrachten, wie dann ein solch mächtiger Regent zu stilisieren versucht wurde und welche Eigenschaften einem Idealbild zugesprochen wurden. Anhand der wechselnden herrschenden Dynastien in England haben sich verschiedene Idealtypisierungen ergeben und ich möchte in dieser Arbeit darlegen, inwiefern Heinrich II. diesem Idealtypus entsprach. Dabei werde ich auch auf die mir wichtig erscheinenden königlichen Vorgänger zu sprechen kommen und versuchen ein Idealbild nachzuzeichnen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Heinrich II. - eine Regentschaft im Zeichen des Ideals?
- 1. Erhaltung des Reichs – Heinrich II. als geschickter Regent
- 2. Bewusste Beeinflussung der Geschichtsschreibung – Propagandamittel der Plantagenets und gesicherter Erhalt ihrer Historie
- 3. Folgenreicher Interessenkonflikt zwischen König und Kirche
- III. Seine Vorgänger - Herausbildung des Königsideals am Beispiel einiger Könige
- IV. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung des Königsideals in England zwischen 757 und 1216 und analysiert, inwieweit Heinrich II. (1154-1189) dieses Ideal verkörperte. Die Arbeit zeichnet ein Bild des Idealtypus des englischen Königs nach und vergleicht Heinrich II. mit seinen Vorgängern.
- Entwicklung des Königsideals in England (757-1216)
- Heinrich II. als Repräsentant des Königsideals
- Vergleich Heinrichs II. mit seinen Vorgängern
- Die Rolle der Kirche im Verhältnis zum Königtum
- Die Bedeutung von Herrschaft und Diplomatie
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des englischen Königtums im Mittelalter ein und hebt die Besonderheit des Verhältnisses zwischen Königtum und Kirche in England im Vergleich zum Kontinent hervor. Sie beschreibt die Forschungsfrage, inwieweit Heinrich II. dem Idealbild eines englischen Königs entsprach, und kündigt den Vergleich mit wichtigen Vorgängern an.
II. Heinrich II. – eine Regentschaft im Zeichen des Ideals?: Dieses Kapitel analysiert die Herrschaft Heinrichs II. im Hinblick auf das Königsideal. Es beschreibt seine territorialen Erweiterungen durch geschickte Heiratspolitik und militärische Erfolge, die Stärkung seines Reiches durch Diplomatie und die Herausforderungen, die mit der Führung eines komplexen, auf Personenverbunden basierenden Reiches verbunden waren. Der Text betont Heinrichs II. Rolle bei der Entwicklung eines modernen Staatswesens und hebt seine Fähigkeiten als Reisender König und seine Bemühungen um Recht und Gerechtigkeit hervor. Darüber hinaus wird die Beeinflussung der Geschichtsschreibung durch die Plantagenets beleuchtet, die das Bild eines idealisierten, gebildeten Ritters schufen.
Schlüsselwörter
Königsideal, England, Mittelalter, Heinrich II., Plantagenets, Kirche, Herrschaft, Diplomatie, Staatsbildung, Personenverbandsstaat, Geschichtsschreibung, gebildeter Ritter.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Entwicklung des Königsideals in England am Beispiel Heinrichs II.
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung des Königsideals in England zwischen 757 und 1216 und analysiert, inwieweit Heinrich II. (1154-1189) dieses Ideal verkörperte. Sie vergleicht Heinrich II. mit seinen Vorgängern und beleuchtet die Rolle der Kirche im Verhältnis zum Königtum sowie die Bedeutung von Herrschaft und Diplomatie.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: die Entwicklung des Königsideals in England (757-1216); Heinrich II. als Repräsentant des Königsideals; den Vergleich Heinrichs II. mit seinen Vorgängern; die Rolle der Kirche im Verhältnis zum Königtum; und die Bedeutung von Herrschaft und Diplomatie.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Hauptkapitel über Heinrich II., ein Kapitel über seine Vorgänger und eine Schlussbetrachtung. Das Hauptkapitel analysiert Heinrichs II. Herrschaft im Hinblick auf das Königsideal, beleuchtet seine territorialen Erweiterungen, die Stärkung seines Reiches durch Diplomatie und die Herausforderungen seiner Regentschaft. Es betont auch seine Rolle bei der Entwicklung eines modernen Staatswesens und die Beeinflussung der Geschichtsschreibung durch die Plantagenets.
Welche Rolle spielt die Kirche in der Arbeit?
Die Rolle der Kirche im Verhältnis zum Königtum ist ein wichtiger Aspekt der Arbeit. Die Einleitung hebt die Besonderheit dieses Verhältnisses in England im Vergleich zum Kontinent hervor. Das Verhältnis zwischen König und Kirche wird im Kontext der Herrschaft Heinrichs II. und im Vergleich zu seinen Vorgängern analysiert.
Wie wird Heinrich II. dargestellt?
Heinrich II. wird als geschickter Regent dargestellt, der durch geschickte Heiratspolitik und militärische Erfolge sein Reich erweiterte und durch Diplomatie stärkte. Seine Fähigkeiten als Reisender König und seine Bemühungen um Recht und Gerechtigkeit werden hervorgehoben. Die Arbeit beleuchtet aber auch die Herausforderungen, die mit der Führung eines komplexen Reiches verbunden waren.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Königsideal, England, Mittelalter, Heinrich II., Plantagenets, Kirche, Herrschaft, Diplomatie, Staatsbildung, Personenverbandsstaat, Geschichtsschreibung, gebildeter Ritter.
Werden die Vorgänger Heinrichs II. ebenfalls betrachtet?
Ja, die Arbeit betrachtet auch die Vorgänger Heinrichs II., um die Herausbildung des Königsideals zu veranschaulichen und einen Vergleich mit Heinrich II. zu ermöglichen.
Welche Quellen wurden verwendet? (Diese Frage kann erst beantwortet werden, wenn die zugrundeliegenden Quellen bekannt sind).
Die verwendeten Quellen sind in der vollständigen Arbeit detailliert aufgeführt (diese Information fehlt im vorliegenden Auszug).
- Quote paper
- Janina Funk (Author), 2006, Die Entwicklung des Königsideals in England (757-1216) , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/123049