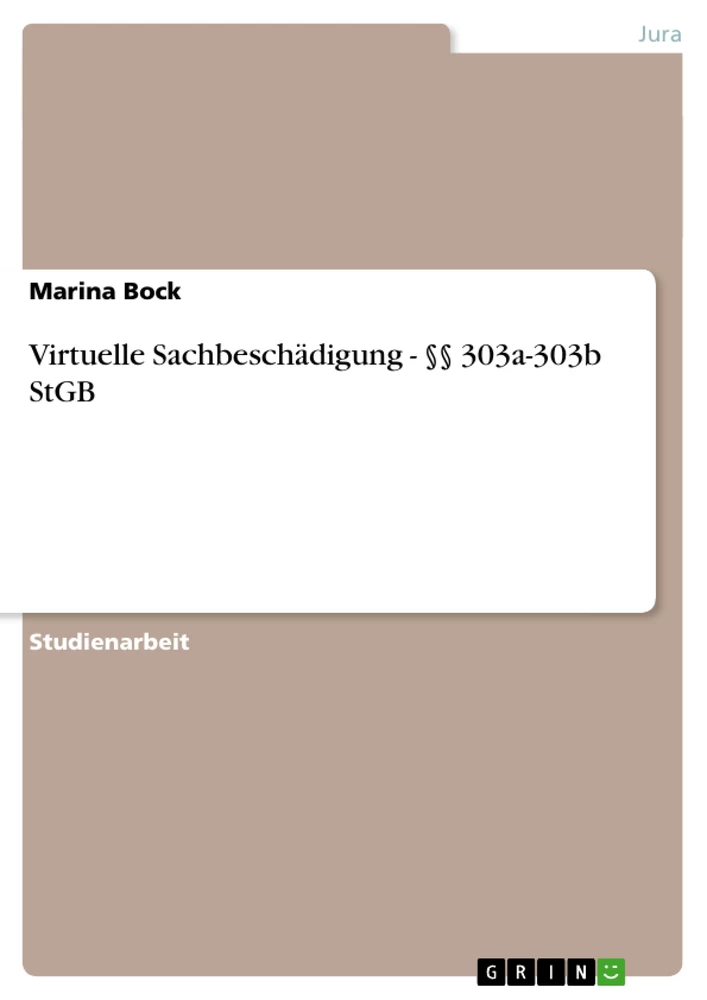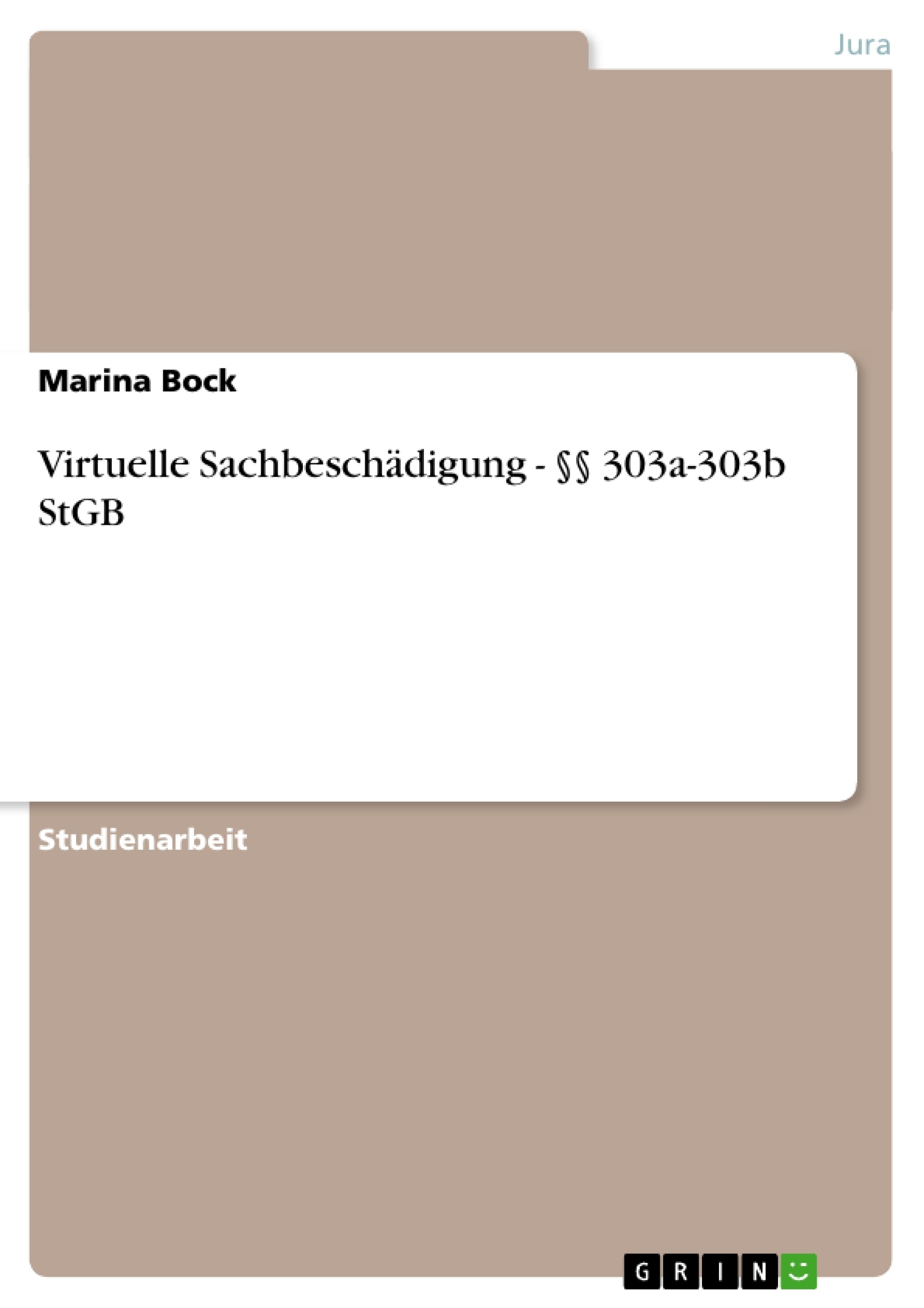Die Zunahme des Einsatzes von Datenverarbeitungsanlagen, die Abhängigkeit der militärischen Einsatzbereitschaft von der Sicherheit hochentwickelter Computersysteme oder auch die Verbreitung von Computer im privaten Bereich haben schon 1986 den Gesetzgeber beschäftigt. So dass durch das 2. Gesetz zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität (2. WiKG) u. a. die §§ 303a und 303b StGB (virtuelle Sachbeschädigung) eingeführt wurden. Im Laufe der Zeit boten und bieten sich durch die Informationstechnologien jedoch immer mehr neue Betätigungsfelder, aber auch mehr Missbrauchsmöglichkeiten. Diese, mittels Computer und Internet begangene Kriminalität, lässt sich schon lange nicht mehr durch nationale Grenzen aufhalten. Daher ist es notwendig geworden, „nur“ 21 Jahre nach dem 2. WiKG, den Schutz vor Angriffen auf Informationssysteme europaeinheitlich zu regeln. Daher war der Gesetzgeber durch das Übereinkommen des Europarates über Computerkriminalität vom 23.11.2001 und dem Rahmenbeschluss 2005/222/JI des Rates vom 24.02.2005 über Angriffe auf Informationssysteme gehalten, die Tatbestände der Computerkriminalität zu ändern und anzupassen. Mit dem 41. Strafrechtsänderungsgesetz vom 07.08.2007, welches am 11.08.2007 in Kraft trat, wurden diese Änderungen umgesetzt. Im Folgenden wird auf die Tatbestände der virtuellen Sachbeschädigung (§§ 303a f.) eingegangen, die Erneuerungen vorgestellt und bewertet.
Inhaltsverzeichnis
- A. Computerkriminalität – Ein sich rasch ausbreitendes Feld
- B. Tatbestände der virtuellen Sachbeschädigung
- I. § 303a, Datenveränderung
- 1. § 303a Abs. 1
- 2. Der Versuch nach § 303a Abs. 2
- 3. Konkurrenzen
- 4. Strafantrag
- 5. Verjährung
- 6. § 303a Abs. 3
- II. § 303b, Computersabotage
- 1. Schutzgut des § 303b
- 2. § 303b Abs. 1
- 3. Versuch gemäß § 303b Abs. 3
- 4. Konkurrenzen
- 5. Regelbeispiele des § 303b Abs. 4
- 6. Vorbereiten einer Tat nach Abs. 5
- 7. Strafantrag
- 8. Verjährung
- III. Strafantrag, § 303c
- I. § 303a, Datenveränderung
- C. Fazit / Stellungnahme
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht den Bereich der virtuellen Sachbeschädigung im Kontext der Computerkriminalität. Ziel ist es, die relevanten Straftatbestände des deutschen Strafgesetzbuches (§ 303a, § 303b, § 303c) zu analysieren und deren Anwendbarkeit auf verschiedene Formen der virtuellen Sachbeschädigung zu beleuchten.
- Definition und Abgrenzung virtueller Sachbeschädigung
- Analyse der Straftatbestände des § 303a (Datenveränderung) und § 303b (Computersabotage)
- Untersuchung der Strafanträge und Verjährungsfristen
- Bedeutung des Schutzgutes bei der virtuellen Sachbeschädigung
- Konkurrenzen zwischen den verschiedenen Straftatbeständen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel A bietet eine Einleitung in das schnell wachsende Feld der Computerkriminalität. Kapitel B analysiert im Detail die Straftatbestände der virtuellen Sachbeschädigung, beginnend mit § 303a, der Datenveränderung. Hier werden Tatobjekt, Tathandlungen, subjektiver Tatbestand, Rechtswidrigkeit, Versuch, Konkurrenzen, Strafantrag und Verjährung untersucht. Anschließend wird § 303b, die Computersabotage, in Bezug auf Schutzgut, Tatobjekt, Tathandlungen, Qualifikation, Versuch, Konkurrenzen, Regelbeispiele, Vorbereitung, Strafantrag und Verjährung analysiert. Schließlich wird § 303c, der Strafantrag, behandelt.
Schlüsselwörter
Virtuelle Sachbeschädigung, Computerkriminalität, § 303a StGB, § 303b StGB, § 303c StGB, Datenveränderung, Computersabotage, Strafantrag, Verjährung, Datenverarbeitung, Schutzgut.
- Quote paper
- Marina Bock (Author), 2009, Virtuelle Sachbeschädigung - §§ 303a-303b StGB, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/123032