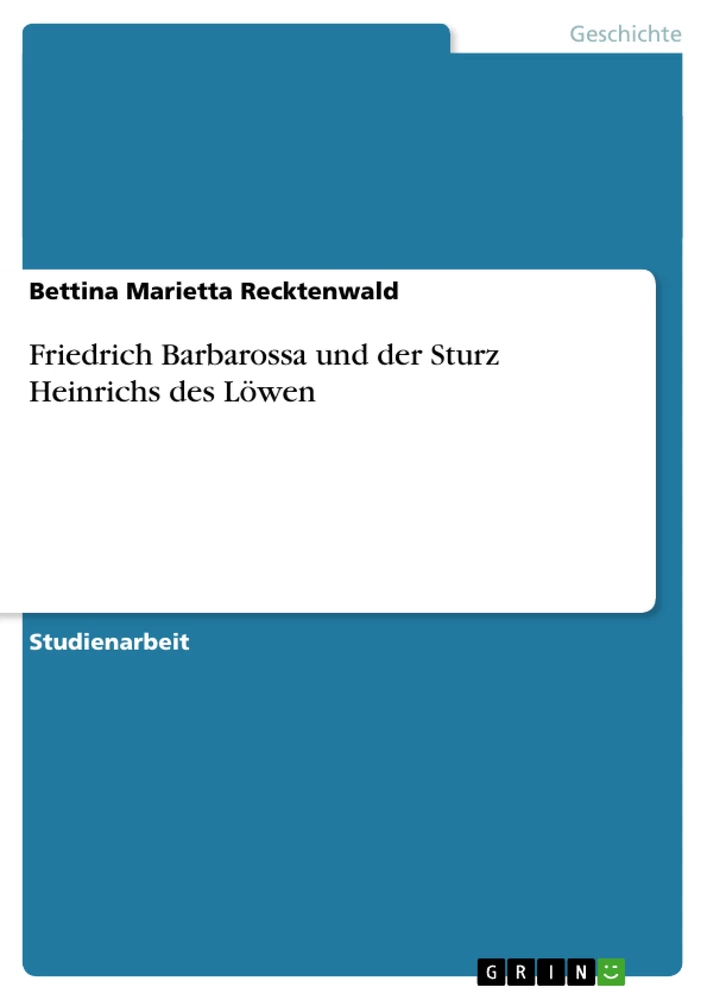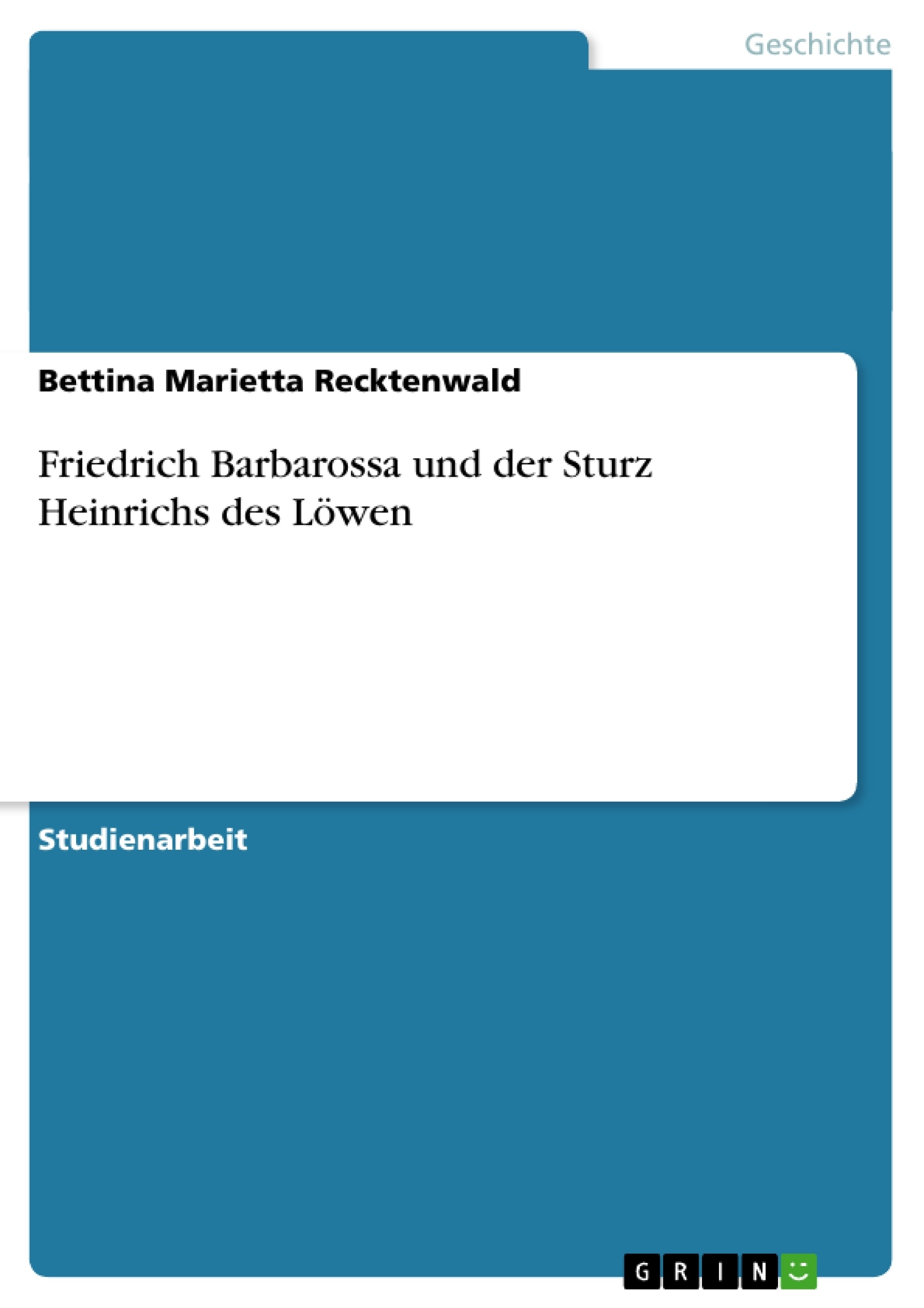In dieser Arbeit wird auf den genauen Ablauf und die Ursachen der Beschwerden und Klagen gegen den Welfen, die letztlich im Prozeß gegen Heinrich den Löwen endete, eingegangen. Sie beginnt mit dem Ursprung der Konflikte und Heinrichs widerrechtlicher Aneignung der Stader Erbschaft. Es werden die Anfänge der fürstlichen Unruhen im Reich aufgezeigt, die 1166 zu den lang andauernden Sachsenkämpfen führten. Das Verhältnis Barbarossas zu seinem Vetter und die Verschlechterung der wechselseitigen Beziehungen nach dem Treffen in Chiavenna werden im zweiten Teil der Arbeit beleuchtet. Auch die Probleme des Welfen mit den geistlichen Fürsten werden nicht außer Acht gelassen. So soll besonders die Rolle des Kölner Erzbischofs Philipp von Köln auf dem Reichstag zu Worms genauer untersucht werden. Mit den Bestimmungen der Gelnhauser Urkunde und deren Folgen endet diese Arbeit.
Ich stütze mich bei der Bearbeitung dieser Seminararbeit hauptsächlich auf die Biographie von Karl Jordan, da er dieses Thema in meinen Augen sehr vorbildlich und ausführlich behandelt hat. Zusätzlich sollen auch die verschiedenen Quellen der Stauferzeit und ihrer zeitgenössischen Schreiber, wie zum Beispiel Otto von Freising, Arnold von Lübeck und Helmold von Bosau zur Bearbeitung herangezogen werden. Im Anhang wird eine Kopie der Prozeßurkunde von Gelnhausen angefügt sein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Erste Konflikte im Reich
- Der Streit um das Stader Erbe
- Die Anfänge der fürstlichen Unruhen
- Der Streit mit den geistlichen Fürsten seines Reiches
- Die Absetzung Udalrichs von Halberstadt
- Die Sachsenkämpfe 1166
- Heinrichs Entfremdung von Barbarossas Politik
- Friedrich Barbarossas Einschreiten gegen die Fürstenoppositionen
- Der Kaiser richtet sich gegen den Löwen
- Auseinandersetzungen mit den geistlichen Fürsten
- Die Beschwerden Erzbischof Philipps von Köln auf dem Reichstag zu Worms
- Der Prozeß und die Gelnhauser Urkunde
- Die Folgen der Entmachtung
- Schlußbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Konflikte zwischen Heinrich dem Löwen und Friedrich Barbarossa, die letztlich zum Sturz Heinrichs führten. Sie beleuchtet die Ursachen und den Ablauf der Auseinandersetzungen, von den ersten kleineren Konflikten bis zum Prozess und der Gelnhauser Urkunde.
- Heinrichs skrupellose Territorialpolitik und die daraus resultierenden Konflikte.
- Die Rolle der geistlichen Fürsten im Konflikt.
- Die Eskalation der Konflikte und die Verschlechterung des Verhältnisses zwischen Heinrich und Barbarossa.
- Der Prozess gegen Heinrich den Löwen und die Gelnhauser Urkunde.
- Der Einfluss des Konflikts auf die Reichsverfassung.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt Heinrich den Löwen als facettenreiche Persönlichkeit vor und beschreibt den langjährigen Konflikt mit Friedrich Barbarossa. Das erste Kapitel behandelt den Streit um das Stader Erbe als ersten Konflikt zwischen Heinrich und anderen Fürsten. Weitere Kapitel beleuchten die Auseinandersetzungen mit geistlichen Fürsten, die Sachsenkämpfe und die zunehmende Entfremdung von Barbarossa. Das Verhältnis zwischen Heinrich und Barbarossa nach dem Treffen in Chiavenna wird analysiert. Die Rolle des Kölner Erzbischofs Philipp wird im Kontext des Reichstages zu Worms untersucht.
Schlüsselwörter
Heinrich der Löwe, Friedrich Barbarossa, Staufer, Welfen, Sachsenkriege, Reichsverfassung, Territorialpolitik, geistliche Fürsten, Gelnhauser Urkunde, Konflikt, Herrschaftsanspruch.
- Quote paper
- Bettina Marietta Recktenwald (Author), 1997, Friedrich Barbarossa und der Sturz Heinrichs des Löwen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/122827