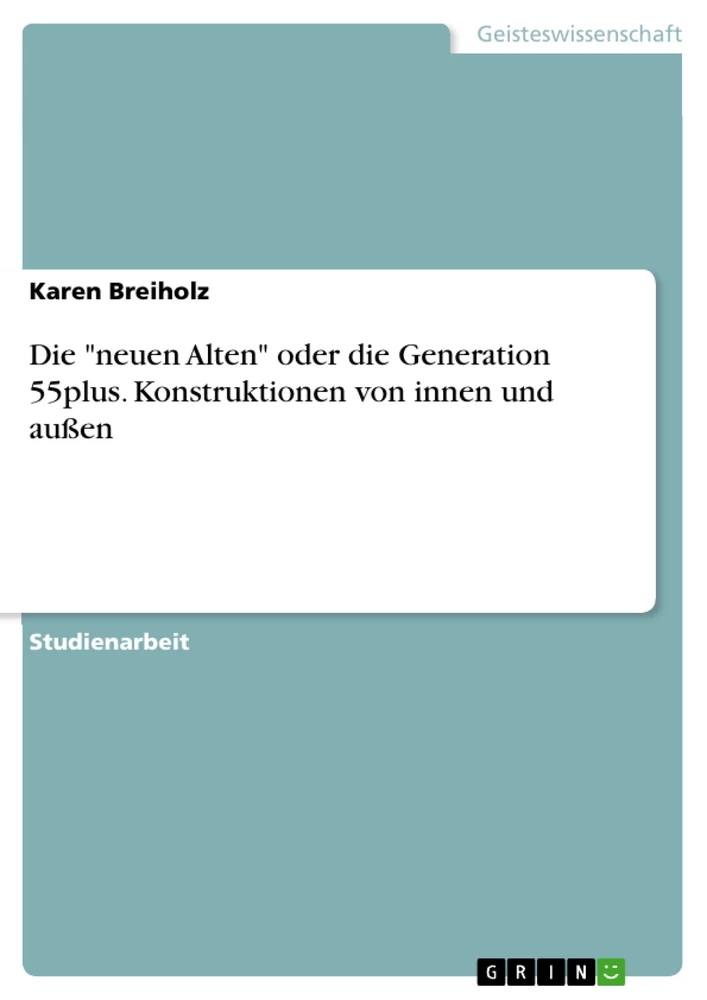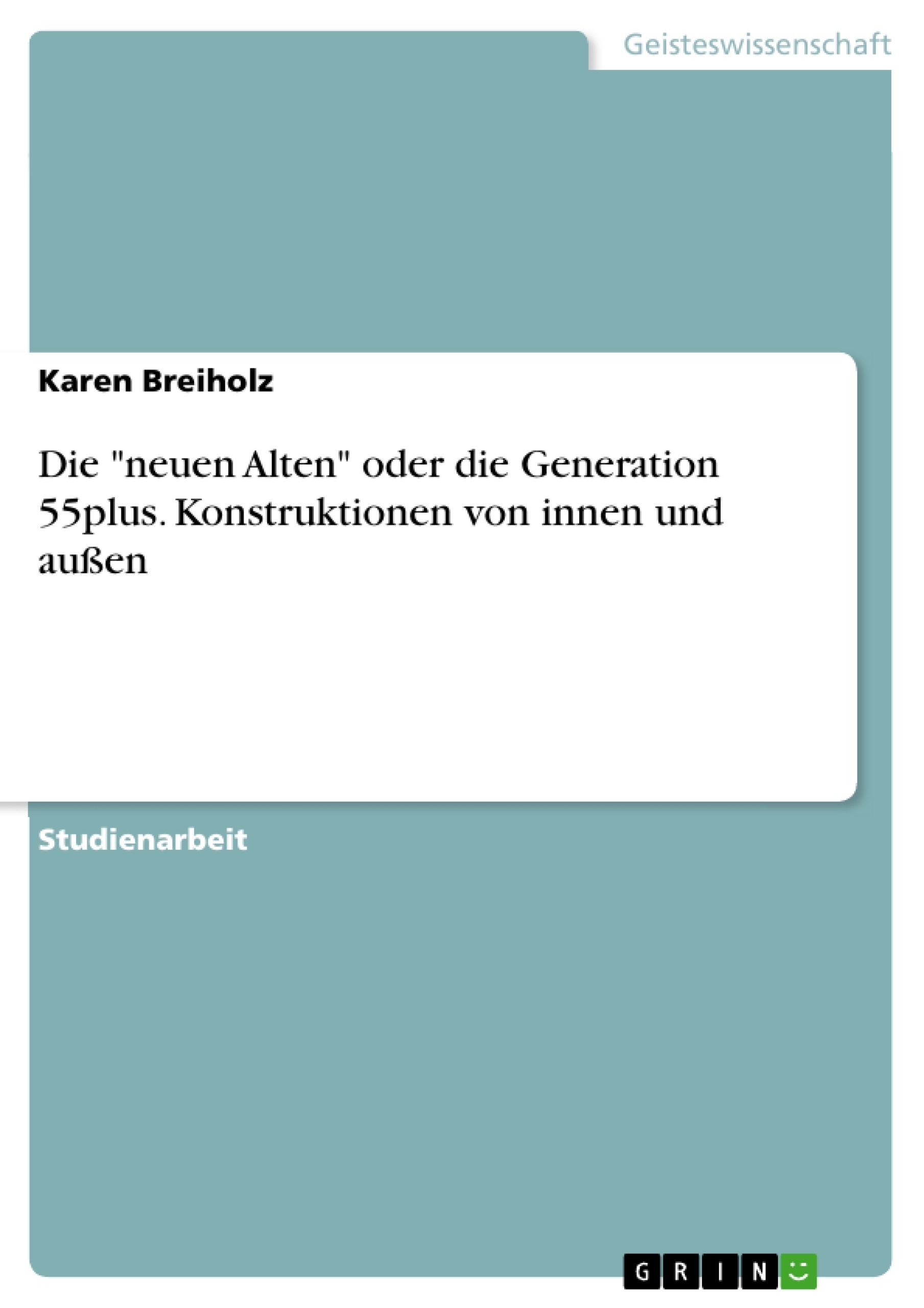Seit einiger Zeit ist in unserer Gesellschaft von einer neuen Altersklasse die Rede: der „Generation 55plus“.
Die Erscheinungsform dieses Schlagworts ist nicht allein durch
Personen entsprechenden Alters sichtbar, sondern auch in der Produktwerbung, den Debatten über das Verbleiben älterer Arbeitnehmer am Rande der Verrentung, den Diskussionen über
die Rente selbst, der aktiven Beteiligung älterer Menschen in der Politik, im Altersstudium an Hochschulen und ist aus vielen Lebensbereichen nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken.
Auf den ersten Blick scheint es bei der Betrachtung dieser Tatsachen keine Probleme zu geben. Denkt man an diese Generation treten wohl bei jedem von uns bestimmte Bilder auf: Kinder des Wirtschaftswunders, 68er Generation, Studentenbewegung und Emanzipation der Frau. Doch was ist mit den Menschen, die sich in der beschriebenen Lebensphase befinden?
Nehmen diese die Zuschreibungen ebenso selbstverständlich an oder gibt es vielleicht Diskrepanzen in der Wahrnehmung Außenstehender und der Perspektive der Betroffenen?
Dies wirft außerdem die Frage auf, ob es überhaupt ein „außen“, also ein außerhalb dieser Lebensphase gibt oder ob jene älteren Menschen zu solch einer Generation stigmatisiert werden, der sie sich vielleicht gar nicht zugehörig fühlen. In diesem Zusammenhang gilt es auch, den Generationsbegriff sowie Altersbegriff zu definieren, da beide Begriffe starke Interdependenzen aufweisen. Ziel meiner Arbeit ist es, die engen Verflechtungen beider Begriffe in unserer Gesellschaft aufzuzeigen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Begrifflichkeiten
- 2.1 Das Alter
- 2.2 Das Altern
- 2.3 Die Generation
- 2.4 Ein Kulturbegriff
- 3 Die Bedeutung des Altwerdens in unserer Kultur Fremd- und Eigenwahrnehmung als Gegenüberstellung
- 4 Der Eintritt in das Rentenleben - ein bedeutsames Erlebnis
- 5 Hat das Altern Kultur? – Das Potential des Älterwerdens
- 6 Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die „Generation 55plus“ und beleuchtet die Konstruktionen von Alter und Altern sowohl aus der Perspektive der Gesellschaft als auch der Betroffenen. Es wird der Frage nachgegangen, inwiefern die Zuschreibungen an diese Generation mit den Selbstwahrnehmungen übereinstimmen und wie der Generations- und Altersbegriff in diesem Kontext zu definieren sind. Ziel ist es, die enge Verflechtung beider Begriffe und die kulturellen Einflüsse auf das Altern aufzuzeigen.
- Konstruktion von Alter und Altern in der Gesellschaft
- Übereinstimmung von gesellschaftlichen Zuschreibungen und Selbstwahrnehmung der „Generation 55plus“
- Definition und Interdependenz von Generations- und Altersbegriff
- Kulturelle Einflüsse auf das Altern und deren Bedeutung
- Das Potential des Älterwerdens
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der „Generation 55plus“ ein und stellt die Forschungsfrage nach der Übereinstimmung von gesellschaftlicher Zuschreibung und individueller Wahrnehmung. Sie verweist auf die widersprüchlichen Bilder, die mit dieser Generation verbunden sind, und hebt die Notwendigkeit einer Definition der Begriffe „Alter“ und „Generation“ hervor. Die Autorin kündigt ihre Absicht an, die engen Verflechtungen beider Begriffe aufzuzeigen und den kulturellen Aspekt des Alterns zu beleuchten, wobei sie die bisherige kulturwissenschaftliche Forschungslücke zu diesem Thema hervorhebt. Der Mangel an kulturwissenschaftlicher Auseinandersetzung mit dem Alter wird als ein Vorurteil identifiziert, dem die Arbeit entgegenwirken möchte.
2 Begrifflichkeiten: Dieses Kapitel analysiert die zentralen Begriffe „Alter“ und „Altern“. „Alter“ wird als der momentane Zustand fortgeschrittener Lebenszeit definiert, der sich in körperlichen und geistigen Veränderungen sowie in kulturellen Konstruktionen manifestiert. Das „Altern“ wird hingegen als Prozessualität des Älterwerdens beschrieben. Hier werden die verschiedenen Perspektiven der Gerontologie (biologische und geisteswissenschaftliche) einander gegenübergestellt. Die biologische Perspektive reduziert Altern auf physiologische Prozesse, während die geisteswissenschaftliche Perspektive die Bedeutung kultureller Einflüsse und die Möglichkeit positiver Aspekte des Alterns betont. Der Abschnitt hebt die Bedeutung von kulturell erlernbarer Fähigkeiten zur Erweiterung des Handlungsspielraums hervor und zeigt damit auf, wie Altern auch als Chance begriffen werden kann.
Schlüsselwörter
Generation 55plus, Alter, Altern, Gerontologie, Generationsbegriff, Altersbegriff, kulturelle Konstruktion, Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, gesellschaftliche Zuschreibungen, Kultur, Interdisziplinarität.
Häufig gestellte Fragen zu: [Titel des Textes einfügen]
Was ist der Gegenstand der Untersuchung?
Die Arbeit untersucht die „Generation 55plus“ und beleuchtet die gesellschaftlichen Konstruktionen von Alter und Altern sowie deren Übereinstimmung mit der Selbstwahrnehmung dieser Generation. Ein zentrales Thema ist die Definition und die Interdependenz von Generations- und Altersbegriff im Kontext kultureller Einflüsse.
Welche Begriffe werden im Text zentral behandelt?
Die zentralen Begriffe sind „Alter“ (als momentaner Zustand), „Altern“ (als Prozess), „Generation“, „Generation 55plus“, sowie die Aspekte der Selbst- und Fremdwahrnehmung und die kulturelle Konstruktion von Alter und Altern. Die Gerontologie als wissenschaftliche Perspektive auf das Altern wird ebenfalls thematisiert.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die enge Verflechtung von Generations- und Altersbegriff aufzuzeigen und die kulturellen Einflüsse auf das Altern zu analysieren. Sie untersucht, inwieweit gesellschaftliche Zuschreibungen an die „Generation 55plus“ mit deren Selbstwahrnehmung übereinstimmen. Ein weiteres Ziel ist es, das Potential des Älterwerdens zu beleuchten.
Welche Kapitel umfasst der Text und worum geht es darin?
Der Text beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel zu den Begrifflichkeiten (Alter und Altern), ein Kapitel zur Bedeutung des Altwerdens in unserer Kultur, ein Kapitel zum Eintritt ins Rentenleben, ein Kapitel zum kulturellen Potential des Älterwerdens und eine Zusammenfassung mit Ausblick. Die Einleitung führt das Thema ein und benennt die Forschungsfrage. Das Kapitel zu den Begrifflichkeiten analysiert „Alter“ und „Altern“ aus verschiedenen Perspektiven (biologisch und geisteswissenschaftlich). Die weiteren Kapitel behandeln die gesellschaftliche und individuelle Wahrnehmung des Älterwerdens und dessen kulturelle Bedeutung.
Wie werden Alter und Altern im Text definiert?
„Alter“ wird als der momentane Zustand fortgeschrittener Lebenszeit definiert, geprägt von körperlichen und geistigen Veränderungen und kulturellen Konstruktionen. „Altern“ wird als der Prozess des Älterwerdens beschrieben, der sowohl biologische als auch geisteswissenschaftliche (kulturelle) Aspekte umfasst.
Welche Rolle spielt die Kultur im Kontext des Alterns?
Der Text betont die starke kulturelle Komponente des Alterns. Er untersucht, wie kulturelle Einflüsse die Wahrnehmung und das Erleben des Alterns prägen und wie kulturell erlernte Fähigkeiten den Handlungsspielraum im Alter erweitern können. Die Arbeit hebt die bisherige Forschungslücke in der kulturwissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Alter hervor.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Generation 55plus, Alter, Altern, Gerontologie, Generationsbegriff, Altersbegriff, kulturelle Konstruktion, Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, gesellschaftliche Zuschreibungen, Kultur, Interdisziplinarität.
- Quote paper
- Karen Breiholz (Author), 2008, Die "neuen Alten" oder die Generation 55plus. Konstruktionen von innen und außen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/122697