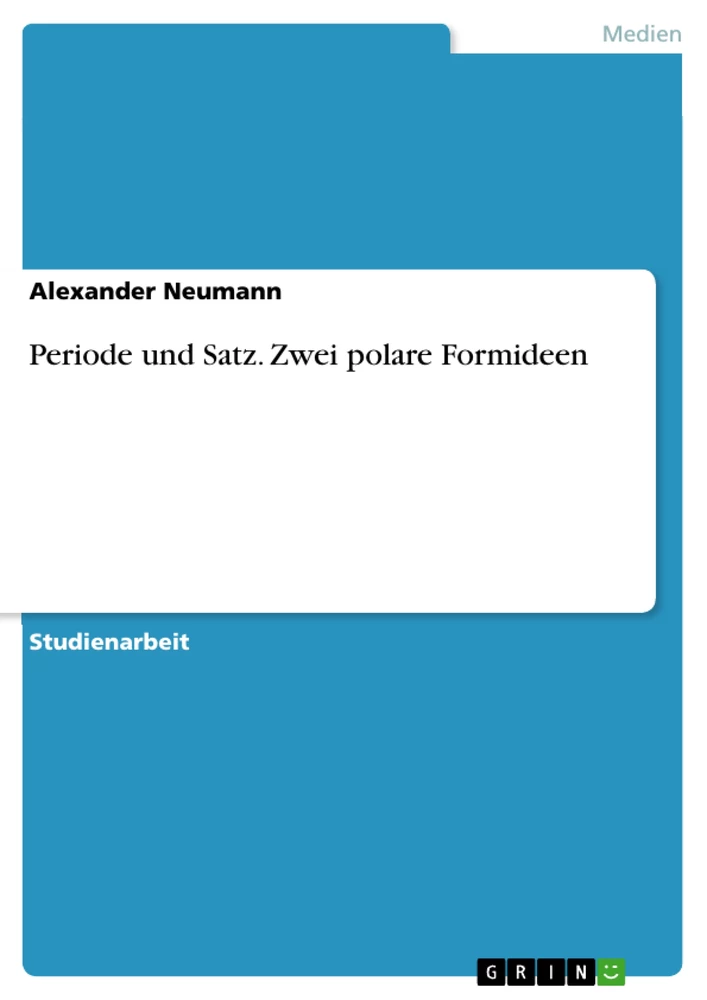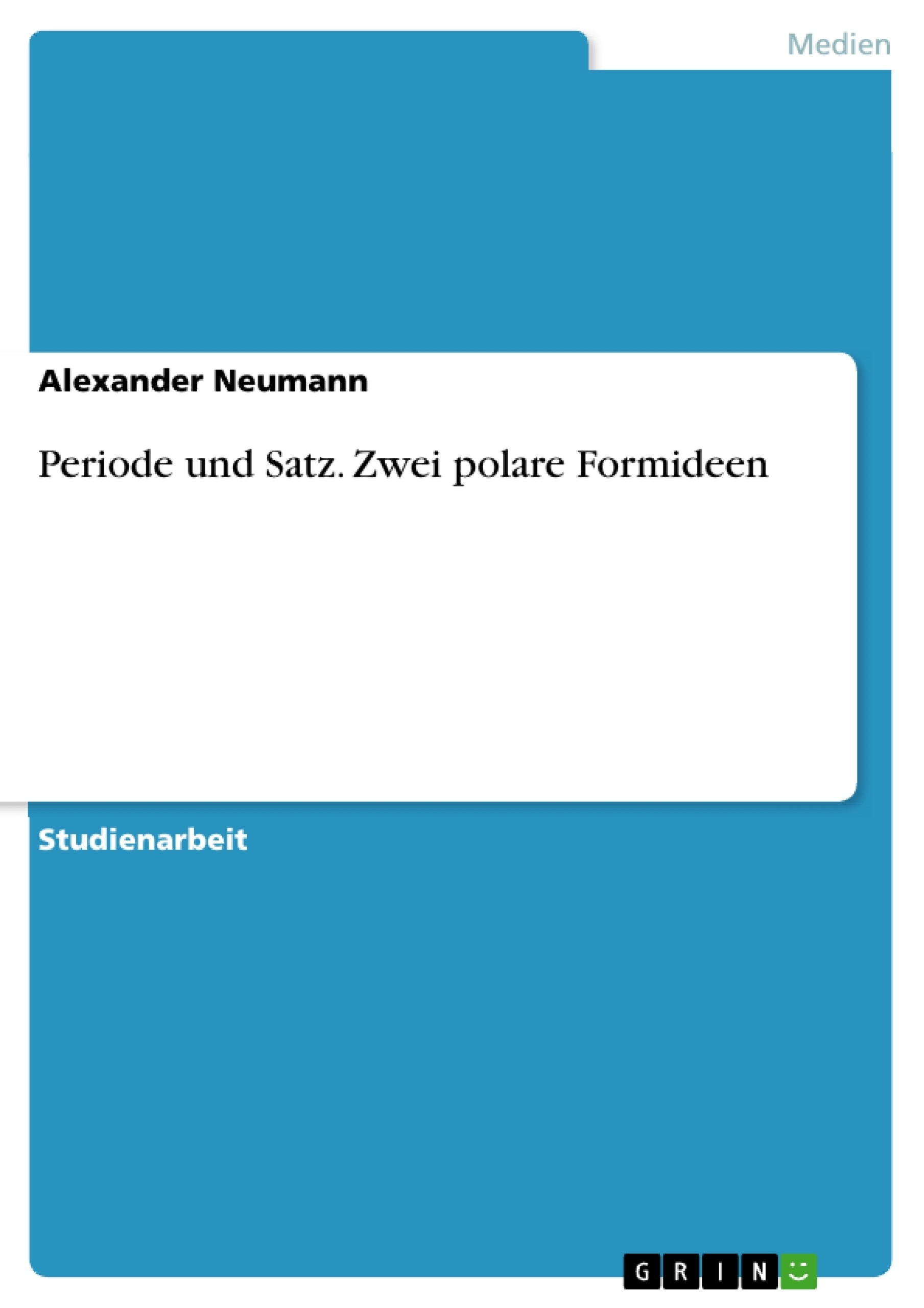Zwei musikalische Formideen, die seit der musikalischen Klassik bis heute in Kompositionen verlässlich auftreten, stehen im Zentrum dieser Arbeit: Periode und Satz werden einander gegenübergestellt und nach musikalischen Parametern (Harmonik, Metrik, Motivik) eingeordnet.
Die Begriffe Satz und Periode und die mit ihnen verbundenen Formideen sollen beleuchtet und in ihrer Gegensätzlichkeit gegenübergestellt werden. Nach einem Blick in die Geschichte beider Begriffe, der Bedeutungswandel offenbaren und damit auch ihre heutige Ambiguität nachvollziehbar machen soll, betrachte ich die heute gebräuchlichen Definitionen und versuche beide Formideen möglichst genau zu charakterisieren.
Anschließend möchte ich die theoretischen Betrachtungen konkretisieren, indem ich jeweils den Beginn von Mozarts A-Dur-Sonate, KV 331 und Beethovens f-Moll-Sonate, Op. 2 Nr. 1 sowie das erste Thema des Finalsatzes aus Mozarts g-Moll-Sinfonie, KV 550 betrachte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Periode und Satz - zwei Begriffe im historischen Wandel
- 2. Definition und Beschreibung zweier Modelle
- 3. Analyse
- 3.1 Wolfgang Amadeus Mozart: Variationsthema der A-Dur-Sonate, KV 331, 1. Satz
- 3.2 Ludwig van Beethoven: Beginn der f-Moll-Sonate, Op. 2 Nr. 1, 1. Satz
- 3.3 Wolfgang Amadeus Mozart: Finale der g-Moll-Sinfonie, KV 550, 4. Satz
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Begriffen Satz und Periode und den damit verbundenen Formideen in der Musik. Die Analyse der historischen Entwicklung der Begriffe und ihrer Bedeutungsänderungen soll ihre heutige Ambiguität aufzeigen. Des Weiteren werden gängige Definitionen der beiden Modelle vorgestellt und charakterisiert. Abschließend werden die theoretischen Betrachtungen anhand konkreter musikalischer Beispiele aus den Werken von Mozart und Beethoven veranschaulicht.
- Historisches Verständnis der Begriffe Satz und Periode
- Gegenüberstellung der Formideen Satz und Periode
- Analyse der beiden Modelle anhand von Definitionen und theoretischen Begriffen
- Anwendung der theoretischen Erkenntnisse in der Musikgeschichte
- Zusammenhang von Form und Inhalt in der Musik
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit setzt sich zum Ziel, die Formideen Satz und Periode und ihre Gegensätzlichkeit zu beleuchten. Nach einem geschichtlichen Abriss der Begriffe werden die heute gebräuchlichen Definitionen vorgestellt und an musikalischen Beispielen erläutert.
- 1. Periode und Satz - zwei Begriffe im historischen Wandel: Der Begriff Satz stammt aus der Sprachwissenschaft und bezeichnet ein sinnvolles Wortgefüge. Der Begriff Periode, ebenfalls aus der Rhetorik stammend, bezeichnet einen abgerundeten Redesatz. Beide Begriffe wurden auf die Musik übertragen und beschreiben musikalische Einheiten, die jedoch im Laufe der Geschichte unterschiedliche Bedeutungen und Funktionen entwickelten.
- 2. Definition und Beschreibung zweier Modelle: In diesem Kapitel werden die gebräuchlichen Definitionen von Satz und Periode vorgestellt. Satz wird als ein musikalischer Gedanke verstanden, der sich aus Motiven zusammensetzt und eine Einheit bildet. Periode hingegen bezeichnet eine größere Einheit, die aus mehreren Sätzen besteht und durch Kadenzschluss gekennzeichnet ist. Es wird auch auf die Symmetrie und den Aufbau von Periode als ein Gegenstück zum Satz eingegangen.
- 3. Analyse: Dieses Kapitel analysiert verschiedene musikalische Beispiele, um die theoretischen Überlegungen zu verdeutlichen. Untersucht werden der Beginn der A-Dur-Sonate KV 331 von Mozart, die f-Moll-Sonate Op. 2 Nr. 1 von Beethoven sowie das Finale der g-Moll-Sinfonie KV 550 von Mozart.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Begriffen Satz und Periode in der Musik und beleuchtet ihre Entwicklung und Definition im historischen Kontext. Dabei werden wichtige Aspekte wie Formgestaltung, Symmetrie, Kadenzschluss und die Gegenüberstellung der beiden Modelle im Vergleich mit der Rhetorik untersucht. Als zusätzliche Schlüsselbegriffe dienen Themen wie Motiv, Thema, Satzgefüge, harmonische Periode, Symmetrie, musikalische Einheit, Kadenz und die Anwendung der theoretischen Erkenntnisse an konkreten Beispielen aus der Musikgeschichte, insbesondere von Mozart und Beethoven.
- Citation du texte
- Alexander Neumann (Auteur), 2013, Periode und Satz. Zwei polare Formideen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1226086