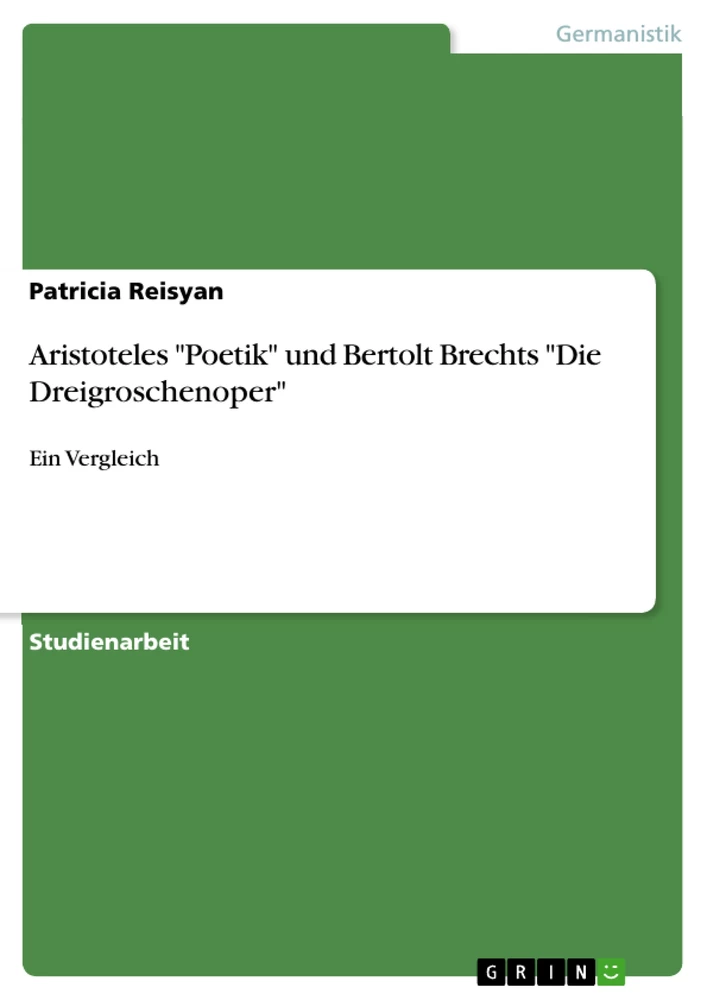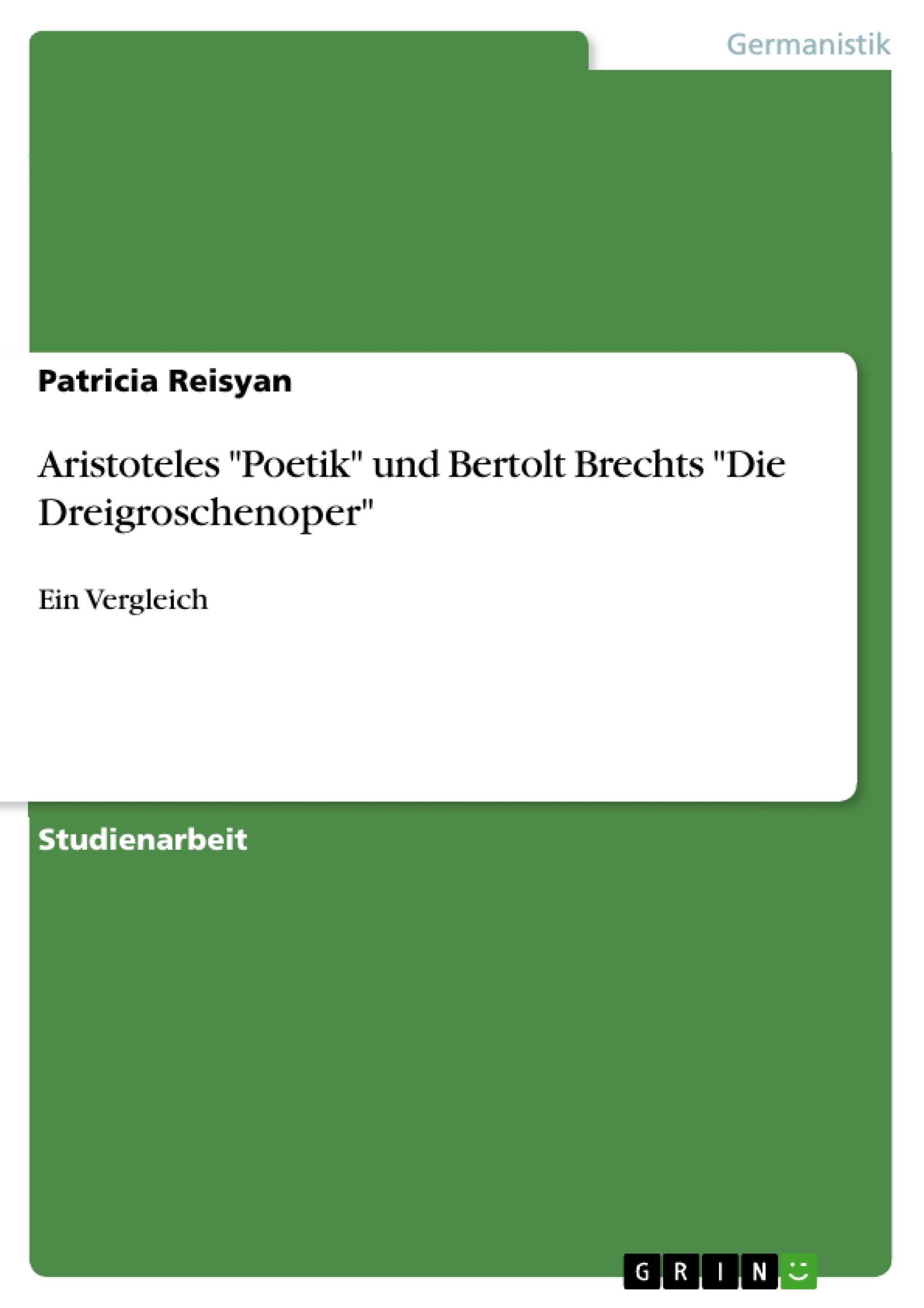Die Begriffsopposition episch vs. dramatisch geht auf die Poetik des Aristoteles zurück. In Abgrenzung von der Tragödie entwickelt Aristoteles im Wesentlichen zwei Unterscheidungsmerkmale für das Epos: Die Tragödie ahmt die handelnden Personen durch unmittelbare Schaustellung nach, das Epos durch Erzählung. Und: Die Fabel des Epos zeichnet sich durch längere und zahlreichere Episoden aus.
Das Streben nach der Darstellung der komplexen Zusammenhänge von Geschichte und Gesellschaft erklärt die Figurenfülle und die Ausdehnung der Handlung in der Dreigroschenoper.
Inhaltsverzeichnis
- Aristoteles
- Die Poetik - Was meinte Aristoteles mit Nachahmung?
- Bertolt Brecht
- Die Dreigroschenoper
- Die Entstehung und Publikation der Dreigroschenoper
- Das epische Theater
- Die Verfremdung
- Die Musik und das epische Theater
- Vergleich zwischen Aristoteles Poetik und Brecht
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Dramentheorien von Aristoteles und Bertolt Brecht anhand von Aristoteles' „Poetik“ und Brechts „Dreigroschenoper“. Ziel ist es, Gemeinsamkeiten und Unterschiede in ihren Ansätzen zur Dramengestaltung aufzuzeigen und zu analysieren.
- Aristoteles' Konzept der Mimesis (Nachahmung) und seine Bedeutung für die Tragödie
- Die Elemente der tragischen Handlung nach Aristoteles (Handlung, Charaktere, Sprache, Gedanke, Musik, Schauspiel)
- Brechts episches Theater und die Technik der Verfremdung
- Der Vergleich der dramaturgischen Prinzipien von Aristoteles und Brecht
- Die Rolle der Musik im epischen Theater
Zusammenfassung der Kapitel
Das Kapitel über Aristoteles' Poetik konzentriert sich auf sein Verständnis von Nachahmung (Mimesis) als Grundlage der Dichtung. Es wird detailliert auf die Unterscheidung zwischen Tragödie und Komödie eingegangen und die Bedeutung der geschlossenen Handlung, der Einheit von Ort und Zeit und der Katharsis erläutert. Der Fokus liegt auf Aristoteles' Definition von Tragödie und den damit verbundenen dramaturgischen Elementen.
Die Kapitel über Bertolt Brecht behandeln „Die Dreigroschenoper“, deren Entstehung und die zentralen Merkmale seines epischen Theaters. Die Verfremdungstechnik und die Rolle der Musik im epischen Theater werden ebenfalls erläutert. Der Schwerpunkt liegt auf der Darstellung der zentralen Elemente des epischen Theaters im Gegensatz zu den Prinzipien der aristotelischen Dramentheorie.
Schlüsselwörter
Aristoteles, Poetik, Mimesis, Nachahmung, Tragödie, Komödie, Katharsis, Bertolt Brecht, Dreigroschenoper, episches Theater, Verfremdungseffekt, Musik, Dramentheorie, Dramenanalyse, Handlung, Charaktere.
- Quote paper
- Patricia Reisyan (Author), 2004, Aristoteles "Poetik" und Bertolt Brechts "Die Dreigroschenoper", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/122530