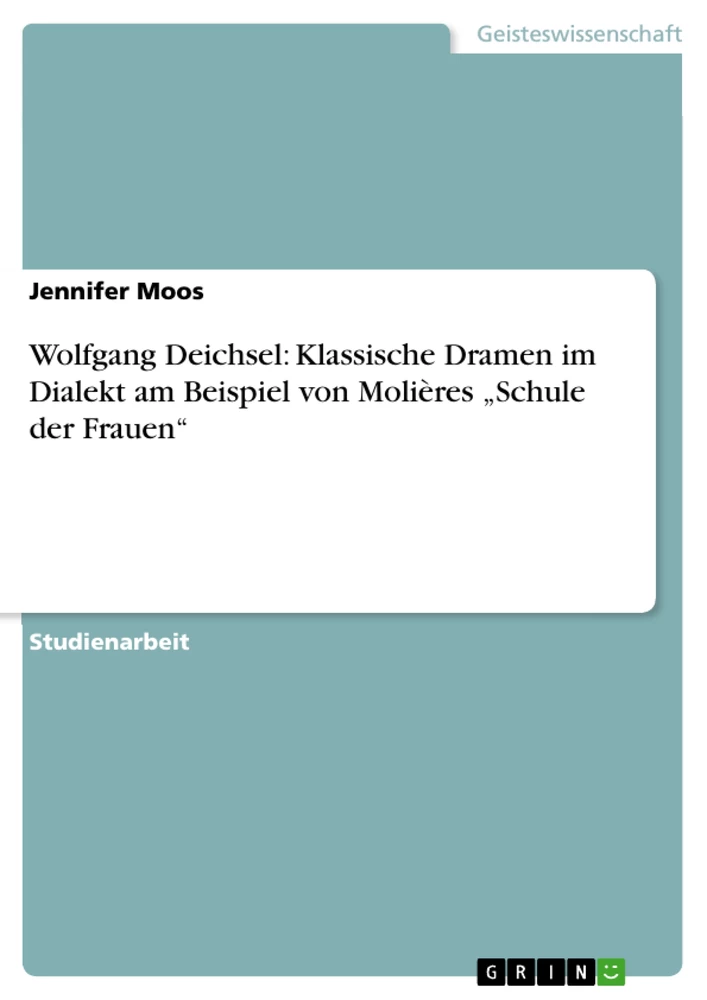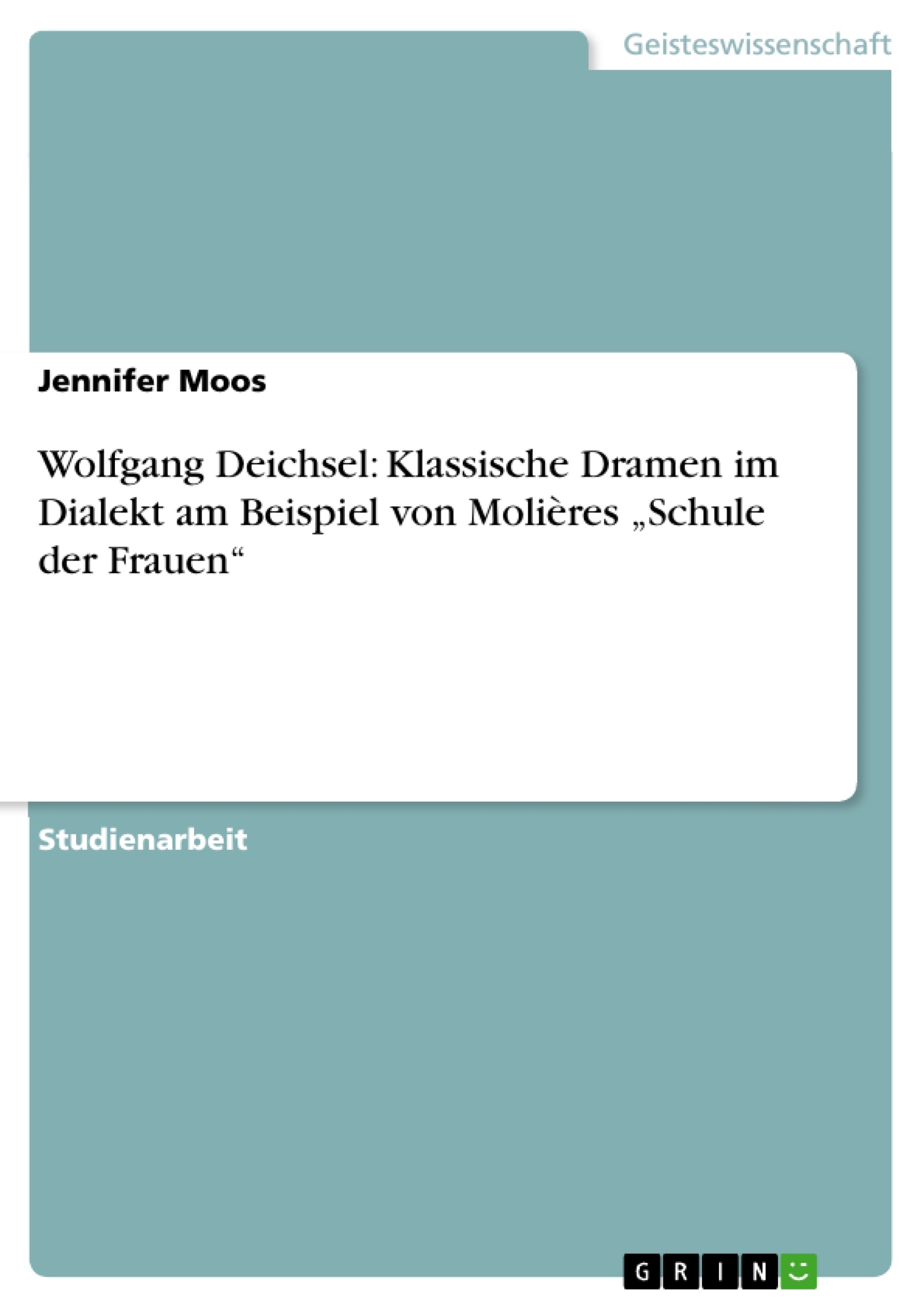Theaterstücke, die in Mundart verfasst sind, werden der Kategorie Volksstück zugeordnet. Damit ist zugleich deutlich, dass es ebenso Volksstücke gibt, die in Hochsprache verfasst sind. Im Folgenden soll jedoch nur das Mundarttheater im Zentrum der Untersuchung stehen. Zunächst möchte ich die Entwicklung des modernen Volksstückes aufzeigen, um seine Stellung innerhalb der Theaterlandschaft heute und seine Tendenzen, wie die Klassikerbearbeitungen, zu erklären. „Volkstheater ist Theater über das Volk und für das Volk mit dem Ziel, die mittleren und unteren Schichten der Bevölkerung in einer ihnen verständlichen Form zu unterhalten und aufzuklären.“ Dies besagt eine alte Definition, die auch abstrahiert für das moderne Volksstück noch Gültigkeit besitzt. Das moderne Volksstück ist aus dem Alt-Wiener Volksstück im 19. Jh. hervorgegangen. Vertreter dieser Zeit sind Ludwig Anzensgruber (1839 – 18 89) und Ludwig Thoma (1867 – 1921). Die Stücke spielten in einem dörflichen oder familiären Kreis und wurden in einem naturalistisch gefärbten Dialekt verfasst. Das Tragische und das Volkstümliche rückte vor allem bei Thoma sehr nahe. Er zeigte die Erstarrung des Volkes in leeren Moralkodexen und verwendete die Mundart kritisch, stellte sie sogar in Frage.
Carl Zuckmayer (1896 – 1977) verfasste dem entgegen Komödien mit Happy-End, die die Besonderheiten des einfachen Volkes positiv bestärken sollten. Die Erneuerung des Volksstückes durch Marie- Luise Fleißer (1901 – 1974), Ödön von Horvath (1901 – 1938) und Berthold Brecht (1898 – 1956) setzt neue Schwerpunkte, die um soziale Ausgrenzung, Kommunikationslosigkeit und auch Sprachlosigkeit kreisen. Auch die äußere Form der Stücke verändert sich. Es findet die bekannte Abkehr vom klassischen Drama zum Epischen Theater statt. Das Volksstück soll nicht mehr belehrend wirken oder rein unterhalten, sondern es wendet sich an einen aktiven, kritischen Zuschauer. Die handelnden Personen kommen nicht mehr nur aus dem bäuerlichen oder ländlichen, sondern vielmehr aus dem Kleinbürgertum der Städte. Der Jargon verdrängt den Dialekt. [...]
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Über das Schreiben von Theatertexten im Dialekt
- III. Zu Moliere und seiner „Schule der Frauen“
- IV. Zu Wolfgang Deichsel und seiner Schule der Frauen
- V. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Adaption klassischer Dramen in den Dialekt, am Beispiel von Wolfgang Deichsels Bearbeitung von Molières „Schule der Frauen“. Sie beleuchtet die Entwicklung des modernen Volksstücks, die Rolle des Dialekts im modernen Theater und die spezifischen Herausforderungen der Übersetzung und Adaption von Theatertexten in Mundart.
- Entwicklung des modernen Volksstücks
- Die Rolle des Dialekts im Theater
- Übersetzung und Adaption von Theatertexten in Mundart
- Analyse von Wolfgang Deichsels Bearbeitung von Molières „Schule der Frauen“
- Vergleich zwischen Hochsprache und Mundart im Theater
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und definiert das moderne Volksstück. Sie beleuchtet die historische Entwicklung des Genres, von seinen Ursprüngen im Alt-Wiener Volksstück des 19. Jahrhunderts bis hin zu den Erneuerungen durch Autoren wie Brecht, Horvath und Fleißer. Die Entwicklung wird anhand von Beispielen wie Ludwig Thoma, Carl Zuckmayer und der Grazer Gruppe um Hans Carl Artmann veranschaulicht, wobei die unterschiedlichen Schwerpunkte und Tendenzen herausgestellt werden – von der naturalistischen Darstellung bis hin zu experimentellen und sozialkritischen Ansätzen. Die Einleitung skizziert die besondere Rolle des Dialekts im modernen Volkstheater und seinen Wandel von der Alltagssprache zu einem stilistischen Mittel.
II. Über das Schreiben von Theatertexten im Dialekt: Dieses Kapitel behandelt die besonderen Herausforderungen und Möglichkeiten des Schreibens von Theatertexten im Dialekt. Es wird der Aspekt der Verfremdung durch die Verwendung von Mundart diskutiert, die dem Publikum vertraute Zusammenhänge in einem neuen Licht erscheinen lässt. Der Fokus liegt auf dem Unterschied zwischen der ursprünglichen Funktion des Dialekts im Volksstück (Näherbringen der Thematik an das Publikum) und seiner modernen Funktion (Herauskristallisierung des Besonderen). Die Arbeit von Wolfgang Deichsel wird als Beispiel herangezogen, sowie die Ausführungen von Ulf Thomas Lesle zum Übersetzen von Theatertexten in Dialekt, wobei die Bedeutung von Rhythmus, Duktus und sprachlichem Ausdruck hervorgehoben werden. Die Schwierigkeiten bei der sprachlichen Abgrenzung von Figuren werden ebenfalls erörtert.
III. Zu Moliere und seiner „Schule der Frauen“: Dieses Kapitel analysiert Molières „Schule der Frauen“ als Grundlage für Deichsels Bearbeitung. Es wird voraussichtlich auf die Thematik, die Charaktere und die sprachliche Gestaltung des Originals eingegangen. Die Analyse wird den Kontext des Stückes und seine Relevanz für die spätere Adaption erläutern. Die wesentlichen Elemente des Originalstücks werden herausgearbeitet, um später den Vergleich mit Deichsels Version zu ermöglichen.
IV. Zu Wolfgang Deichsel und seiner Schule der Frauen: Dieses Kapitel wird sich detailliert mit Deichsels Adaption von Molières „Schule der Frauen“ befassen. Es wird voraussichtlich die spezifischen Änderungen, die Deichsel am Original vorgenommen hat, analysieren und ihren Einfluss auf die Thematik, die Charaktere und die Wirkung des Stückes beleuchten. Die Wahl des hessischen Stadtjargons und seine Funktion werden detailliert untersucht. Der Vergleich mit dem Original wird zentrale Bedeutung haben. Die Analyse wird die sprachliche Gestaltung, den Stil und die Wirkung von Deichsels Version beleuchten und in den Kontext der modernen Volksstücktradition einordnen.
Schlüsselwörter
Volksstück, Mundarttheater, Dialekt, Hochsprache, Wolfgang Deichsel, Molière, Schule der Frauen, Theaterübersetzung, Adaption, Sprachliche Verfremdung, Moderne Dramaturgie, Sozialkritik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Adaption von Molières „Schule der Frauen“ durch Wolfgang Deichsel
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Adaption von Molières „Schule der Frauen“ durch Wolfgang Deichsel in den hessischen Dialekt. Im Fokus stehen die Herausforderungen und Möglichkeiten der Übersetzung und Adaption von Theatertexten in Mundart, die Rolle des Dialekts im modernen Theater und die Entwicklung des modernen Volksstücks.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet verschiedene Aspekte: die Entwicklung des modernen Volksstücks, die Rolle des Dialekts im Theater (Verfremdungseffekt, stilistische Mittel), die Übersetzung und Adaption von Theatertexten in Mundart, eine detaillierte Analyse von Deichsels Bearbeitung von Molières Stück, und einen Vergleich zwischen Hochsprache und Mundart im Theater. Der Unterschied zwischen der traditionellen und modernen Funktion des Dialekts im Volksstück wird ebenfalls untersucht.
Welche Autoren und Werke werden betrachtet?
Die Arbeit befasst sich hauptsächlich mit Molières „Schule der Frauen“ und Deichsels Adaption. Zusätzlich werden Autoren wie Ludwig Thoma, Carl Zuckmayer, Hans Carl Artmann, Bertolt Brecht, Ödön von Horváth und Franziska Elisabeth Fleißer im Kontext der Entwicklung des modernen Volksstücks erwähnt. Die theoretischen Überlegungen von Ulf Thomas Lesle zum Übersetzen von Theatertexten in Dialekt werden ebenfalls einbezogen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Eine Einleitung, die das moderne Volksstück und die Rolle des Dialekts einführt; ein Kapitel über das Schreiben von Theatertexten im Dialekt mit Fokus auf Herausforderungen und Möglichkeiten; eine Analyse von Molières „Schule der Frauen“; eine detaillierte Analyse von Deichsels Adaption; und schließlich ein Resümee.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung definiert das moderne Volksstück, beleuchtet seine historische Entwicklung vom Alt-Wiener Volksstück bis zu modernen Autoren, und skizziert die Rolle des Dialekts im modernen Volkstheater und seinen Wandel von der Alltagssprache zu einem stilistischen Mittel.
Was ist der Schwerpunkt des Kapitels über das Schreiben von Theatertexten im Dialekt?
Dieses Kapitel behandelt die Herausforderungen und Möglichkeiten, Theatertexte im Dialekt zu schreiben. Es diskutiert den Verfremdungseffekt durch Mundart und den Unterschied zwischen der traditionellen und modernen Funktion des Dialekts im Volksstück. Die Arbeit von Wolfgang Deichsel und die theoretischen Ausführungen von Ulf Thomas Lesle werden als Beispiele herangezogen.
Was wird in der Analyse von Molières „Schule der Frauen“ untersucht?
Dieses Kapitel analysiert Molières Originalwerk, seine Thematik, Charaktere und sprachliche Gestaltung, um später einen Vergleich mit Deichsels Adaption zu ermöglichen und den Kontext für die spätere Adaption zu erläutern.
Worauf konzentriert sich die Analyse von Deichsels Adaption?
Dieses Kapitel analysiert detailliert Deichsels Änderungen am Original, ihren Einfluss auf Thematik, Charaktere und Wirkung des Stücks, und untersucht die Wahl des hessischen Stadtjargons und seine Funktion. Der Vergleich mit dem Original spielt hier eine zentrale Rolle.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Volksstück, Mundarttheater, Dialekt, Hochsprache, Wolfgang Deichsel, Molière, Schule der Frauen, Theaterübersetzung, Adaption, Sprachliche Verfremdung, Moderne Dramaturgie, Sozialkritik.
- Citar trabajo
- Magister Artium Jennifer Moos (Autor), 2004, Wolfgang Deichsel: Klassische Dramen im Dialekt am Beispiel von Molières „Schule der Frauen“, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/122464