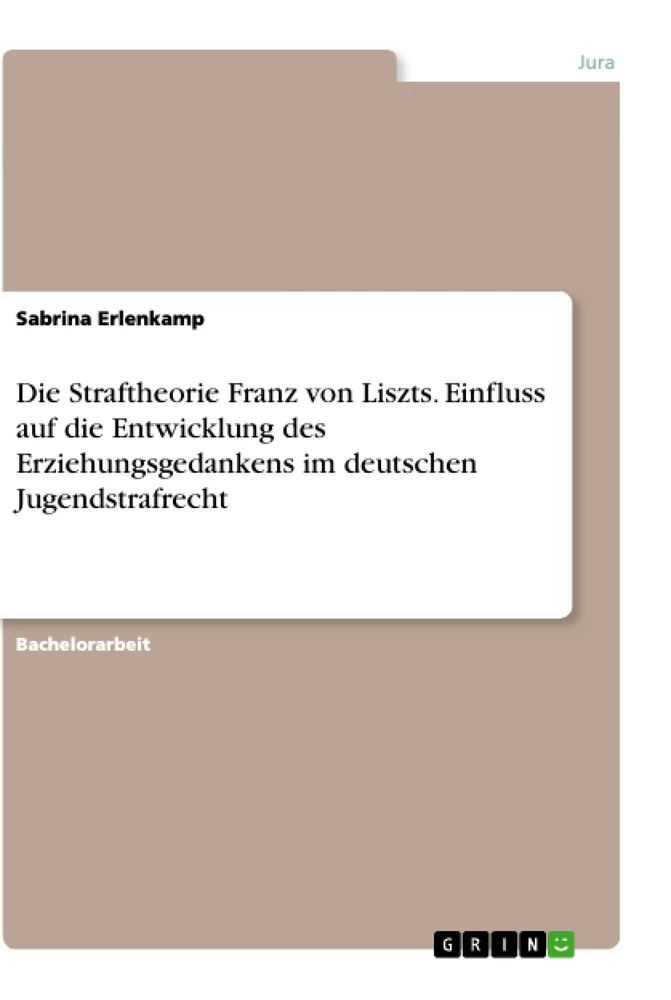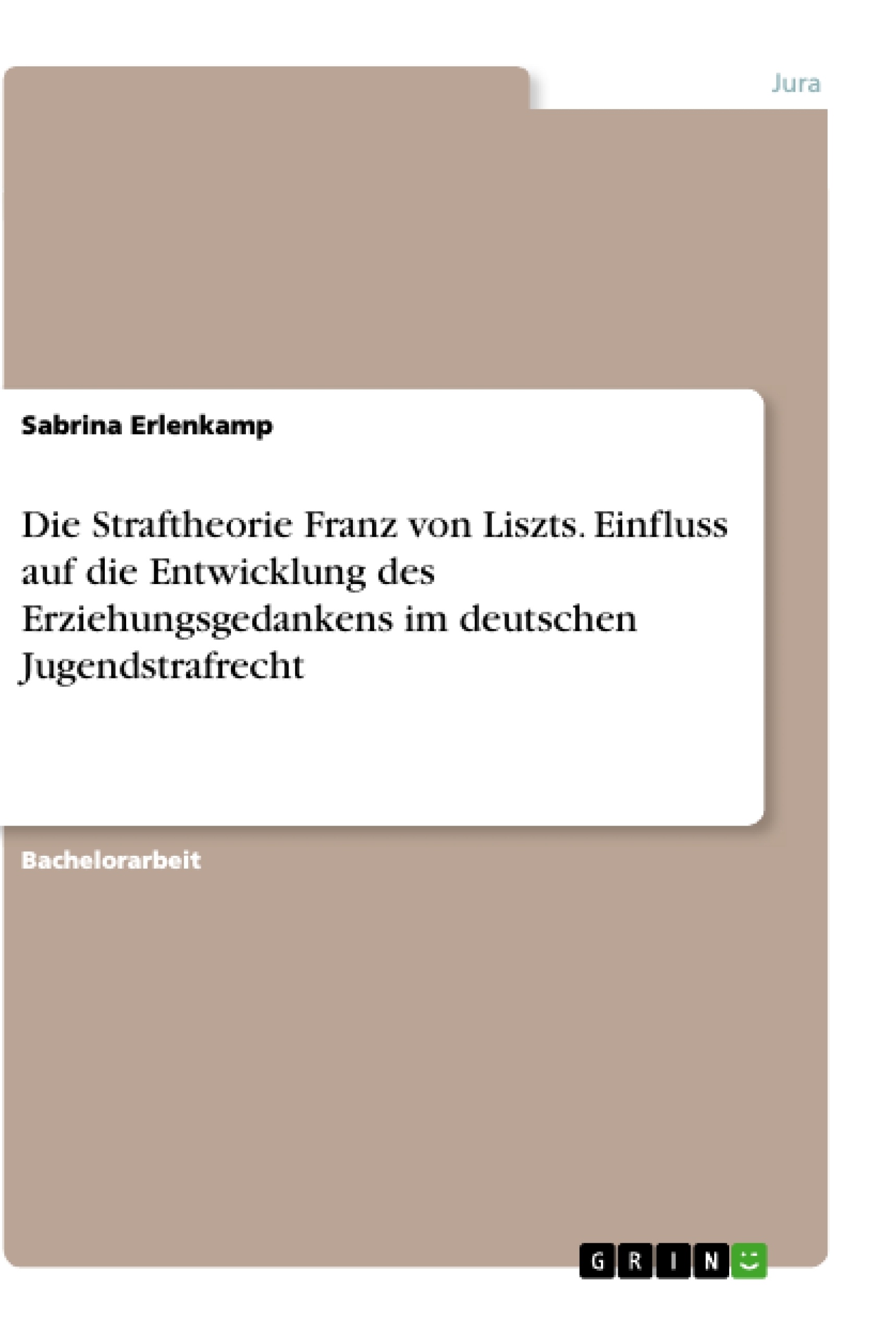In dieser Arbeit soll untersucht werden, in welchem Zusammenhang Franz von Liszts Straftheorie sowie seine Reformvorschläge zur strafrechtlichen Behandlung der Jugendlichen zur Entwicklung des Erziehungsgedankens im deutschen Jugendstrafrecht stehen.
Den Hauptteil der Arbeit bildet die Herausarbeitung der Reformvorschläge von Liszts zur Umsetzung des Erziehungsgedankens im deutschen Strafrecht. Dabei wird zugleich untersucht, welche seiner Forderungen tatsächlich mit dem Erlass des Jugendgerichtsgesetzes ganz oder teilweise erfüllt werden und welche Forderungen sich nicht durchsetzen können. Den Abschluss bildet ein Kapitel, in dem auf den Erlass des Jugendgerichtsgesetzes und auf die weiteren Entwicklungen eingegangen wird.
Der Strafrechtsgelehrte Franz von Liszt gilt, obwohl das Jugendgerichtsgesetz erst im Jahre 1923 und damit vier Jahre nach seinem Tod in Kraft tritt, als Ideengeber und Wegbereiter eines am Erziehungsgedanken ausgerichteten Jugendstrafrechts. Zusammen mit den Unterstützern der modernen Schule setzt er sich als Vorreiter für ein am Erziehungsgedanken orientiertes besonderes Strafrecht für Jugendliche ein. Vor allem durch Heranziehung neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse kann er seinen Standpunkt überzeugend begründen.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Hauptteil
- I. Franz von Liszt und das Marburger Programm
- 1. Der Strafrechtsgelehrte Franz von Liszt
- 2. Das Marburger Programm
- II. Der Begriff des Erziehungsgedankens im Jugendstrafrecht
- 1. Erziehung statt Strafe
- 2. Erzieherische Ausgestaltung der Haft
- 3. Subsidiarität der Strafe
- 4. Täterorientiertes Strafrecht
- 5. Ausgestaltung des Strafverfahrens
- 6. Jugendstrafrecht vs. Erwachsenenstrafrecht
- 7. Erziehungsgedanke als Leitziel
- III. Der Schulenstreit
- IV. Wandel des gesellschaftlichen Bewusstseins
- V. Die Situation der Kinder und Jugendlichen an der Wende zum 20. Jahrhundert
- 1. Industrialisierung und Urbanisierung
- 2. Soziale und wirtschaftliche Aspekte von Jugenddelinquenz
- a) Die Ursachen für einen Anstieg der Jugendkriminalität nach Liszt
- b) Die Bedeutung der gesellschaftlichen Faktoren
- aa) Die Bedeutung der Kindheit
- bb) Die Bedeutung der erblichen Veranlagung
- cc) Maßnahmen zur Verbrechensprävention
- 3. Kriminalstatistik
- 4. Die rechtliche Situation: Regelungen für junge Straftäter
- a) Strafzweck
- b) Strafmündigkeit
- c) Sanktionen nach dem Reichsstrafgesetzbuch
- d) Konsequenzen der Regelungen des Reichsstrafgesetzbuchs
- e) Änderung durch die Novelle zum Reichsstrafgesetzbuch von 1876
- VI. Die Reformvorschläge Liszts zur Umsetzung des Erziehungsgedankens und ihre Berücksichtigung im Jugendgerichtsgesetz
- 1. Heraufsetzung der Strafmündigkeitsgrenze
- 2. Erweiterung der Strafmündigkeitsgrenze
- 3. Abstellen auf die sittliche Reife
- 4. Die Gestaltung des Strafvollzugs
- a) Freiheitsstrafe als weitgehend alternativlose Strafform
- b) Ablehnung der Prügelstrafe
- c) Separate Strafanstalten für Jugendliche und Erwachsene
- 5. Verzicht auf festbestimmte Strafen
- 6. Dauer der Freiheitsstrafe
- a) Abschaffung kurzer Freiheitsstrafen
- b) Höhere Freiheitsstrafen für Jugendliche
- 7. Aussetzung der Strafvollstreckung
- a) Bewährungsstrafe zur Vermeidung kurzer Freiheitsstrafen
- b) Bedenken bei Anwendung auf jugendliche Verurteilte
- c) Lösungsvorschläge zur Überwindung der Gefahren
- 8. Zwangserziehung
- a) Das Preußische Zwangserziehungsgesetz von 1878
- b) Verbesserungsvorschläge
- aa) Ausweitung über das 18. Lebensjahr hinaus
- bb) Erweiterung der richterlichen Handlungsfreiheit
- cc) Erweiterung des Anwendungsbereichs von Zwangserziehung
- dd) Der Ausbau der Institutionen
- 9. Die Institutionen des Strafprozesses
- a) Gerichtsverfahren
- b) besondere Jugendgerichte
- c) Deutsche Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfe
- d) Jugendgerichtshilfe
- VII. Der Erlass des Reichsjugendgerichtsgesetzes 1923
- 1. Gustav Radbruch
- 2. Die weiteren Entwicklungen
- C. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss von Franz von Liszts Straftheorie auf die Entwicklung des Erziehungsgedankens im deutschen Jugendstrafrecht. Sie analysiert Liszts Reformvorschläge und deren Umsetzung im Jugendgerichtsgesetz von 1923.
- Franz von Liszts Straftheorie und ihr Bezug zum Erziehungsgedanken
- Der Schulenstreit und die Auseinandersetzung um ein erzieherisches Jugendstrafrecht
- Die gesellschaftlichen Veränderungen an der Wende zum 20. Jahrhundert und deren Einfluss auf die Jugendkriminalität
- Liszts Reformvorschläge zur Umsetzung des Erziehungsgedankens im Jugendstrafrecht
- Die Entwicklung des Jugendstrafrechts bis zum Erlass des Reichsjugendgerichtsgesetzes 1923
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung: Diese Einleitung stellt Franz von Liszt als wichtigen Vordenker des erzieherischen Jugendstrafrechts vor, obwohl das Jugendgerichtsgesetz erst nach seinem Tod in Kraft trat. Sie hebt die Bedeutung des Jahres 1923 als Wendepunkt in der strafrechtlichen Behandlung Jugendlicher hervor, da zuvor kein separates Jugendstrafrecht existierte. Die Einleitung beschreibt den Wandel vom repressiven Strafrecht hin zu einem erzieherischen Ansatz und kündigt die Forschungsfrage der Arbeit an: den Zusammenhang zwischen Liszts Straftheorie und der Entwicklung des Erziehungsgedankens im deutschen Jugendstrafrecht.
B. Hauptteil: Der Hauptteil der Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel, die sich intensiv mit den einzelnen Aspekten der Fragestellung auseinandersetzen. Er beginnt mit der Vorstellung von Franz von Liszt und seinem Marburger Programm, beleuchtet den Begriff des Erziehungsgedankens im Jugendstrafrecht und schildert den "Schulenstreit" zwischen Liszt und seinen Gegnern. Weitere Kapitel untersuchen den gesellschaftlichen Wandel, die Situation Jugendlicher vor dem Jugendgerichtsgesetz und detailliert Liszts Reformvorschläge. Abschließend wird der Erlass des Reichsjugendgerichtsgesetzes von 1923 und dessen Bedeutung erörtert.
I. Franz von Liszt und das Marburger Programm: Dieses Kapitel präsentiert Franz von Liszt als bedeutenden Strafrechtsgelehrten und erläutert sein Marburger Programm, in dem er seinen "Zweckgedanken" im Strafrecht darlegt. Es analysiert Liszts Einfluss auf die Entwicklung eines modernen, an der Täterpersönlichkeit orientierten Strafrechts, das den Weg für einen erzieherischen Ansatz im Jugendstrafrecht ebnete. Die Untersuchung von Liszts Werk bietet hier die Grundlage für die weitere Analyse seiner Einflüsse auf das deutsche Jugendstrafrecht.
II. Der Begriff des Erziehungsgedankens im Jugendstrafrecht: Dieses Kapitel definiert den "Erziehungsgedanken" im Kontext des Jugendstrafrechts und setzt ihn in Beziehung zu Liszts spezialpräventiver Straftheorie. Es analysiert verschiedene Aspekte wie Erziehung statt Strafe, erzieherische Ausgestaltung der Haft, die Subsidiarität der Strafe und ein täterorientiertes Strafrecht. Der Vergleich mit dem Erwachsenenstrafrecht verdeutlicht die Besonderheiten des Jugendstrafrechts und die Bedeutung des Erziehungsgedankens als Leitziel.
III. Der Schulenstreit: Dieses Kapitel beschreibt die kontroverse Debatte um ein erzieherisches Jugendstrafrecht zwischen Anhängern der "modernen Schule", zu denen Liszt zählte, und der klassischen Strafrechtsschule. Es beleuchtet die gegensätzlichen Positionen und Argumente, um den Kontext der Entstehung des erzieherischen Jugendstrafrechts zu verdeutlichen und Liszts Rolle in diesem Diskurs zu bestimmen.
IV. Wandel des gesellschaftlichen Bewusstseins: Hier wird der gesellschaftliche Wandel an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert analysiert, mit Fokus auf die Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche. Es wird erörtert, wie sich die Industrialisierung und Urbanisierung auf die Jugendkriminalität auswirkten und welche sozialen und wirtschaftlichen Faktoren eine Rolle spielten. Diese Betrachtung bildet den Kontext für das Verständnis der damaligen Herausforderungen im Jugendstrafrecht.
V. Die Situation der Kinder und Jugendlichen an der Wende zum 20. Jahrhundert: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Lage von Kindern und Jugendlichen vor der Einführung eines gesonderten Jugendstrafrechts. Es analysiert die Ursachen von Jugendkriminalität aus Liszts Perspektive, berücksichtigt statistische Daten und untersucht die rechtlichen Regelungen, insbesondere im Reichsstrafgesetzbuch. Der Fokus liegt auf den Defiziten des bestehenden Systems und der Notwendigkeit einer Reform.
VI. Die Reformvorschläge Liszts zur Umsetzung des Erziehungsgedankens und ihre Berücksichtigung im Jugendgerichtsgesetz: Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit und analysiert Liszts konkrete Reformvorschläge zur Umsetzung des Erziehungsgedankens im Jugendstrafrecht. Es untersucht, welche seiner Ideen im Jugendgerichtsgesetz Berücksichtigung fanden und welche nicht. Die Analyse umfasst Aspekte wie Strafmündigkeit, Strafvollzug, Bewährung und Zwangserziehung, wobei jeweils die Argumentation Liszts und die tatsächliche Umsetzung im Gesetz verglichen werden.
VII. Der Erlass des Reichsjugendgerichtsgesetzes 1923: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Erlass des Reichsjugendgerichtsgesetzes von 1923, wobei die Rolle von Gustav Radbruch hervorgehoben wird. Es beleuchtet die Bedeutung dieses Gesetzes als Meilenstein in der Entwicklung des deutschen Jugendstrafrechts und skizziert die weiteren Entwicklungen, ohne jedoch in detaillierte Ausführungen zu den späteren Reformen einzugehen.
Schlüsselwörter
Franz von Liszt, Straftheorie, Erziehungsgedanke, Jugendstrafrecht, Jugendgerichtsgesetz, Reichsstrafgesetzbuch, Schulenstreit, moderne Schule, spezialpräventive Straftheorie, Jugendkriminalität, gesellschaftlicher Wandel, Industrialisierung, Urbanisierung, Reformvorschläge, Gustav Radbruch.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Einfluss von Franz von Liszts Straftheorie auf die Entwicklung des Erziehungsgedankens im deutschen Jugendstrafrecht
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Einfluss von Franz von Liszts Straftheorie auf die Entwicklung des Erziehungsgedankens im deutschen Jugendstrafrecht. Sie analysiert Liszts Reformvorschläge und deren Umsetzung im Jugendgerichtsgesetz von 1923.
Wer war Franz von Liszt und welche Rolle spielte er?
Franz von Liszt war ein bedeutender Strafrechtsgelehrter. Sein Marburger Programm legte den Grundstein für ein modernes, an der Täterpersönlichkeit orientiertes Strafrecht, das den Weg für einen erzieherischen Ansatz im Jugendstrafrecht ebnete. Die Arbeit analysiert seinen Einfluss auf die Entwicklung des deutschen Jugendstrafrechts.
Was ist der "Erziehungsgedanke" im Jugendstrafrecht?
Der "Erziehungsgedanke" im Jugendstrafrecht betont die Erziehung und Resozialisierung des jugendlichen Täters anstatt allein auf Bestrafung zu setzen. Die Arbeit analysiert verschiedene Aspekte wie Erziehung statt Strafe, erzieherische Ausgestaltung der Haft und die Subsidiarität der Strafe.
Was war der "Schulenstreit"?
Der "Schulenstreit" beschreibt die kontroverse Debatte um ein erzieherisches Jugendstrafrecht zwischen Anhängern der "modernen Schule" (darunter Liszt) und der klassischen Strafrechtsschule. Die Arbeit beleuchtet die gegensätzlichen Positionen und Argumente.
Welche gesellschaftlichen Veränderungen beeinflussten die Jugendkriminalität?
Die Arbeit analysiert den gesellschaftlichen Wandel an der Wende zum 20. Jahrhundert, insbesondere Industrialisierung und Urbanisierung, und deren Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche sowie auf die Jugendkriminalität.
Welche konkreten Reformvorschläge machte Liszt?
Liszts Reformvorschläge umfassten Aspekte wie die Heraufsetzung der Strafmündigkeitsgrenze, die Gestaltung des Strafvollzugs (Ablehnung der Prügelstrafe, separate Anstalten), den Verzicht auf festbestimmte Strafen, die Aussetzung der Strafvollstreckung (Bewährung) und die Zwangserziehung. Die Arbeit vergleicht seine Vorschläge mit der tatsächlichen Umsetzung im Jugendgerichtsgesetz.
Welche Bedeutung hatte das Reichsjugendgerichtsgesetz von 1923?
Das Reichsjugendgerichtsgesetz von 1923 war ein Meilenstein in der Entwicklung des deutschen Jugendstrafrechts. Die Arbeit beleuchtet seine Bedeutung und die Rolle von Gustav Radbruch bei dessen Entstehung.
Welche Schlüsselthemen werden in der Arbeit behandelt?
Schlüsselthemen sind Franz von Liszts Straftheorie, der Erziehungsgedanke im Jugendstrafrecht, das Jugendgerichtsgesetz, der Schulenstreit, die Jugendkriminalität, der gesellschaftliche Wandel und die Reformvorschläge Liszts.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit ist in Einleitung (A), Hauptteil (B) und Fazit (C) gegliedert. Der Hauptteil behandelt Liszts Straftheorie, den Erziehungsgedanken, den Schulenstreit, den gesellschaftlichen Wandel, die Situation Jugendlicher um 1900, Liszts Reformvorschläge und schließlich das Reichsjugendgerichtsgesetz von 1923.
Wo finde ich detailliertere Informationen zu den einzelnen Kapiteln?
Das Inhaltsverzeichnis der Arbeit bietet eine detaillierte Übersicht der einzelnen Kapitel und Unterkapitel, die jeweils in der Zusammenfassung der Kapitel näher erläutert werden.
- Citation du texte
- Sabrina Erlenkamp (Auteur), 2021, Die Straftheorie Franz von Liszts. Einfluss auf die Entwicklung des Erziehungsgedankens im deutschen Jugendstrafrecht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1224358