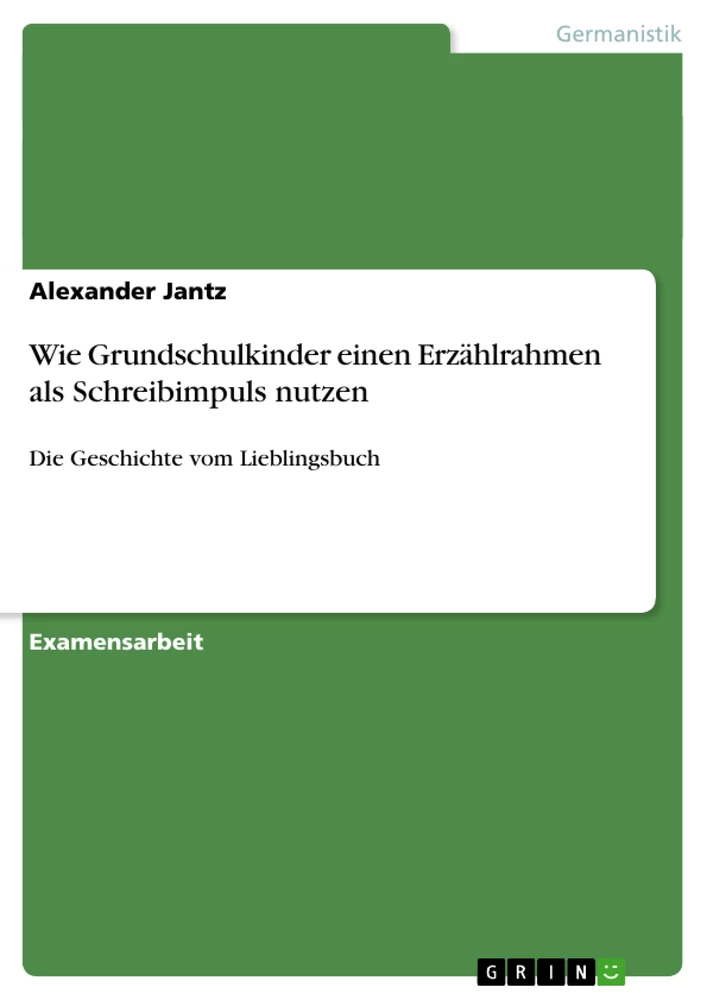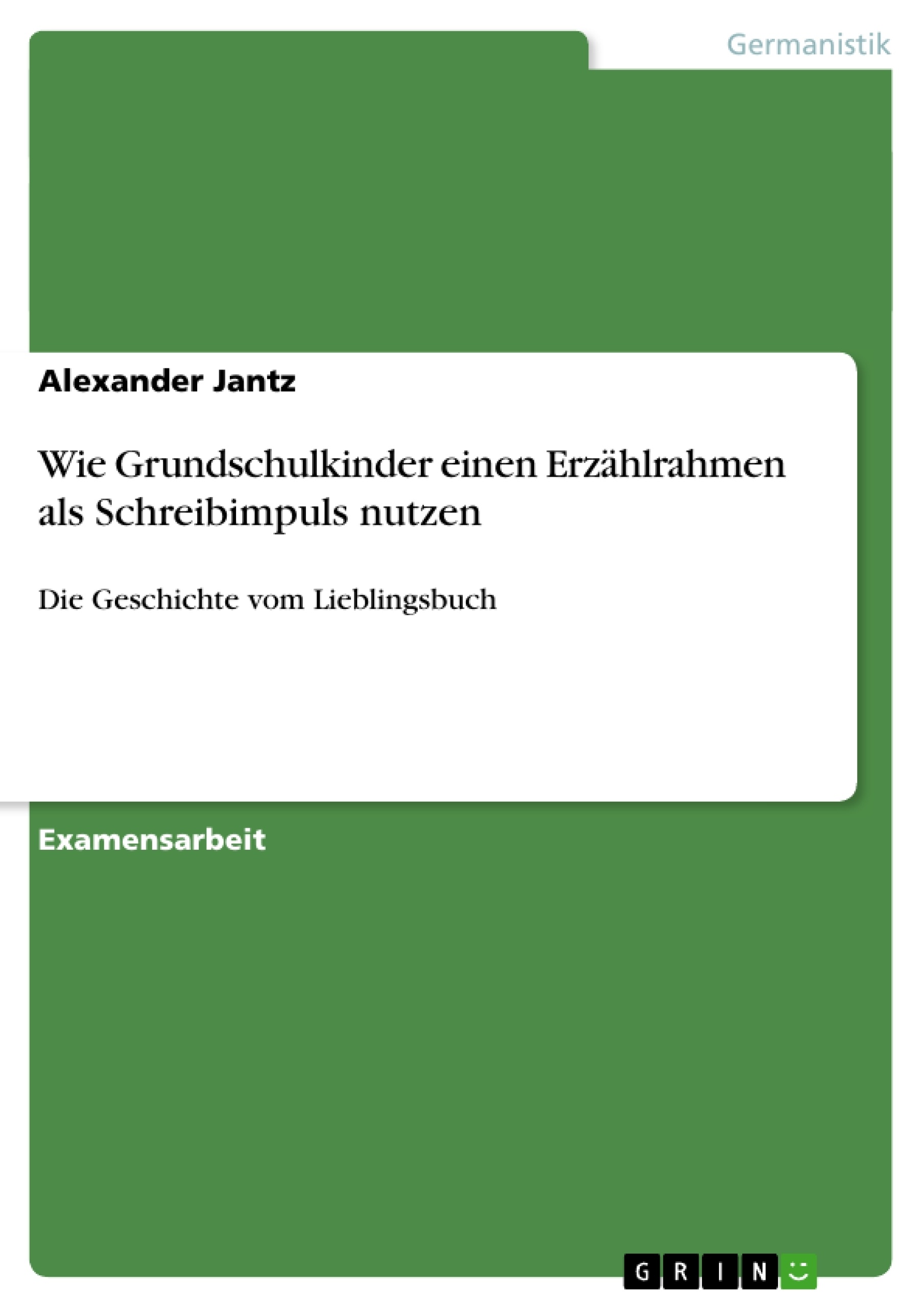Die Frage, wie Kompetenzen am besten vermittelt werden können, haben in den letzten Jahren, nicht zuletzt wegen der teilweise vernichtenden Bilanz internationaler Vergleichsstudien, zu angeregten Kontroversen in deutschen Kultusministerien, Hochschulen und Lehrerkollegien geführt, die auch aufgrund einer ausführlichen Medienbegleitung in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit ausgetragen wurden. Die Lösungsvorschläge sind dabei ebenso vielfältig wie konträr und führen in der öffentlichen Debatte nicht selten zur Kontrastierung des Konflikts ‚Kuschelpädagogik vs. strenge Unterrichtsführung’. In der anhaltenden Auseinandersetzung um Organisation, Inhalte und Instrumentarien der schulischen Bildung rückt aber das eigentliche Ziel, nämlich die Erziehung eines mündigen und kompetenten Bürgers im Sinne der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, oftmals in den Hintergrund der Diskussionen. Diese Erziehung erfordert in hohem Maße Flexibilität und Kreativität, jene Eigenschaften, die heutzutage dem Leitbild gesellschaftlichen Erfolges entsprechen. Denn nur wer kreativ ist, vermag Probleme zu lösen und steigende Anforderungen zu bewältigen und ist somit in der Lage, sein Leben eigenverantwortlich zu gestalten. Und gerade die mangelnde Kreativität vieler Schüler aus deutschen Bildungseinrichtungen wurde in den Vergleichsstudien beim Lösen von sogenannten Problemaufgaben offenkundig.
Dabei herrscht bei allen Differenzen hinsichtlich der Schulorganisation relative Einigkeit bezüglich einer fächerübergreifenden und ganzheitlichen Bildung, welche die Kinder in den Mittelpunkt pädagogischer Handlungen stellt. Trotz oder gerade wegen der fächerübergreifenden Ausrichtung der Grundschule hat der Deutschunterricht die zentrale Aufgabe, die grundlegenden Kulturtechniken Lesen und Schreiben zu vermitteln und damit „die entscheidenden Voraussetzungen für den Unterricht in allen anderen Fächern“ zu schaffen.
Die Abkehr vom normorientierten Interpretationsaufsatz erfolgt aber nur zögerlich, zu traditionell scheint die Ehrfurcht vor den literarischen Meisterwerken im Land der Dichter und Denker und so lässt man die Erben zahlreicher Nobelpreisträger immer noch vielfach lieber die Gedanken fremder Autoren wiedergeben als eigene Gedanken verfassen und reflektieren. Dabei ist das Schreiben nur eine weitere Ausdrucksmöglichkeit der individuellen Kreativität, die jedem Kinde schon lange vor Schuleintritt immanent ist und die es bereits in vielfältiger Form zu äußern imstande ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kinder schreiben eigene Texte
- Historischer Überblick
- Aufstieg und Verfall poetisch-produktiver Arbeiten im Schreibunterricht
- Die Entstehung des freien Aufsatzes
- Der freie Aufsatz in der Reformpädagogik
- Der Aufsatzunterricht nach 1945
- Die Begriffe freies Schreiben und kreatives Schreiben
- Bedeutung des kreativen Schreibens
- Schriftsprache – ein Kulturgut
- Wichtige Funktionen von Sprache
- Die kulturelle und individuelle Bedeutung der Schriftsprache
- Eigene Texte – Spiegelbild eigener Gedanken, Erfahrungen und Erinnerungen
- Der persönliche Wert von Kindertexten
- Schriftsprache – ein Kulturgut
- Impulse zum kreativen Schreiben
- Wahrnehmung und Erfahrung als Voraussetzung kreativer Schreibprozesse
- Ästhetische Erfahrung im Kontext kreativer Tätigkeiten
- Ästhetische Erfahrung im Kontext kindlicher Bildung
- Zehn Thesen zu einer basalen ästhetischen Bildung nach Schäfer
- Schreibimpulse als auslösendes Moment
- Möglichkeiten der Schreibanregung
- Wahrnehmung und Erfahrung als Voraussetzung kreativer Schreibprozesse
- Historischer Überblick
- Ein Schreibaufruf von E.M. Kohl: Das Lieblingsbuch
- Vorbemerkungen zum Schreibaufruf
- Der Schreibaufruf
- Untersuchung und Einordnung des Schreibimpulses
- Der Erzählrahmen im theoretischen Kontext
- Zusammenfassende Analyse des Schreibaufrufes
- Analyse der Kindertexte zum Schreibaufruf
- Einleitende Bemerkungen
- Auswertung und Analyse der Kindertexte
- Kriterien und Kategorien der Textauswertung
- Quantitative Tendenzen der untersuchten Texte
- Weiterführende Interpretationen an ausgewählten Beispielen
- Zusammenfassung der Kindertextanalyse
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Hausarbeit untersucht kreative Schreibprozesse von Grundschulkindern und analysiert, wie ein spezifischer Schreibimpuls ("Das Lieblingsbuch" von E.M. Kohl) von diesen Kindern aufgegriffen und verarbeitet wird. Die Arbeit verbindet theoretische Grundlagen kreativen Schreibens mit einer empirischen Analyse von Kindertexten.
- Historische Entwicklung des Schreibunterrichts in Deutschland
- Freies und kreatives Schreiben: Konzepte und Unterschiede
- Bedeutung des Schreibens für die kindliche Persönlichkeitsentwicklung
- Ästhetische Erfahrung als Grundlage kreativer Prozesse
- Analyse eines konkreten Schreibimpulses und der darauf basierenden Kindertexte
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit untersucht die Bedeutung kreativen Schreibens im Grundschulunterricht, beleuchtet die historische Entwicklung der Schreibdidaktik und deren aktuelle Konzepte (freies vs. kreatives Schreiben), um schließlich die Wirkung eines spezifischen Schreibimpulses auf die Texte von Grundschulkindern zu analysieren. Die mangelnde Kreativität vieler Schüler wird als Problem benannt, und die Arbeit sucht nach Wegen, diese zu fördern.
2. Kinder schreiben eigene Texte: Dieses Kapitel gibt einen historischen Überblick über den Aufsatzunterricht in Deutschland, von seinen Anfängen bis zur heutigen Diskussion um freies und kreatives Schreiben. Es werden die unterschiedlichen Ansätze und didaktischen Konzepte erläutert und die Bedeutung des kreativen Schreibens für die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern herausgestellt. Der Fokus liegt auf der Entwicklung vom normorientierten Aufsatz zum freien und kreativen Schreiben.
3. Ein Schreibaufruf von E.M. Kohl: Das Lieblingsbuch: Dieses Kapitel präsentiert den Schreibaufruf "Das Lieblingsbuch" von E.M. Kohl, der als Grundlage für den empirischen Teil der Arbeit dient. Der Aufruf wird detailliert analysiert, seine Struktur und seine potenzielle Wirkung auf die Kreativität der Kinder werden im Kontext der Schreibdidaktik untersucht. Die Analyse fokussiert auf die verwendeten literarischen Mittel und ihre Wirkung als Schreibimpuls.
4. Analyse der Kindertexte zum Schreibaufruf: Dieser Abschnitt beschreibt die Methodik der qualitativen Inhaltsanalyse, die für die Auswertung der Kindertexte verwendet wurde. Es werden die Kriterien und Kategorien vorgestellt, nach denen die Texte analysiert wurden (formale, inhaltliche, typisierende und skalierende Strukturierung). Quantitative Tendenzen und weiterführende Interpretationen ausgewählter Texte werden präsentiert, um den Einfluss des Schreibimpulses auf die kreativen Texte der Kinder aufzuzeigen.
Schlüsselwörter
Kreatives Schreiben, Schreibdidaktik, Grundschule, Kinderliteratur, Schreibimpuls, E.M. Kohl, Qualitative Inhaltsanalyse, Persönlichkeitsentwicklung, Ästhetische Erfahrung, Phantasie, Märchen, Erzählrahmen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse kreativer Schreibprozesse von Grundschulkindern
Was ist das Thema der wissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit untersucht kreative Schreibprozesse von Grundschulkindern und analysiert, wie ein spezifischer Schreibimpuls ("Das Lieblingsbuch" von E.M. Kohl) von diesen Kindern aufgegriffen und verarbeitet wird. Sie verbindet theoretische Grundlagen kreativen Schreibens mit einer empirischen Analyse von Kindertexten.
Welche Aspekte des kreativen Schreibens werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die historische Entwicklung des Schreibunterrichts in Deutschland, die Konzepte von freiem und kreativem Schreiben, die Bedeutung des Schreibens für die kindliche Persönlichkeitsentwicklung und die Rolle ästhetischer Erfahrung in kreativen Prozessen. Ein Schwerpunkt liegt auf der Analyse eines konkreten Schreibimpulses und der darauf basierenden Kindertexte.
Welche Methoden werden in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit verwendet eine qualitative Inhaltsanalyse zur Auswertung der Kindertexte. Es werden Kriterien und Kategorien vorgestellt, nach denen die Texte analysiert wurden (formale, inhaltliche, typisierende und skalierende Strukturierung). Quantitative Tendenzen und weiterführende Interpretationen ausgewählter Texte werden präsentiert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur historischen Entwicklung des Schreibunterrichts und zur Bedeutung des kreativen Schreibens, ein Kapitel zur Analyse des Schreibimpulses "Das Lieblingsbuch", ein Kapitel zur Analyse der Kindertexte und eine Schlussbetrachtung. Ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter sind ebenfalls enthalten.
Welchen Schreibimpuls untersucht die Arbeit?
Die Arbeit analysiert den Schreibimpuls "Das Lieblingsbuch" von E.M. Kohl. Dieser Schreibaufruf wird detailliert untersucht, seine Struktur und seine potenzielle Wirkung auf die Kreativität der Kinder werden im Kontext der Schreibdidaktik analysiert.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert quantitative Tendenzen und weiterführende Interpretationen ausgewählter Kindertexte, um den Einfluss des Schreibimpulses "Das Lieblingsbuch" auf die kreativen Texte der Kinder aufzuzeigen. Die Ergebnisse zeigen, wie Kinder den gegebenen Impuls aufnehmen und in eigenen Texten umsetzen.
Welche Bedeutung hat die Arbeit für die Schreibdidaktik?
Die Arbeit liefert Erkenntnisse über die Wirkung eines konkreten Schreibimpulses auf die Kreativität von Grundschulkindern und trägt somit zum Verständnis kreativer Schreibprozesse bei. Sie kann für Lehrkräfte im Grundschulunterricht wertvolle Hinweise zur Gestaltung von Schreibaufgaben und zur Förderung der Kreativität ihrer Schüler geben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Kreatives Schreiben, Schreibdidaktik, Grundschule, Kinderliteratur, Schreibimpuls, E.M. Kohl, Qualitative Inhaltsanalyse, Persönlichkeitsentwicklung, Ästhetische Erfahrung, Phantasie, Märchen, Erzählrahmen.
- Quote paper
- Alexander Jantz (Author), 2007, Wie Grundschulkinder einen Erzählrahmen als Schreibimpuls nutzen , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/122391