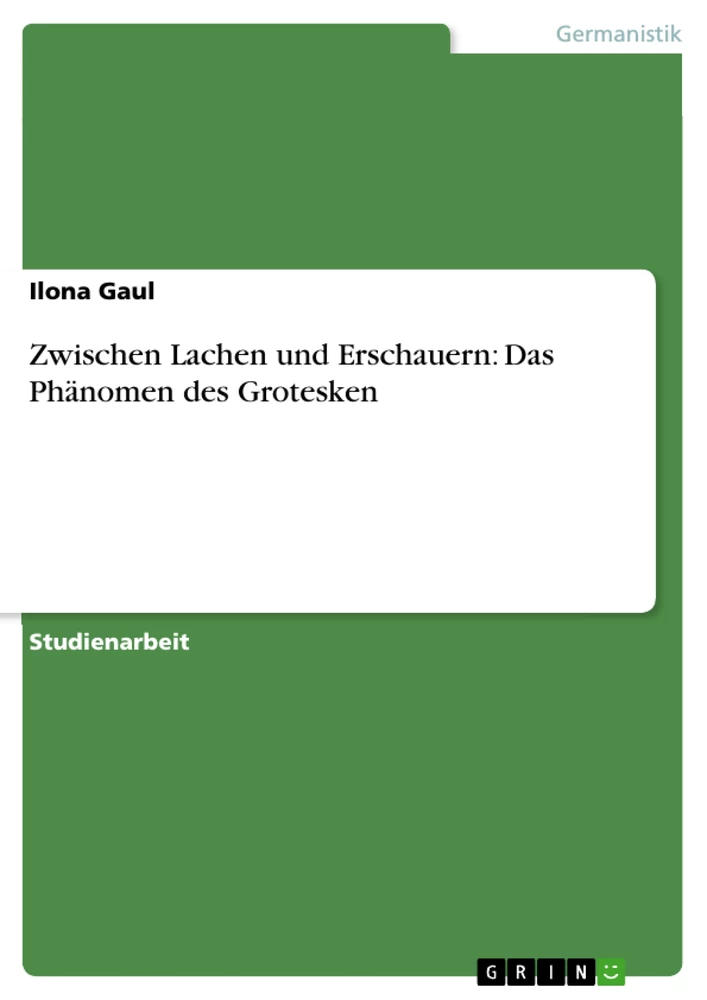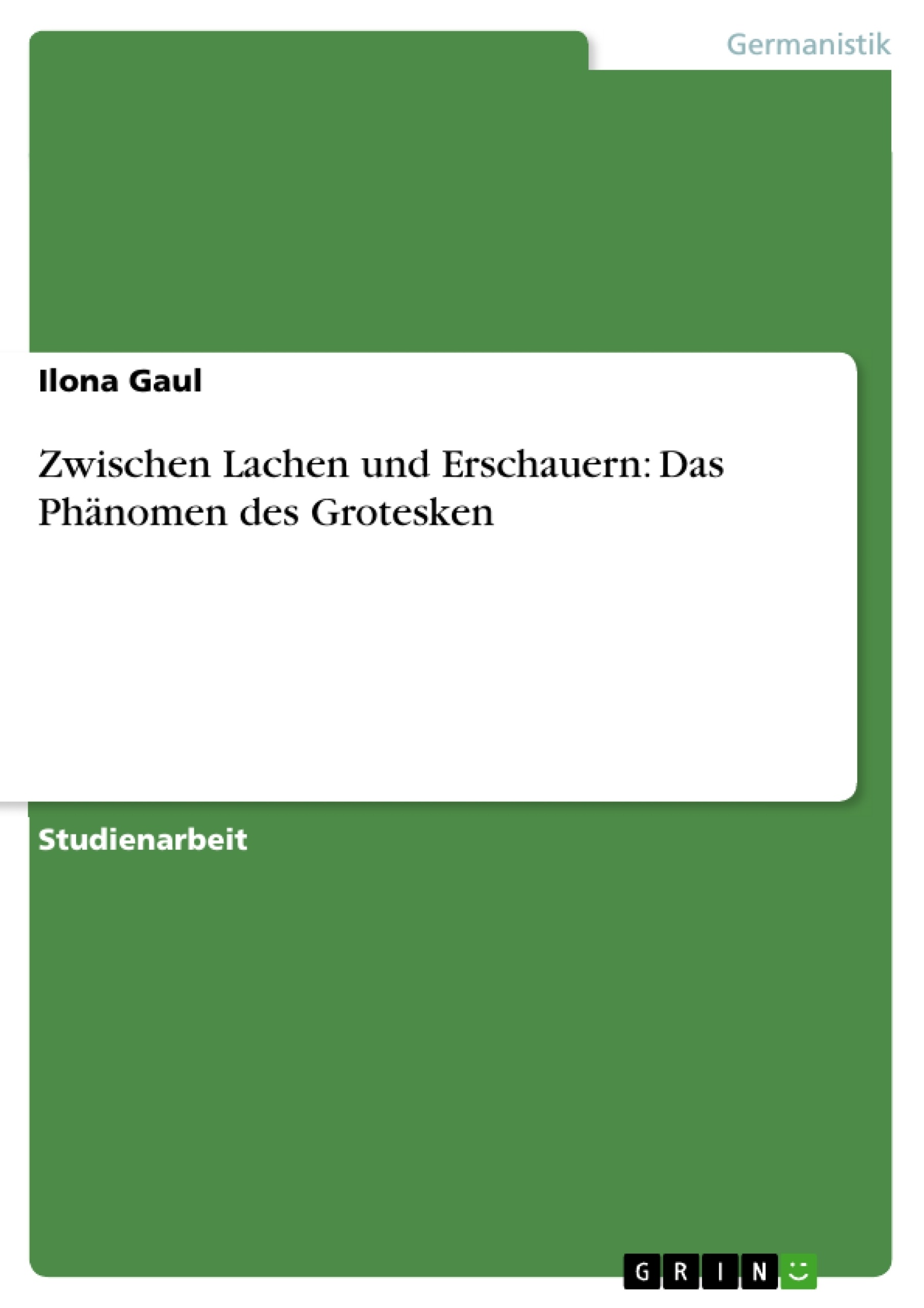Der Begriff grotesk entstand bereits im späten Mittelalter. Im Laufe der Zeit hat sich seine Bedeutung allerdings mehrfach gewandelt. Beispielsweise unterlief derGroreskbegriff Veränderungen, indem er neue Bedeutungen annahm oder alte allmählich ablegte, Peter Fuß bezeichnet das Groteske treffenderweise als ein "Medium des kulturellen Wandels". Das Groteske spielt vorrangig in Kunst und Literatur eine wichtige Rolle. Im Folgenden soll speziell auf die Bedeutung des Grotesken in der Literatur eingegangen werden, insbesondere wie es in Relation zum Begriff des Komischen steht und wie es das scheinbar Unvereinbare, Lachen und Grauen zu gleichen Teilen verkörpert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zwischen Lachen und Erschauern: Das Phänomen des Grotesken
- Herkunft und Analyse des Begriffs
- Das Groteske und die Komödie bei Dürrenmatt
- Das Groteske in Dürrenmatts Die Physiker
- Das Groteske in Kafkas Der Prozeß
- Groteske Elemente in Sternheims Die Hose und Manns Zauberberg
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen des Grotesken in der Literatur, insbesondere seine ambivalente Wirkung zwischen Lachen und Erschauern. Sie beleuchtet die historische Entwicklung des Begriffs und analysiert seine Anwendung in ausgewählten Werken der Literatur.
- Die historische Entwicklung des Begriffs „grotesk“
- Die Beziehung zwischen dem Grotesken und dem Komischen
- Die Darstellung des Grotesken in den Werken von Friedrich Dürrenmatt
- Die Analyse des Grotesken in Werken von Franz Kafka, Carl Sternheim und Thomas Mann
- Die ambivalente Wirkung des Grotesken im literarischen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Grotesken ein und beschreibt die vielschichtige und umstrittene Natur des Begriffs. Sie skizziert den historischen Wandel der Bedeutung und betont die zentrale Rolle des Grotesken in Kunst und Literatur, insbesondere im Spannungsfeld von Lachen und Grauen. Die Einleitung kündigt den methodischen Ansatz an: eine historische Begriffsanalyse gefolgt von konkreten literarischen Beispielen, wobei Dürrenmatts Werk im Vordergrund steht.
Zwischen Lachen und Erschauern: Das Phänomen des Grotesken: Dieses Kapitel beginnt mit der etymologischen Herleitung des Wortes „grotesk“ aus dem Italienischen und verfolgt seine Entwicklung durch die Kunstgeschichte, vom ulkigen Phantasieprodukt der Antike bis zur Abwertung im 19. und 20. Jahrhundert. Es werden verschiedene Definitionen und Auffassungen des Grotesken diskutiert, die oft divergieren. Die Analyse beleuchtet die zentrale Rolle der Verzerrung der Realität, die jedoch im Gegensatz zum Absurden einen Bezug zur Realität aufrechterhält. Die ambivalente Wirkung des Grotesken, die gleichzeitig Lachen und Erschauern hervorruft, wird als zentrales Merkmal herausgestellt.
Herkunft und Analyse des Begriffs: Dieser Abschnitt detailliert die sprachliche und künstlerische Entwicklung des Begriffs "grotesk", beginnend mit seinen antiken Wurzeln in den Höhlenmalereien Italiens. Die Analyse verfolgt den Weg vom ursprünglichen Verständnis als ulkiges Phantasieprodukt über die Renaissance bis hin zur Abwertung im 19. Jahrhundert und zum Verbot im Dritten Reich. Es werden verschiedene, oft widersprüchliche Definitionen und Interpretationen des Begriffs diskutiert, die die Komplexität des Phänomens unterstreichen.
Schlüsselwörter
Grotesk, Komik, Grauen, Literatur, Dürrenmatt, Kafka, Sternheim, Mann, Verzerrung, Realität, Ambivalenz, kultureller Wandel.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text: Analyse des Grotesken in der Literatur
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit analysiert das Phänomen des Grotesken in der Literatur, insbesondere seine ambivalente Wirkung zwischen Lachen und Erschauern. Sie untersucht die historische Entwicklung des Begriffs und seine Anwendung in ausgewählten Werken.
Welche Autoren und Werke werden untersucht?
Die Arbeit fokussiert auf die Werke von Friedrich Dürrenmatt (Die Physiker), Franz Kafka (Der Prozeß), Carl Sternheim (Die Hose) und Thomas Mann (Der Zauberberg). Dürrenmatts Werk nimmt dabei einen besonderen Stellenwert ein.
Welche Aspekte des Grotesken werden behandelt?
Die Analyse umfasst die historische Entwicklung des Begriffs „grotesk“, die Beziehung zwischen Groteskem und Komischem, die Darstellung des Grotesken in den ausgewählten Werken und dessen ambivalente Wirkung im literarischen Kontext. Die etymologische Herleitung des Wortes und seine Entwicklung durch die Kunstgeschichte werden ebenfalls beleuchtet.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Hauptkapitel zum Phänomen des Grotesken (mit Unterkapiteln zur Begriffsentwicklung und Analyse in den einzelnen Werken), und ein Fazit. Sie enthält außerdem ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit kombiniert eine historische Begriffsanalyse mit konkreten literarischen Beispielen. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der Verzerrung der Realität im Grotesken und seiner ambivalenten Wirkung, die gleichzeitig Lachen und Erschauern hervorruft.
Was ist die zentrale These der Arbeit?
Die zentrale These ist, dass das Groteske in der Literatur eine ambivalente Wirkung zwischen Lachen und Erschauern erzeugt und sich durch eine Verzerrung der Realität auszeichnet, die jedoch einen Bezug zur Realität aufrechterhält. Der Begriff selbst hat eine lange und vielschichtige Geschichte mit unterschiedlichen Interpretationen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Grotesk, Komik, Grauen, Literatur, Dürrenmatt, Kafka, Sternheim, Mann, Verzerrung, Realität, Ambivalenz, kultureller Wandel.
- Quote paper
- Ilona Gaul (Author), 2005, Zwischen Lachen und Erschauern: Das Phänomen des Grotesken, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/122327