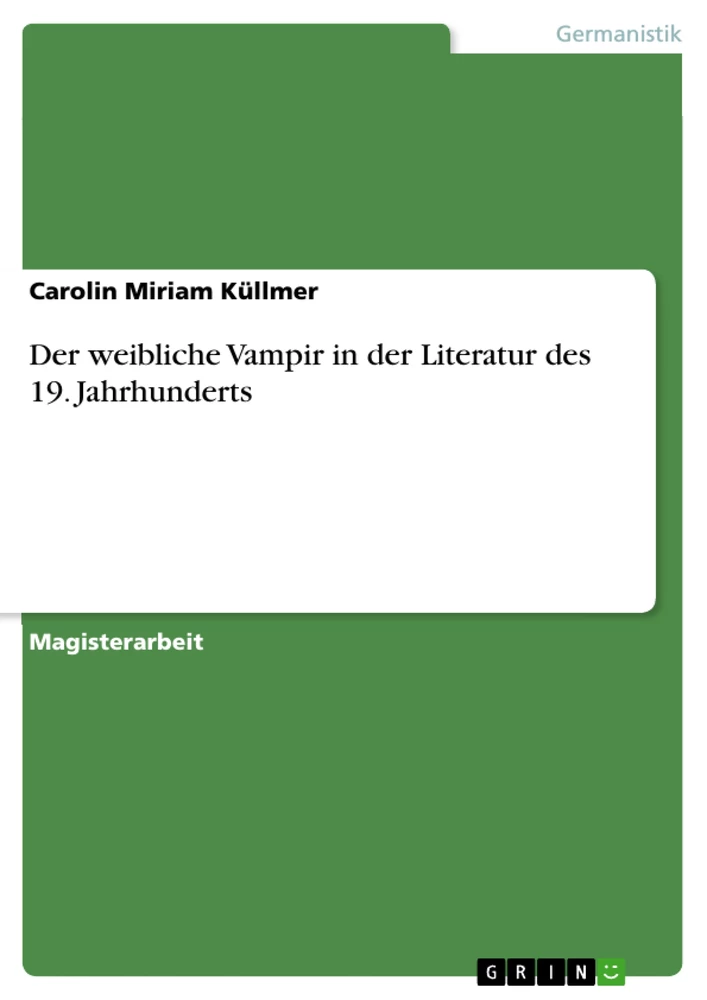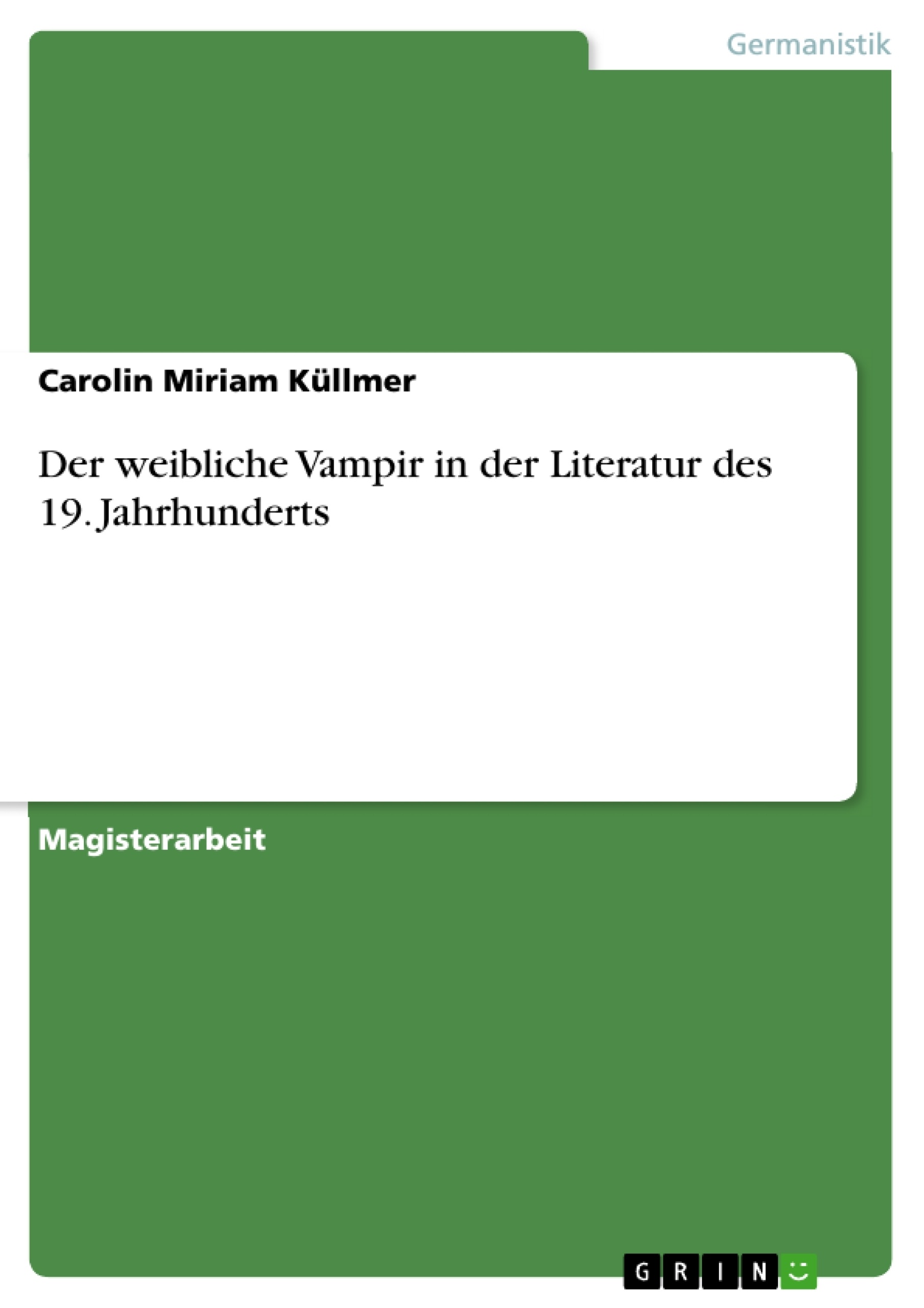In der Anzahl von wissenschaftlichen Arbeiten, die sich mit der mythologischen und literarischen Erscheinung des weiblichen Vampirs, eine sehr spezielle Ausprägung einer körperlichen Wiedergängerin, auseinandersetzen, können wir ein breites Spektrum an Lesarten für dieses interessante Sujet entdecken: So wird die weibliche Ausprägung des (wie wir später noch sehen werden männlich konnotierten) Vampirs von einigen Autoren beispielsweise als Grenzgängerin verstanden, die sich zwischen den Bereichen belebt/unbelebt, beseelt/unbeseelt bewegt; als erotisches, aber grausames Wesen, welches als Allegorie oder Metapher tätig ist, die eigenen Ur-Ängste vor Tod, Natur und Sexualität personifiziert und umsetzt, und die Abgründe der Seele, ihre geheimen Wünsche, aufgreift.
Wo die eine Dissertation über weibliche Vampire die psychoanalytischen und sexuellen Komponenten des Motivs herausarbeitet, stellt die nächste über männliche Wiedergänger beispielsweise die sozialpolitische in den Vordergrund. Ohne die symbolische Kraft des Blutes zu erwähnen oder die menschliche Neigung, den Tod zu verleugnen und aus dem Leben zu verdrängen, kommt keine literarische Auseinandersetzung mit dem Vampirmotiv wirklich aus. Der auslegungsträchtige Kerngedanke des Vampirismus wird so durch seine literarische Bearbeitung in jede nur erdenkliche Phantasie aufgegliedert.
In der phantastischen Literatur des 19. Jahrhunderts hat sich die Vampirin nicht zuletzt auch durch die Sensationsgier nach immer ausgefalleneren Monstren, einer unterwanderten rigiden Sexualmoral und dem Hang der Schwarzromantiker nach düsteren Horrorgeschichten einen Platz gesichert, den sie eigentlich schon seit Jahrhunderten innehat: Vampirinnen aus Fernsehen und Büchern, wie wir sie kennen, sind letztendlich Inkarnationen der weiblichen Lamien aus der griechischen Antike. Ziel meiner Untersuchungen wird es sein, dem Gegenstandsbereich der Vampirin eine Aufwertung erfahren zu lassen, ferner ihren Emanzipationsweg anhand von Texten nachzuformen und voranzutreiben. Ihr soll damit zumindest geistig der Platz zukommen, den sie, prozentual nach ihrem Vorkommen in der Literatur betrachtet, im Gegensatz zu ihren männlichen „Artgenossen“, ohnehin schon innehätte.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- I.1. Einleitende Bemerkungen
- II. Die Vampirin – (literarische) Anatomie eines unsterblichen Mythos
- II.1. Die untote Epidemie oder die Faszination des Außenseiters - Vampir/innen und Hexen als Verdammte der Jahrhunderte
- II.2. Liebe bis(s) zum Tod - Die (schwarze) Romantik und der Vampir
- II.3. Eros und Thanatos – Die schöne Leiche oder der erotische Tod
- II.4. Der dämonische Liebhaber wird zur Liebhaberin – Wandlung des Totenbrautmotivs oder: Die vampirische Emanzipation
- III. Die Sünde ist eine Frau – Dämonisierte Weiblichkeit und ängstliche Männlichkeit im 19. Jahrhundert
- III.1. Fragile, fatale oder fonctionelle? Frauenbilder des 19. Jahrhunderts zwischen Wunsch- und Schreckensvorstellung
- III.2. Sex sells: Vampirinnen, Rabenmütter und doppelmoralische Bürger als Stilmittel des 19. Jahrhunderts
- III.3. Rollentausch und „gender-Konflikte“ – Die Vampirexistenz als drittes Geschlecht
- III.4. Wenn du zum Weibe gehst, vergiss den Pfahle nicht – Phallische Hinrichtungen und die Herstellung der „alten Ordnung“
- IV. Resümee und Schlussbemerkungen
- IV.1. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die literarische Figur der Vampirin im 19. Jahrhundert. Ziel ist es, die Darstellung der weiblichen Vampirin als literarische Schöpfung zu analysieren und ihre Rolle im Kontext der gesellschaftlichen und kulturellen Normen jener Zeit zu beleuchten. Die Arbeit untersucht die Entwicklung des Motivs und seine Bedeutung als Spiegelbild von Ängsten und Sehnsüchten der damaligen Gesellschaft.
- Die Darstellung der weiblichen Vampirin in der Literatur des 19. Jahrhunderts
- Die Vampirin als Spiegelbild gesellschaftlicher Ängste vor weiblicher Sexualität und Macht
- Die literarische Vampirin im Kontext der Schwarzen Romantik
- Die Entwicklung des Vampirmotivs und seine Intertextualität
- Die Vampirin als Ausdruck von Emanzipationswünschen und "gender-Konflikten"
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der weiblichen Vampirin in der Literatur des 19. Jahrhunderts ein und skizziert den Forschungsstand. Sie hebt die Vielschichtigkeit des Motivs hervor und deutet an, dass die weibliche Vampirin als Grenzgängerin zwischen Leben und Tod, als Allegorie für Ängste vor Tod und Sexualität interpretiert werden kann. Die Einleitung betont die Bedeutung des Vampirmotivs als Ausdruck gesellschaftlicher und kultureller Kontexte. Sie weist darauf hin, dass die Arbeit sich ausschließlich auf die literarische Figur der Vampirin konzentriert und diese als eine männliche Schöpfung, die sich aus diversen kulturellen Motiven speist, darstellt.
II. Die Vampirin – (literarische) Anatomie eines unsterblichen Mythos: Dieses Kapitel untersucht die literarische Vampirin im Detail. Es analysiert die Figur aus verschiedenen Perspektiven, indem es die Vampirin als Außenseiterin, erotisches Wesen und Allegorie für Tod und Sexualität darstellt. Es beleuchtet die Verbindungen zu Mythen wie den Lamien der griechischen Antike und diskutiert die Rolle der Schwarzen Romantik in der Entwicklung des Vampirmotivs. Ein wichtiger Aspekt ist die Untersuchung der Transformation des Totenbrautmotivs in ein Symbol weiblicher Emanzipation. Die unterschiedlichen Interpretationen des Vampirismus und der Einfluss des Christentums werden ebenfalls berücksichtigt.
III. Die Sünde ist eine Frau – Dämonisierte Weiblichkeit und ängstliche Männlichkeit im 19. Jahrhundert: Dieses Kapitel befasst sich mit der gesellschaftlichen Wahrnehmung von Weiblichkeit im 19. Jahrhundert und deren Beziehung zur Figur der Vampirin. Es analysiert die verschiedenen Frauenbilder der Epoche und deren Einfluss auf die Gestaltung der Vampirin. Der Fokus liegt auf der Ambivalenz der weiblichen Figur und ihrer Funktion als Stilmittel in der Literatur. Die Kapitel betrachten Themen wie die "doppelmoralische Bürgerlichkeit" und "gender-Konflikte" im Kontext des Vampirmotivs. Die Darstellung phallischer Hinrichtungen und die Wiederherstellung der "alten Ordnung" in Bezug auf die weibliche Vampirin werden ebenfalls diskutiert.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Die Vampirin – (literarische) Anatomie eines unsterblichen Mythos
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die literarische Figur der Vampirin im 19. Jahrhundert. Sie untersucht ihre Darstellung als literarische Schöpfung und ihre Rolle im Kontext der gesellschaftlichen und kulturellen Normen der damaligen Zeit. Der Fokus liegt auf der Entwicklung des Motivs und seiner Bedeutung als Spiegelbild von Ängsten und Sehnsüchten der Gesellschaft.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Darstellung der weiblichen Vampirin in der Literatur des 19. Jahrhunderts, die Vampirin als Spiegelbild gesellschaftlicher Ängste vor weiblicher Sexualität und Macht, die literarische Vampirin im Kontext der Schwarzen Romantik, die Entwicklung des Vampirmotivs und seine Intertextualität, sowie die Vampirin als Ausdruck von Emanzipationswünschen und "gender-Konflikten".
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zur literarischen Anatomie der Vampirin, ein Kapitel zur dämonisierten Weiblichkeit und ängstlichen Männlichkeit im 19. Jahrhundert und abschließende Resümee und Schlussbemerkungen. Jedes Kapitel enthält mehrere Unterkapitel, die die einzelnen Aspekte des Themas vertiefen.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung führt in das Thema ein, skizziert den Forschungsstand und hebt die Vielschichtigkeit des Motivs hervor. Sie deutet an, dass die weibliche Vampirin als Grenzgängerin zwischen Leben und Tod und als Allegorie für Ängste vor Tod und Sexualität interpretiert werden kann. Die Bedeutung des Vampirmotivs als Ausdruck gesellschaftlicher und kultureller Kontexte wird betont.
Was ist der Inhalt des Kapitels "Die Vampirin – (literarische) Anatomie eines unsterblichen Mythos"?
Dieses Kapitel analysiert die literarische Vampirin aus verschiedenen Perspektiven: als Außenseiterin, erotisches Wesen und Allegorie für Tod und Sexualität. Es beleuchtet Verbindungen zu Mythen und diskutiert die Rolle der Schwarzen Romantik. Die Transformation des Totenbrautmotivs in ein Symbol weiblicher Emanzipation und der Einfluss des Christentums werden ebenfalls berücksichtigt.
Worauf konzentriert sich das Kapitel "Die Sünde ist eine Frau – Dämonisierte Weiblichkeit und ängstliche Männlichkeit im 19. Jahrhundert"?
Dieses Kapitel befasst sich mit der gesellschaftlichen Wahrnehmung von Weiblichkeit im 19. Jahrhundert und deren Beziehung zur Figur der Vampirin. Es analysiert verschiedene Frauenbilder der Epoche und deren Einfluss auf die Gestaltung der Vampirin. Es betrachtet Themen wie die "doppelmoralische Bürgerlichkeit" und "gender-Konflikte" im Kontext des Vampirmotivs. Die Darstellung phallischer Hinrichtungen und die Wiederherstellung der "alten Ordnung" werden ebenfalls diskutiert.
Gibt es ein Resümee?
Ja, die Arbeit enthält ein Resümee und Schlussbemerkungen, die die wichtigsten Ergebnisse zusammenfassen.
Auf welche Art von Vampirin konzentriert sich die Arbeit?
Die Arbeit konzentriert sich ausschließlich auf die literarische Figur der *weiblichen* Vampirin und stellt diese als eine männliche Schöpfung dar, die sich aus diversen kulturellen Motiven speist.
- Quote paper
- Magistra Artium Carolin Miriam Küllmer (Author), 2008, Der weibliche Vampir in der Literatur des 19. Jahrhunderts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/122326