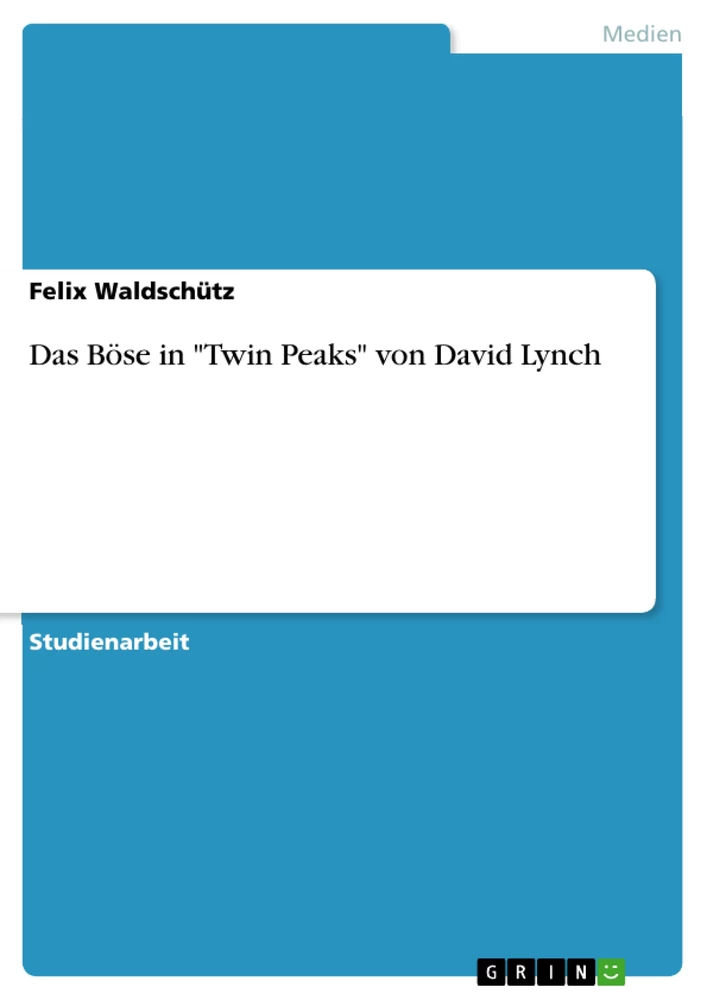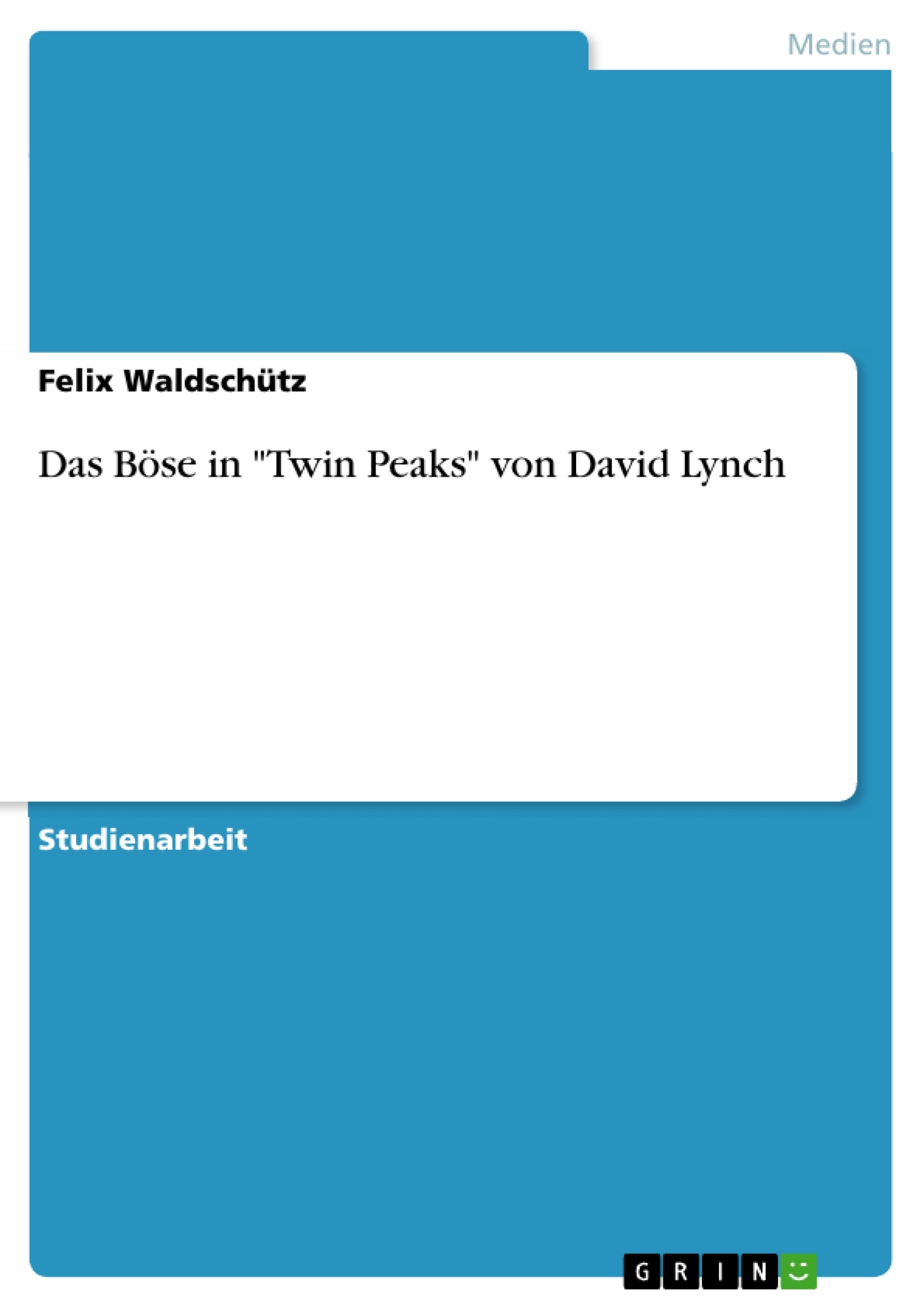Diese Seminararbeit ist das Ergebnis einer Auseinandersetzung mit allen Teilen der Serie Twin Peaks. Im ersten Kapitel wird analysiert, was dazu geführt hat, dass die Serie Kultstatus erlangt hat und man deswegen auch im Jahr 2020 noch einen Artikel darüber liest sowie welche Bedingungen in der Fernsehindustrie zur Produktionszeit geherrscht haben, um zu zeigen, worum es sich bei der Innovation von Twin Peaks handelt.
In der Mitte des Kapitels wird dabei auf die Zuordnung zum Surrealismus und zur Postmoderne eingegangen. Abschließend wird ein kurzer Abriss der Rezeption mit einem Hinweis auf die besondere Bedeutung der Fans gegeben, wo sich zwischen der ersten und zweiten Staffel ein drastischer Bruch zeigen lässt. Im zweiten Kapitel wird dem eigentlichen Thema der Arbeit nachgegangen: der Frage nach dem Bösen in Twin Peaks. Auf die doppelte Form der Erzählung abgestimmt, ist auch dieses Kapitel zweigeteilt. Einerseits lässt sich dem Bösen in der Konzeption von Lynch in der Familie begegnen, in der Serie handelt es sich dabei um Mittelklasse Familien einer durchschnittlichen amerikanischen Kleinstadt. Es lässt sich darstellen, dass in Twin Peaks die erste Begegnung eines Individuums mit dem Bösen schon hier stattfindet. Der zweite Teil des Kapitels widmet sich dem allgemeineren Ursprung, nachdem sich die Charaktere in der dritten Staffel zu fragen beginnen, wann das denn alles angefangen hat. Die Antwort, die wie typisch für die Serie nicht lückenlos aufgeklärt ist, findet sich in der achten Episode der dritten Staffel, anhand dieser versucht wird, eine Antwort à la David Lynch zu geben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. ,,Twin Peaks" als revolutionäres Fernsehen
- Twin Peaks und Genre
- Continuous Serial, Episodic Serial und Genre
- Quality TV und Auteur TV
- Surrealismus und Postmoderne in Twin Peaks
- Surrealism without the unconscious
- Postmodernität
- Rezeption
- Fankult und alt.tv.twin-peaks
- II. Der Ursprung des Bösen
- Familie oder Mittelklasse Gesellschaft in Amerika
- Mythologischer Ursprung/Kernspaltung
- Der Kultstatus von "Twin Peaks" und die Gründe für seine Popularität
- Die innovative Genremischung und ästhetische Struktur der Serie
- Der Einsatz von Surrealismus und Postmoderne in "Twin Peaks"
- Die Rezeption der Serie und die Rolle der Fangemeinde
- Die Darstellung des Bösen in "Twin Peaks" und seine verschiedenen Manifestationen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit analysiert die TV-Serie "Twin Peaks" in Bezug auf ihren Kultstatus und ihre revolutionäre Rolle im Fernsehen. Sie untersucht die Genres und ästhetischen Elemente, die zur Einzigartigkeit der Serie beitragen, insbesondere den Surrealismus und die Postmoderne. Zudem beleuchtet die Arbeit die Rezeption der Serie und den Einfluss ihrer Fangemeinde.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik der Seminararbeit ein und stellt den Kultstatus von "Twin Peaks" sowie dessen Bedeutung im Kontext der Fernsehgeschichte dar. Zudem werden die zentralen Themen und die Struktur der Arbeit skizziert.
I. ,,Twin Peaks" als revolutionäres Fernsehen
Dieses Kapitel analysiert die Faktoren, die "Twin Peaks" zu einem revolutionären Fernsehformat machten. Es werden die Genrezugehörigkeit, insbesondere die Mischung aus Seifenoper und Krimi, sowie die innovative Struktur und die ästhetische Qualität der Serie beleuchtet. Außerdem werden die Einflüsse von Surrealismus und Postmoderne in Bezug auf die Serie untersucht.
II. Der Ursprung des Bösen
Im zweiten Kapitel wird die Frage nach dem Bösen in "Twin Peaks" behandelt. Es werden zwei verschiedene Aspekte des Bösen untersucht: das Böse im Kontext der Familie und die Mittelklassegesellschaft in Amerika sowie der mythologische Ursprung des Bösen in der Serie.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter dieser Seminararbeit sind "Twin Peaks", "David Lynch", "Surrealismus", "Postmoderne", "Genre", "Seifenoper", "Krimi", "Kultstatus", "Fankult", "Rezeption", "Böse" und "Mythologie".
- Citar trabajo
- Felix Waldschütz (Autor), 2021, Das Böse in "Twin Peaks" von David Lynch, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1223082