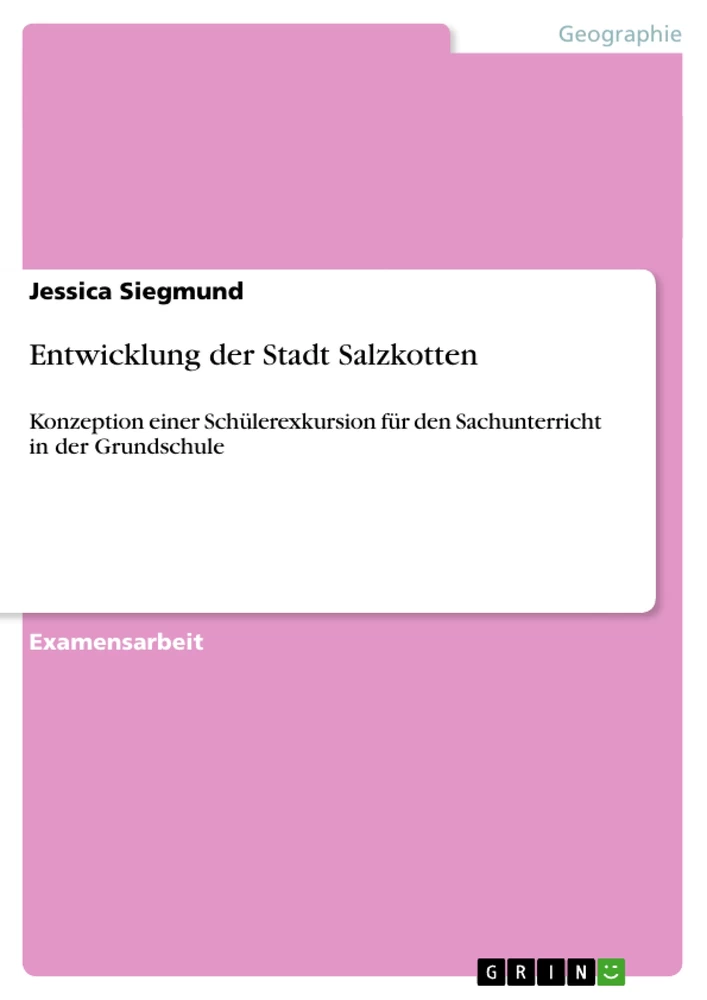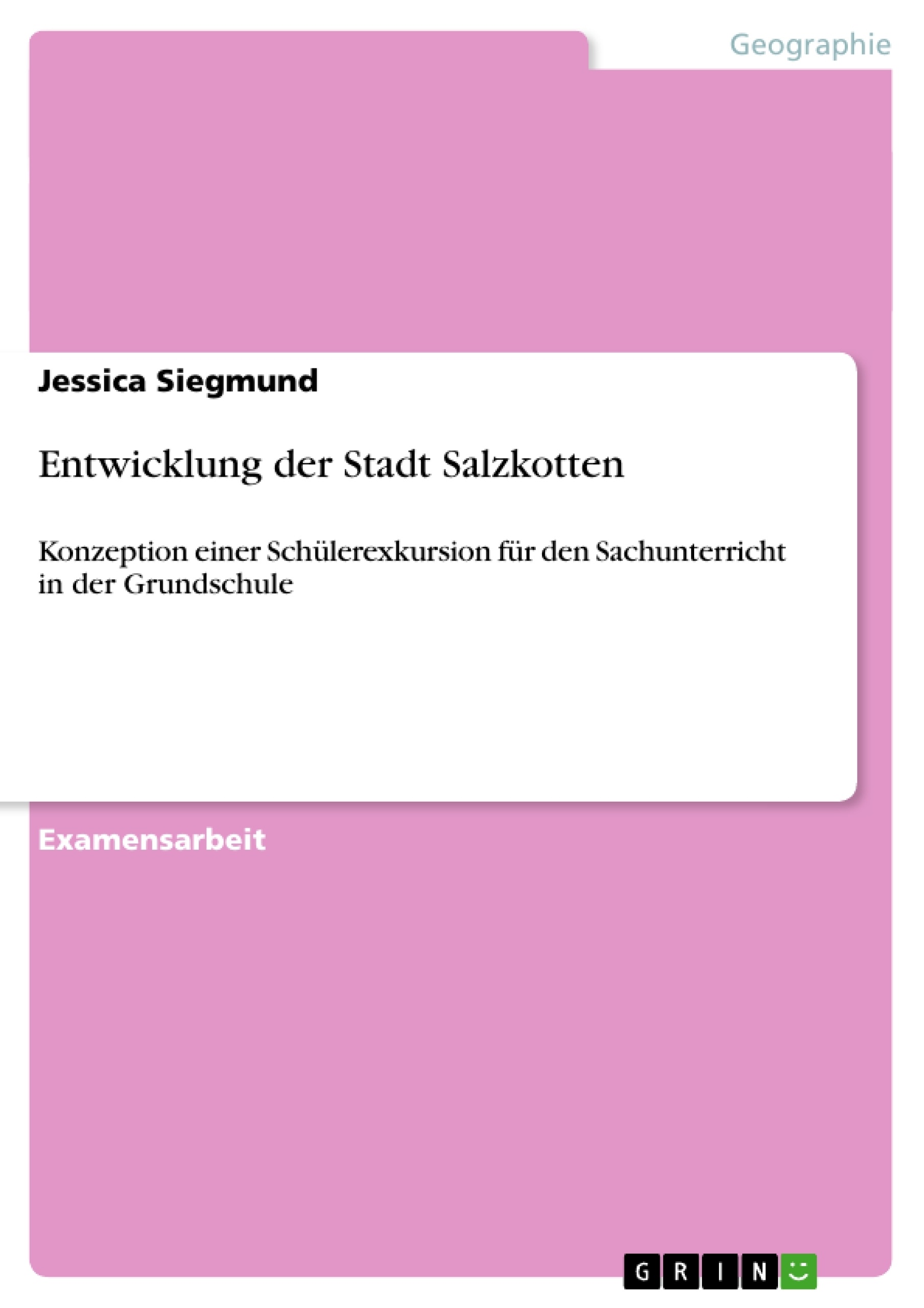1. Einleitung
Typisch:
Der Lehrer nimmt den Bach durch.
Er zeigt ein Bild.
Er zeichnet an die Wandtafel.
Er beschreibt.
Er schildert.
Er erzählt.
Er schreibt auf.
Er diktiert ins Heft.
Er gibt eine Hausaufgabe.
Er macht eine Prüfung.
Hinter dem Schulhaus fließt munter der Bach vorbei.
Vorbei.
So wie in diesem Gedicht verläuft auch heute noch häufig der Sachunterricht in Grundschulen. Es wird zu oft der Gang in die Natur oder ein Besuch der näheren Umgebung der Schule gescheut. Dabei ist es besonders wichtig, den Schülern ihre Lebensumwelt näher zu bringen und sie ihnen zu erklären. Bereits die Untersuchungen Piagets zeigten, dass Kinder im Grundschulalter die direkte Auseinandersetzung mit der Umwelt für den Verstehensprozess brauchen, um dadurch ihr Wissen besser entwickeln zu können.
Hinzu kommt, dass die neuen, ständigen Veränderungen der Lebensumwelt die Gelegenheiten für aktive, verantwortungsvolle Betätigungen der Kinder in ihrer Freizeit stark reduzieren. So ist es für Kinder heutzutage schwieriger, Primärerfahrungen im Bereich Familie oder Natur zu sammeln. Sie erhalten ihre Informationen größtenteils aus den neuen Medien, wie Fernseher, Computer oder Internet, und verlieren dadurch den Realitäts- und Praxisbezug zu vielen Dingen. Gewöhnen sich Kinder erst einmal an eine Aneignung von Wissen durch technische Bilder, werden die Entwicklung der Fantasie und die Denktätigkeit gehemmt.
Mit der Veränderung der Lebensumwelt geht auch ein stetiger Wandel der Gesellschaft einher. Durch Verbote oder die Einengung des natürlichen Bewegungsdrangs wird außerdem der Entdeckungsdrang der Kinder und weitere ihrer eigenen Entfaltungsmöglichkeiten eingeschränkt, obwohl die „Voraussetzungen für einen erfolgreichen Lernprozess [...] Phasen der Aktivität und Passivität sowie tägliche Bewegung“ sind.
Die Lehrpläne der Bundesländer fordern deshalb als methodisches Ziel die originale Begegnung des Kindes mit dem Lerngegenstand. Schließlich haben Untersuchungen ergeben, dass der Mensch sich „ungefähr 10% neuen Wissens durch Lesen, 20% durch Hören, 30% durch Sehen, 50% durch Sehen und Hören, 80% durch eigenes Sprechen und 90% durch eigenes Handeln“ aneignet. Diese Methoden zielen auf einen handlungsorientierten, offenen Unterricht ab, der zu einem entdeckenden Lernen führen und nicht nur im Klassenzimmer stattfinden soll.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Bedeutung von außerschulischem Lernen in der Grundschule
- 2.1 Zum Begriff Exkursion
- 2.2 Ziele von Exkursionen
- 2.2.1 Veränderte Kindheit
- 2.3 Vorteile von Exkursionen
- 2.3.1 Motivation der Schüler
- 2.3.2 Fächerübergreifender Unterricht
- 2.3.3 Handlungsorientiertes Lernen
- 2.3.4 Vermittlung neuer Arbeitsmethoden
- 2.3.5 Soziales Lernen
- 2.4 Methodische Durchführung einer Exkursion
- 2.4.1 Leitlinien für die Planung und die Organisation einer Exkursion
- 2.4.2 Leitlinien für die Durchführung einer Exkursion
- 2.4.3 Nachbereitung einer Exkursion
- 2.5 Schwierigkeiten und Probleme
- 2.6 Schlussfolgerung
- 3. Die Geschichte der Stadt Salzkotten
- 3.1 Verlauf der Salzkottener Stadtgründung
- 3.2 Salzkotten zwischen Großer Pest und Dreißigjährigem Krieg
- 3.3 Salzkotten im 17. und 18. Jahrhundert
- 3.4 Die Kleinstadt Salzkotten zur Zeit des Kaiserreichs
- 3.5 Salzkotten in der Weimarer Zeit
- 3.6 Auswirkungen des 2. Weltkrieges auf die Stadt
- 3.7 Aufschwung der 50er Jahre
- 3.8 Die Stadt nach der kommunalen Neugliederung
- 4. Planung einer Exkursion zu der Entwicklung der Stadt Salzkotten für ein 4. Schuljahr
- 4.1 Begründung der Wahl des Exkursionsthemas
- 4.1.1 Didaktische Begründung des Themas für ein 4. Schuljahr
- 4.2 Vorbereitende Maßnahmen
- 4.2.1 Inhaltliche und methodische Voraussetzungen
- 4.3 Tabellarische Übersicht der Standorte
- 4.3.1 Die Standorte im Einzelnen
- 4.4 Nachbereitung
- 4.1 Begründung der Wahl des Exkursionsthemas
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Examensarbeit konzipiert eine Schülerexkursion zur Entwicklung der Stadt Salzkotten für den Sachunterricht der Grundschule. Ziel ist es, den Schülern die geographische Entwicklung ihrer Heimatstadt anhand realer Objekte und historischer Quellen auf anschauliche und handlungsorientierte Weise näherzubringen. Die Exkursion soll die Motivation steigern, fächerübergreifendes Lernen ermöglichen und soziale Kompetenzen fördern.
- Bedeutung außerschulischer Lernorte im Sachunterricht
- Historische Entwicklung der Stadt Salzkotten
- Zusammenhang zwischen Geschichte und geographischer Ausdehnung
- Methodische Planung und Durchführung von Exkursionen
- Didaktische Aspekte des Themas für die 4. Klasse
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung betont die Wichtigkeit außerschulischen Lernens und die Exkursion als Methode. Kapitel 2 befasst sich ausführlich mit der Bedeutung, Zielen und Vorteilen von Exkursionen, inklusive methodischer Aspekte der Planung und Durchführung sowie möglicher Schwierigkeiten. Kapitel 3 bietet einen historischen Überblick über Salzkotten, von der Stadtgründung bis zum Aufschwung in den 50er Jahren, mit Fokus auf die Entwicklungsphasen und deren Einfluss auf das Stadtbild. Kapitel 4 präsentiert die detaillierte Planung einer Exkursion für die 4. Klasse, inklusive Begründung des Themas, Vorbereitungsmaßnahmen und Beschreibung der einzelnen Standorte.
Schlüsselwörter
Außerschulisches Lernen, Exkursion, Sachunterricht, Grundschule, Stadtentwicklung, Salzkotten, Stadtgeschichte, historische Geographie, Didaktik, Methodik, Handlungsorientierung, Salzgewinnung, Stadtplanung.
- Citar trabajo
- Jessica Siegmund (Autor), 2008, Entwicklung der Stadt Salzkotten , Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/122305