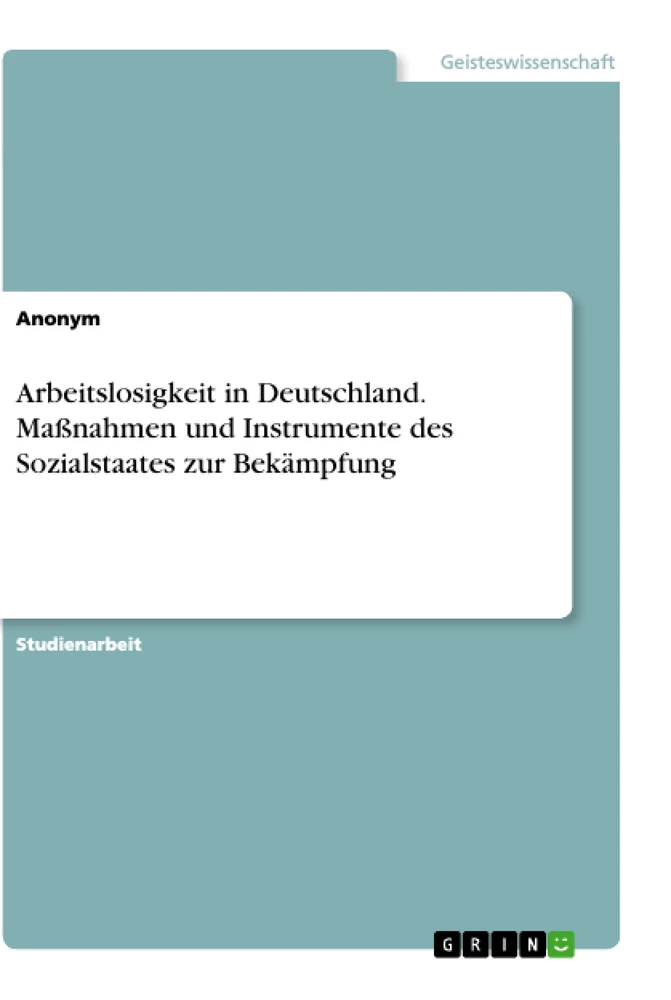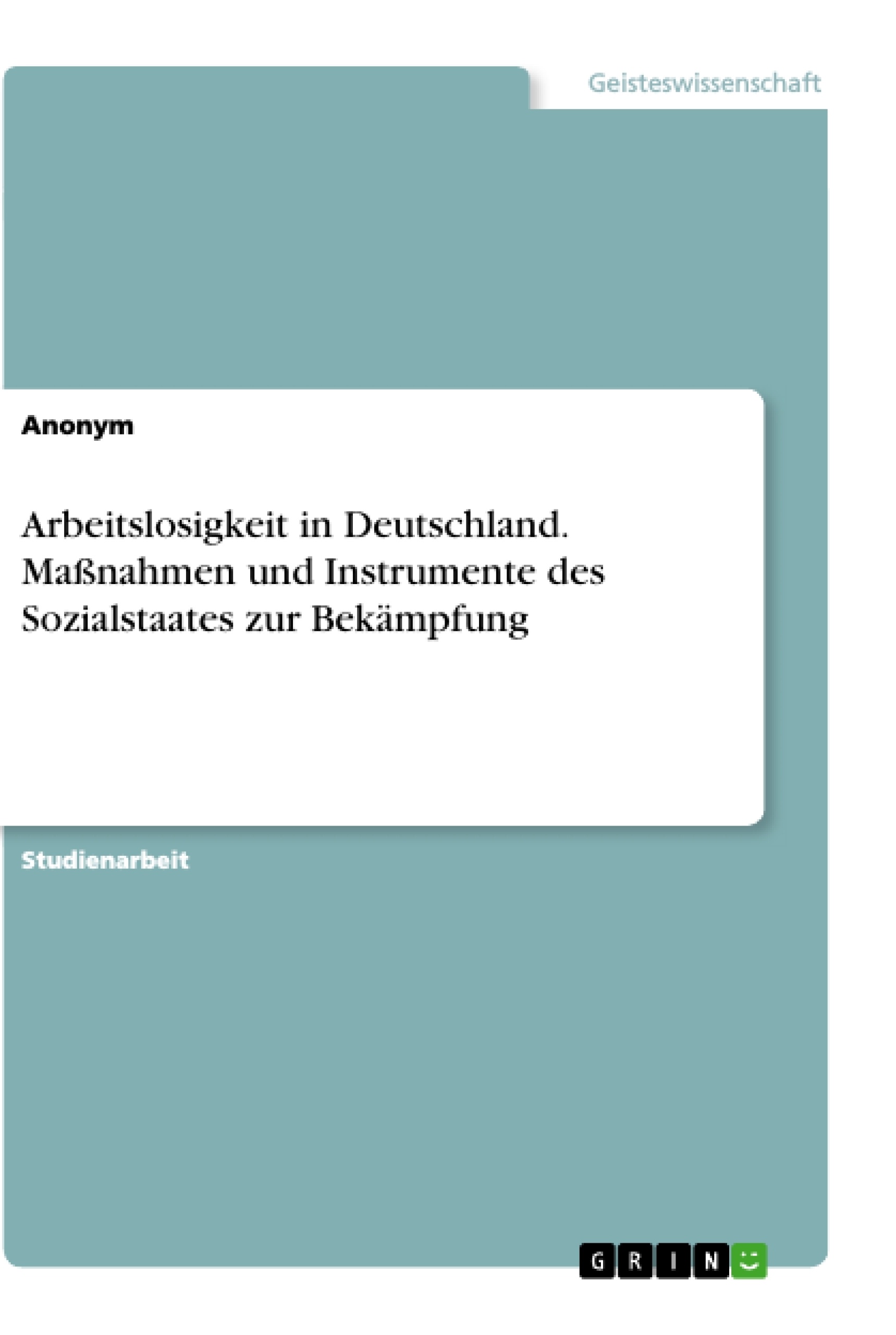Die Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, wie Arbeitslosigkeit in Deutschland ganz konkret staatlich bearbeitet wird. Bevor die Fragestellung beantwortet wird, erfolgt zunächst die Erläuterung theoretischer Grundlagen. Im Anschluss wird auf Arbeitslosigkeit im Allgemeinen Bezug genommen. Hierbei werden mögliche Ursachen sowie Folgen von Arbeitslosigkeit näher beleuchtet. In Kapitel 4 werden schließlich einzelne Maßnahmen und Instrumente des deutschen Sozialstaates zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit herausgearbeitet und beschrieben. Im letzten Kapitel folgt das Fazit.
Mit Blick auf die wirtschaftspolitischen Ereignisse der vergangenen Jahrzehnte wird ersichtlich, dass die Arbeitslosigkeit in Deutschland mehrere Entwicklungsstadien durchlief. Ausgehend von der stark erhöhten Nachkriegsarbeitslosigkeit, kam es zwischen 1960 und 1973 sukzessive zu einer Vollbeschäftigung. Ab 1973 setzte die Phase der Persistenz ein - jede Rezession bewirkte, dass die Arbeitslosigkeit anstieg, ohne in den darauffolgenden Aufschwungsphasen wieder gänzlich abzuklingen. Nach 2005 erholte sich der Arbeitsmarkt schließlich, sodass zu Beginn des Jahres 2010 sogar die Rede von einem erneuten Beschäftigungswunder war. Die Zahl der Arbeitslosen sank zu diesem Zeitpunkt von 4,86 Millionen bis 2010 auf 3,24 Millionen.
Doch trotz dieser positiven Entwicklung sind zum heutigen Stand immer noch rund 2,45 Millionen Menschen in Deutschland ohne Erwerbsarbeit. Bei der Lösung dieser Problematik geht es darum, Arbeitslosigkeit möglichst zu vermeiden oder zumindest zu verkürzen. Dabei sollen die Mittel für die Arbeitsmarktpolitik wirksam und wirtschaftlich eingesetzt werden und zugleich einem sozialpolitischen Ziel dienen. Für dieses Vorhaben sind Instrumente des SGB III sowie SGB II vorgesehen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Begriffsklärung
- 2.1 Erwerbsarbeit
- 2.2 Arbeitslosigkeit
- 2.3 Sozialstaat
- 3 Zur Arbeitslosigkeit
- 3.1 Mögliche Ursachen
- 3.2 Folgen für Betroffene
- 4 Gegenmaßnahmen des Staates
- 4.1 Förderleistungen nach dem SGB III
- 4.1.1 Berufsberatung, Ausbildungs- und Arbeitsvermittlung
- 4.1.2 Aktivierung und berufliche Eingliederung
- 4.1.3 Berufliche Weiterbildung
- 4.1.4 Arbeitslosengeld
- 4.2 Förderleistungen nach dem SGB II
- 4.2.1 Teilhabechancengesetz
- 4.2.2 Leistungen zur Eingliederung von Selbstständigen
- 4.2.3 Nachgehende Betreuung
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit in Deutschland. Sie beleuchtet die theoretischen Grundlagen, analysiert die Ursachen und Folgen von Arbeitslosigkeit und beschreibt detailliert die Instrumente des SGB III und SGB II. Das Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis der staatlichen Interventionen im Kampf gegen Arbeitslosigkeit zu vermitteln.
- Definition und Bedeutung von Erwerbsarbeit, Arbeitslosigkeit und Sozialstaat
- Ursachen und Folgen von Arbeitslosigkeit in Deutschland
- Förderleistungen des SGB III zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit
- Förderleistungen des SGB II zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit
- Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit, Armut und sozialer Kohäsion
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeitslosigkeit in Deutschland ein und beleuchtet deren Entwicklung in den vergangenen Jahrzehnten. Sie verweist auf die Bedeutung der Arbeitslosigkeit als Armutsrisiko und die Notwendigkeit wirksamer staatlicher Gegenmaßnahmen. Das Zitat von Alexander Herzen dient als Inspiration für die Untersuchung der staatlichen Interventionen im Kontext des deutschen Sozialstaates. Die Arbeit fokussiert sich auf die konkrete staatliche Bearbeitung von Arbeitslosigkeit und gliedert die darauffolgenden Kapitel.
2 Begriffsklärung: Dieses Kapitel klärt die zentralen Begriffe Erwerbsarbeit, Arbeitslosigkeit und Sozialstaat. Es differenziert zwischen verschiedenen Definitionen von Arbeit und betont die psychosozialen Funktionen von Erwerbsarbeit nach Staedtke. Die Definition von Arbeitslosigkeit nach § 16 Abs. 1 SGB III wird erläutert, inklusive der Unterscheidung zwischen freiwilliger und unfreiwilliger Arbeitslosigkeit sowie der Problematik der Langzeitarbeitslosigkeit. Die Bedeutung des Sozialstaates als Grundprinzip des deutschen Grundgesetzes wird hervorgehoben.
3 Zur Arbeitslosigkeit: Kapitel 3 befasst sich mit den Ursachen und Folgen von Arbeitslosigkeit. Es analysiert die verschiedenen Faktoren, die zur Arbeitslosigkeit beitragen, und beleuchtet detailliert die negativen Folgen für betroffene Personen, sowohl auf individueller als auch auf gesellschaftlicher Ebene. Der Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und Armut wird betont, wobei die hohe Armutsgefährdung von Arbeitslosen in Deutschland hervorgehoben wird.
4 Gegenmaßnahmen des Staates: Dieses Kapitel beschreibt die Maßnahmen und Instrumente des deutschen Sozialstaates zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit, die sich im SGB III und SGB II manifestieren. Es beschreibt detailliert verschiedene Förderleistungen wie Berufsberatung, Aktivierung und berufliche Eingliederung, berufliche Weiterbildung und Arbeitslosengeld (SGB III), sowie Leistungen aus dem SGB II wie Teilhabechancengesetz und Leistungen zur Eingliederung von Selbstständigen. Die verschiedenen staatlichen Ansätze werden analysiert und in ihren Zusammenhängen dargestellt.
Schlüsselwörter
Arbeitslosigkeit, Sozialstaat, SGB III, SGB II, Erwerbsarbeit, Armut, Langzeitarbeitslosigkeit, Gegenmaßnahmen, Förderleistungen, soziale Kohäsion, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Staatliche Maßnahmen zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit in Deutschland
Was ist der Inhalt dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht umfassend die staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit in Deutschland. Sie beinhaltet eine Einleitung, Begriffsklärungen (Erwerbsarbeit, Arbeitslosigkeit, Sozialstaat), eine Analyse der Ursachen und Folgen von Arbeitslosigkeit, eine detaillierte Beschreibung der Förderleistungen nach SGB III und SGB II, und ein abschließendes Fazit. Die Arbeit zielt darauf ab, ein vollständiges Verständnis der staatlichen Interventionen im Kampf gegen Arbeitslosigkeit zu vermitteln.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Bedeutung von Erwerbsarbeit, Arbeitslosigkeit und Sozialstaat, die Ursachen und Folgen von Arbeitslosigkeit in Deutschland, die Förderleistungen des SGB III (Berufsberatung, Ausbildungs- und Arbeitsvermittlung, Aktivierung und berufliche Eingliederung, berufliche Weiterbildung, Arbeitslosengeld), die Förderleistungen des SGB II (Teilhabechancengesetz, Leistungen zur Eingliederung von Selbstständigen, Nachgehende Betreuung) und den Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit, Armut und sozialer Kohäsion.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Hausarbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) führt in die Thematik ein und beschreibt die Bedeutung der Arbeitslosigkeit als Armutsrisiko. Kapitel 2 (Begriffsklärung) klärt zentrale Begriffe wie Erwerbsarbeit, Arbeitslosigkeit und Sozialstaat. Kapitel 3 ("Zur Arbeitslosigkeit") analysiert die Ursachen und Folgen von Arbeitslosigkeit. Kapitel 4 ("Gegenmaßnahmen des Staates") beschreibt detailliert die Förderleistungen des SGB III und SGB II. Kapitel 5 (Fazit) fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Förderleistungen des SGB III werden erläutert?
Die Hausarbeit beschreibt detailliert die Förderleistungen des SGB III, darunter Berufsberatung, Ausbildungs- und Arbeitsvermittlung, Aktivierung und berufliche Eingliederung, berufliche Weiterbildung und Arbeitslosengeld. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, Arbeitslose wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren.
Welche Förderleistungen des SGB II werden behandelt?
Die Arbeit erläutert die Leistungen des SGB II zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit, inklusive des Teilhabechancengesetzes, Leistungen zur Eingliederung von Selbstständigen und nachgehende Betreuung. Diese Leistungen unterstützen Arbeitslose bei ihrer Eingliederung in den Arbeitsmarkt und sichern ihren Lebensunterhalt.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis der Hausarbeit relevant?
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe sind: Arbeitslosigkeit, Sozialstaat, SGB III, SGB II, Erwerbsarbeit, Armut, Langzeitarbeitslosigkeit, Gegenmaßnahmen, Förderleistungen, soziale Kohäsion, Deutschland.
Welche Zitate oder Quellen werden verwendet?
Die Hausarbeit erwähnt ein Zitat von Alexander Herzen in der Einleitung, welches als Inspiration für die Untersuchung der staatlichen Interventionen im Kontext des deutschen Sozialstaates dient. Weitere Quellen und Zitate sind im Haupttext der Hausarbeit selbst zu finden (nicht im vorliegenden Inhaltsverzeichnis).
Wie ist der Aufbau des Inhaltsverzeichnisses?
Das Inhaltsverzeichnis ist hierarchisch aufgebaut und gliedert die Hausarbeit in Kapitel und Unterkapitel. Es beginnt mit einer Einleitung, gefolgt von der Begriffsklärung, der Analyse der Arbeitslosigkeit, den staatlichen Gegenmaßnahmen und einem Fazit. Die Unterkapitel ermöglichen eine detaillierte Betrachtung der einzelnen Themenbereiche.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2022, Arbeitslosigkeit in Deutschland. Maßnahmen und Instrumente des Sozialstaates zur Bekämpfung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1222892