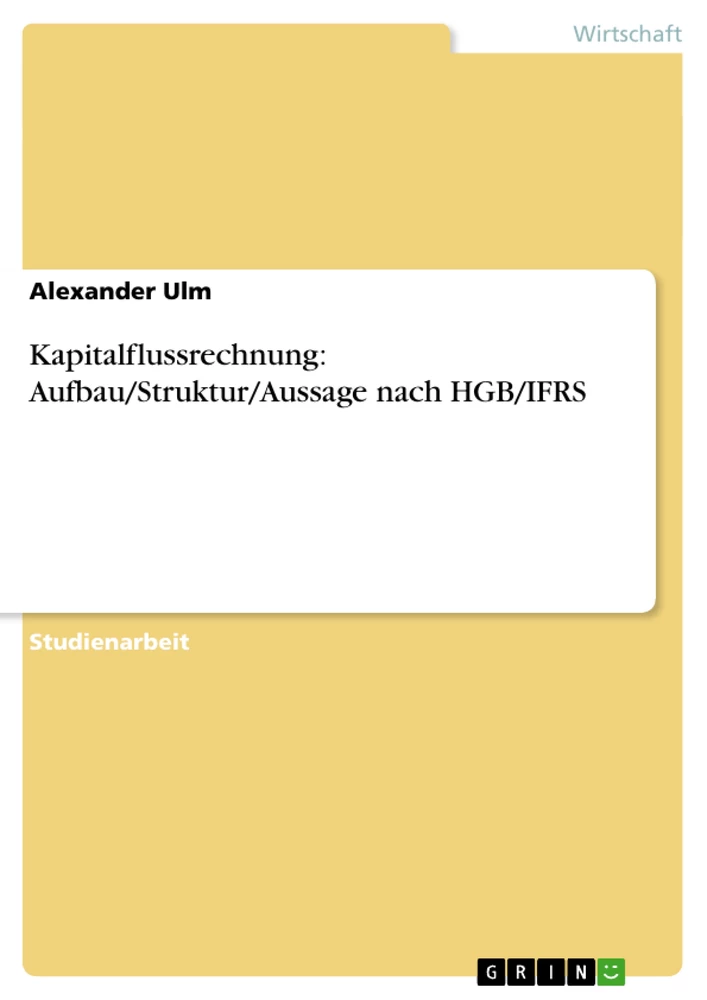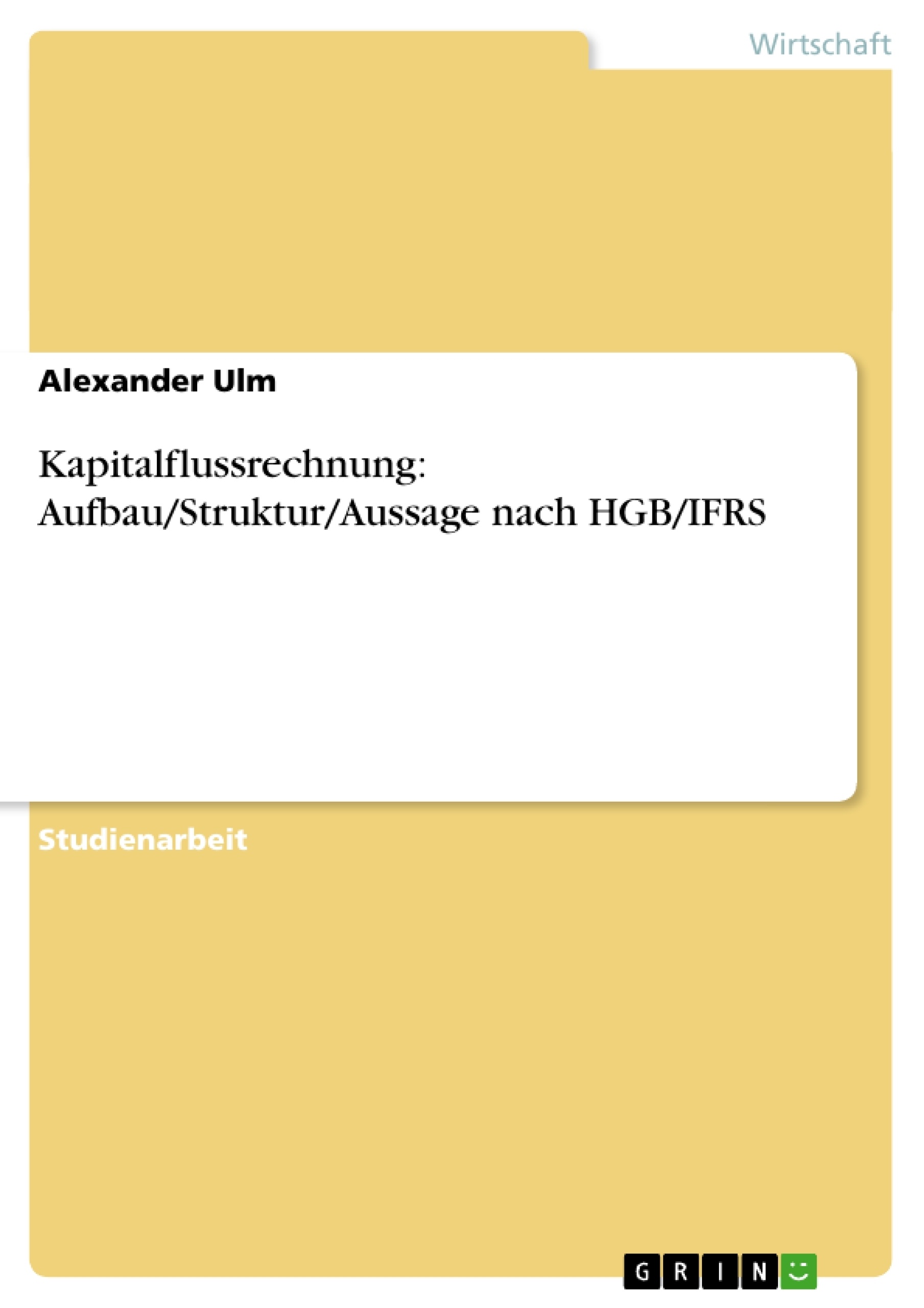In der betriebswirtschaftlichen Literatur als auch in der Praxis wird der Begriff der Kapitalflussrechnung sehr unterschiedlich definiert, zumal die deutsche Bezeichnung im Grunde irreführend ist. Eine bessere Bezeichnung könnte Finanzmittelfonds-Veränderungsrechnung sein, denn nicht der Zu- und Abfluss des Kapitals, sondern die Veränderung des Finanzmittelfonds steht bei dieser Rechnung im Mittelpunkt.
International bezeichnet man die Kapitalflussrechnung als cash flow statements (IAS 7) oder auch statement of cash flows (FAS 95). Statement kann als Rechnung, Darstellung oder auch Erklärung übersetzt werden. Demnach ist die KFR eine Darstellung von verschiedenen Cash-flows, die jeweils eine Ursachenrechnung darstellen und Aussagen darüber treffen, was die Veränderung des Finanzmittelfonds begründet hat.
Neben der Bilanz als Darstellung der Vermögenslage und der GuV als Darstellung der Ertragslage soll durch die Aufstellung einer KFR eine Beurteilung der Finanzlage möglich sein. Während sie im IFRS-Jahresabschluss bereits ein Pflichtbestandteil ist, beschränkt sich national die Verpflichtung gemäß § 297 Abs. 1 Satz 1 HGB lediglich auf Konzerne i.S.d. § 18 AktG sowie § 290 HGB. Da im HGB eine nähere Konkretisierung zu ihren Aufgaben, Inhalt und Gestaltung fehlt, übernimmt der DRS 2 des DRSC eine Leitlinienfunktion und füllt inhaltlich die Norm des § 297 Abs.1 Satz 1 HGB auf. Dieser Standard ist für alle Mutterunternehmen bindend, die nicht kapitalmarktorientiert sind und das Wahlrecht zur IFRS-Bilanzierung nicht in Anspruch nehmen, sowie für freiwillig erstellte KFR in Einzelabschlüssen.
Obwohl sich das DRS 2 eng an die IFRS anlehnt, soll diese Hausarbeit neben den Gemeinsamkeiten vor allem die Unterschiede zwischen dem nationalen und internationalen Standard darstellen. Eine kurze Erläuterung der Aufgaben und Anforderungen, die an die KFR gestellt werden, soll eine Einführung in die Problematik erleichtern. Den Schwerpunkt bildet der Vergleich des Aufbaus und der Darstellung der KFR zwischen DRS 2 und IAS 7 und darauf aufbauend, die Analyse der verschiedenen Cashflows. In der Schlussbetrachtung wird anhand von Vor- und Nachteilen der KFR, die bei der Bearbeitung des Themas aufgetretene Frage beantwortet: „Ist anhand der dargestellten Informationen in der KFR, eine richtige Beurteilung der Finanzlage eines Unternehmens überhaupt möglich?“.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Charakteristika
- 2.1 Zweck und Aufgaben
- 2.2 Anforderungen an die Kapitalflussrechnung
- 2.2.1 Allgemeine Grundsätze
- 2.2.2 Besondere Grundsätze für die Erstellung von Kapitalflussrechnungen
- 3. Aufbau und Struktur
- 3.1 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit/ betrieblichen Tätigkeit
- 3.2 Cashflow aus der Investitionstätigkeit
- 3.3 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit
- 3.4 Abgrenzung des Finanzmittelfonds
- 4. Ermittlung und Darstellung
- 4.1 Einführung
- 4.2 Direkte Methode
- 4.3 Indirekte Methode
- 5. Analyse und Interpretation der Kapitalflussrechnung und der Cashflows
- 5.1 Kapitalflussrechnung
- 5.2 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit
- 5.3 Cashflow aus der Investitionstätigkeit
- 5.4 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit
- 6. Kritische Würdigung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Aufbau, die Struktur und die Aussagekraft der Kapitalflussrechnung nach Handelsgesetzbuch (HGB) und International Financial Reporting Standards (IFRS). Ziel ist der Vergleich der nationalen und internationalen Standards, insbesondere der Unterschiede im Aufbau und der Darstellung der Kapitalflussrechnung nach DRS 2 und IAS 7.
- Vergleich der Kapitalflussrechnung nach HGB und IFRS
- Unterschiede im Aufbau und der Darstellung nach DRS 2 und IAS 7
- Anforderungen und Aufgaben der Kapitalflussrechnung
- Direkte und indirekte Methode zur Ermittlung des Cashflows
- Analyse und Interpretation der Cashflows
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Kapitalflussrechnung ein und beleuchtet unterschiedliche Definitionen und Bezeichnungen. Kapitel 2 beschreibt die Charakteristika der Kapitalflussrechnung, inklusive Zweck, Aufgaben und Anforderungen. Kapitel 3 erläutert den Aufbau und die Struktur, unterteilt in Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Kapitel 4 befasst sich mit der Ermittlung und Darstellung der Kapitalflussrechnung, wobei die direkte und indirekte Methode im Detail behandelt werden. Kapitel 5 widmet sich der Analyse und Interpretation der Kapitalflussrechnung und der einzelnen Cashflows.
Schlüsselwörter
Kapitalflussrechnung, Cashflow, HGB, IFRS, DRS 2, IAS 7, Finanzmittelfonds, direkte Methode, indirekte Methode, Finanzierungstätigkeit, Investitionstätigkeit, Geschäftstätigkeit, Finanzlage, Rechnungswesen, Controlling.
- Quote paper
- Alexander Ulm (Author), 2008, Kapitalflussrechnung: Aufbau/Struktur/Aussage nach HGB/IFRS, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/122274