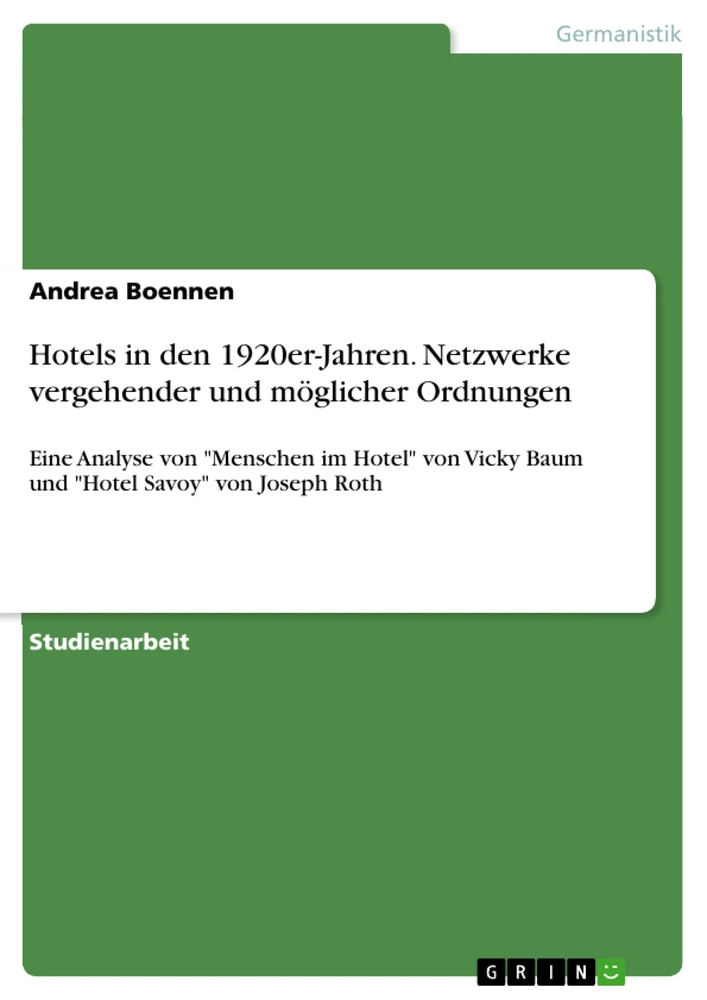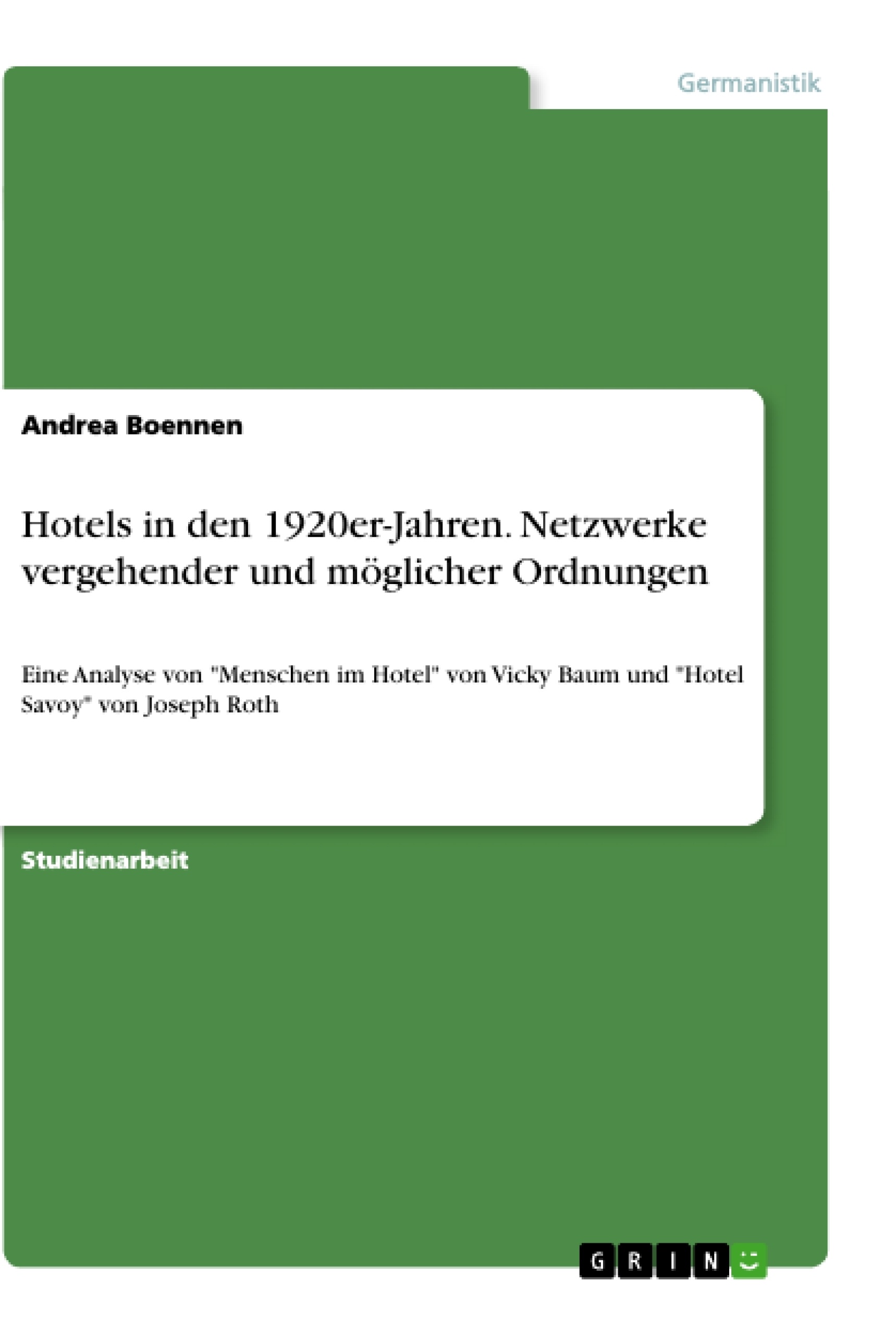Grandhotels präsentierten sich seit Mitte des 19. Jahrhunderts im Inneren mit Luxus und moderner Technik und nach außen über prunkvolle Fassaden, in Anzeigen, auf Postkarten und Kofferanhängern. Hotels sind zugleich konservierende Orte, in die sich „bewährte“ Regeln und Wertvorstellungen eingeschrieben haben, als auch Labore, in denen neue Spielarten erprobt werden, die an bestehenden Ordnungen rütteln und diese verändern können. Vicky Baum und Joseph Roth machen Grandhotels zum zentralen Ort ihrer Romane „Menschen im Hotel“ und „Hotel Savoy“ und erzählen von fiktiven Begegnungen 1928 in Berlin beziehungsweise 1919/20 in Lodz.
Ich betrachte diese Hotels im Licht der Akteur-Netzwerk-Theorie als ein Netzwerk, das sich aus menschlichen und nicht-menschlichen Akteuren zusammenfügt und in dem versucht wird, eingeschriebene Regeln und Erwartungen aufrecht zu erhalten. Hotels sind halböffentliche Orte. Vordergründig scheint die Tür offen zu stehen und unbegrenzten Zugang zu ermöglichen. Doch ist dies tatsächlich so? Werden alle, die durch sie eintreten, gleichermaßen willkommen geheißen? Bekommt jede*r ein Zimmer und steht allen die gleiche Auswahl an Zimmern zur Verfügung? Ich gehe davon aus, dass das Hotel bestimmte Erwartungen an seine Gäste richtet und versucht, die auszuschließen, die diese nicht erfüllen. Ich gehe den Fragen nach, welche Akteure auf den Plan gerufen werden, um den Zugang zu regeln und sich gegen Störungen zu behaupten und inwieweit dies tatsächlich gelingt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Menschen im Hotel (Vicky Baum)
- Was ein Gast vom Grand Hôtel Berlin erwartet und was ihn dort erwartet
- Zugang zum Hotel: Wie man hineingelangt und bleibt
- Stets zu Diensten oder ein Rauschen des Privaten
- Begegnungen, Verwicklungen und Metamorphosen des Herrn Kringelein
- Herr Kringelein kommt durch die Drehtür
- Herr Kringelein und der Baron
- Die beiden Herrn aus Fredersdorf
- Herr Kringelein und das Fräulein Flam
- Hotel Savoy (Joseph Roth)
- Was Gabriel Dan vom Hotel Savoy erwartet und was ihn erwartet
- Hotel Savoy: Bestehende, vergehende und mögliche neue Ordnungen
- Koffer und andere Währungen
- Nachrichten des Hoteldirektors
- Bloomfield kommt: Warten und Erwartungen
- Zwonimir zieht ein und seine Kreise
- Was davon bleibt
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle von Grandhotels in den 1920er Jahren als Zentren menschlicher Interaktion und der Gestaltung von gesellschaftlichen Ordnungen. Dabei werden die Romane „Menschen im Hotel“ von Vicky Baum und „Hotel Savoy“ von Joseph Roth analysiert.
- Die Darstellung von Grandhotels als „Bürgertraum des Adelsschlosses“ und Orte des Wandels
- Die Anwendung der Akteur-Netzwerk-Theorie auf die Beziehungen zwischen Menschen und Objekten im Hotelumfeld
- Die Untersuchung der Zugangsbedingungen und Regeln, die den Aufenthalt im Hotel bestimmen
- Die Analyse von Begegnungen und Interaktionen zwischen Gästen und Personal im Kontext des Hotels
- Die Erforschung der Herausforderungen und Veränderungen, die durch neue Akteure und Handlungsprogramme in den Hotels entstehen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet den historischen Kontext von Grandhotels als Orte des Luxus und des gesellschaftlichen Wandels und führt die Akteur-Netzwerk-Theorie als analytisches Framework ein. Das zweite Kapitel analysiert Vicky Baums „Menschen im Hotel“ und betrachtet die Erwartungen und Erfahrungen der Gäste im Grand Hôtel Berlin, insbesondere die Interaktionen des Protagonisten Herrn Kringelein mit anderen Figuren. Das dritte Kapitel fokussiert auf Joseph Roths „Hotel Savoy“ und untersucht die etablierte Ordnung des Hotels, die durch das Auftauchen neuer Akteure in Frage gestellt wird.
Schlüsselwörter
Grandhotel, Akteur-Netzwerk-Theorie, Hotelwesen, soziale Praktiken, Ordnungsstrukturen, Gäste, Personal, Begegnungen, Interaktionen, Handlungsprogramme, Vicky Baum, Menschen im Hotel, Joseph Roth, Hotel Savoy, 1920er Jahre, Berlin, Lodz
- Quote paper
- Andrea Boennen (Author), 2022, Hotels in den 1920er-Jahren. Netzwerke vergehender und möglicher Ordnungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1222703