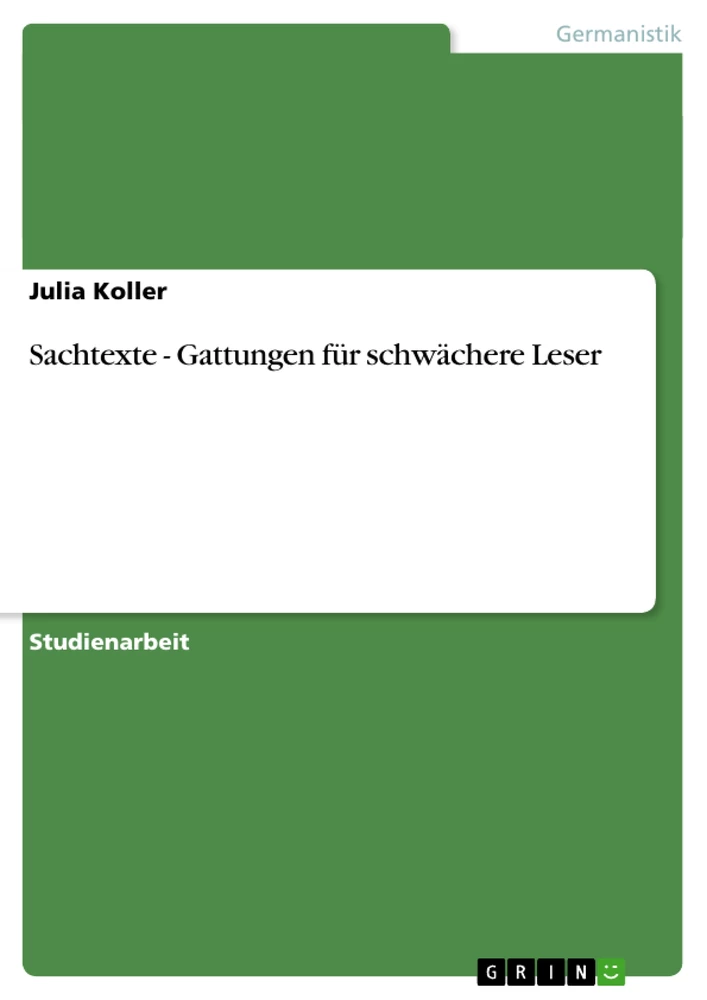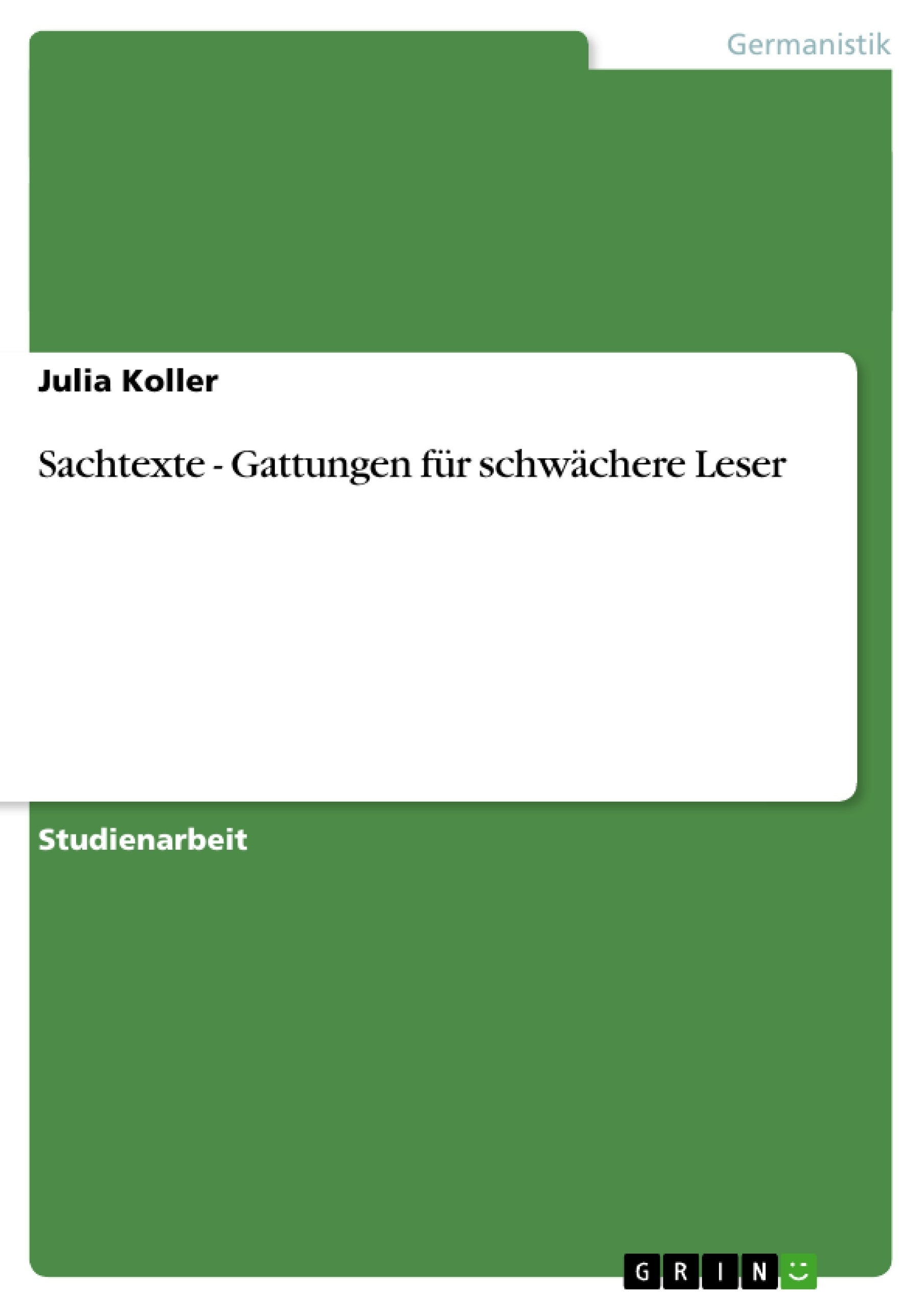„Mädchen sind in der Schule fleißiger und leiser, aber nicht klüger, sie haben lieber Kunst als Sport, auf dem Computer spielen sie nicht so viel, und wenn, dann lieber Denkspiele, sie zeigen mehr Interesse am Lesen, sie lesen am liebsten Pferdebücher, z.B. Wendy, sie reiten auch gerne und kümmern sich um Pferde. Jungen legen keinen so großen Wert auf die Schule, ihr Lieblingsfach ist Sport, sie spielen gerne Fußball, auf dem Computer spielen sie lieber Kampfspiele, wenn Jungen lesen, dann lesen sie Krimis und Detektivgeschichten oder Comics.“1 Dieses Zitat, das von einem 11-jährigen Schüler stammt, der die Schul- und Freizeitinteressen von Jungen und Mädchen beschreiben sollte, spiegelt eine, nicht nur bei Kindern und Jugendlichen weit verbreitete Meinung wieder: Jungen toben sich gerne aus, sind technikbegeistert und lesen, wenn überhaupt nur Sach- und Abenteuertexte, während Mädchen eher die ruhigeren, tierliebe und naturbegeisterten sind, die Nachmittage damit verbringen können in die Fantasiewelt eines Pferde- oder Mädchenbuches einzutauchen.
Dies ist nur ein kleiner Auszug aus den unterschiedlichen Eigenschaften, die den beiden Geschlechtern zugeschrieben werden. Im Folgenden möchte ich mich jedoch speziell mit einem Punkt befassen, nämlich damit, wie das Leseverhalten von Mädchen und Jungen ist. Gibt es Unterschiede, wenn ja welche und haben diese dann Auswirkungen auf den Deutschunterricht?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Ergebnisse zur Untersuchung eines geschlechtsspezifischen Leseverhaltens
- 3. Zusammenhang der Ergebnisse mit dem Deutschunterricht
- 4. Förderung schwächerer Leser durch Sachtexte: Beispiele
- 4.1 Zu der Auswahl der Texte
- 4.2 Die Textbeispiele
- 4.2.1 Dinosaurier Texte
- 4.2.2 Verschiedene Texte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht geschlechtsspezifische Unterschiede im Leseverhalten von Kindern und Jugendlichen und deren Auswirkungen auf den Deutschunterricht. Ziel ist es, die Ergebnisse einschlägiger Studien zu präsentieren und Möglichkeiten der Leseförderung, insbesondere durch Sachtexte, aufzuzeigen.
- Geschlechtsspezifische Unterschiede im Leseverhalten
- Einfluss der Sozialisation auf das Leseverhalten
- Zusammenhang zwischen Lesefähigkeit und Lesehäufigkeit
- Geeignete Sachtexte zur Leseförderung
- Methoden zur Verbesserung der Lesekompetenz
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beginnt mit einem Zitat eines 11-jährigen Schülers, das gängige Stereotypen über das Leseverhalten von Jungen und Mädchen widerspiegelt. Sie führt in die Thematik der geschlechtsspezifischen Unterschiede im Leseverhalten ein und stellt die Forschungsfrage nach dem Vorhandensein solcher Unterschiede und deren Auswirkungen auf den Deutschunterricht. Der Fokus liegt auf der Untersuchung des Leseverhaltens und seiner Bedeutung für den Unterricht.
2. Ergebnisse zur Untersuchung eines geschlechtsspezifischen Leseverhaltens: Dieses Kapitel präsentiert Ergebnisse verschiedener Studien zum geschlechtsspezifischen Leseverhalten. Es wird deutlich, dass Mädchen häufiger und länger lesen als Jungen und flüssiger vorlesen können. Die Studie der Bertelsmann Stiftung zeigt signifikante Unterschiede in der Lesehäufigkeit und -freude zwischen den Geschlechtern. Es wird betont, dass diese Unterschiede nicht angeboren sind, sondern durch soziale Faktoren beeinflusst werden. Die Studie beleuchtet den Zusammenhang zwischen Lesezeit, Lesefertigkeit und Lesefreude. Zusätzlich wird der Einfluss elterlicher Aufforderungen zum Lesen untersucht. Das Kapitel differenziert zwischen der Breite und der Qualität des Leseinteresses, wobei Mädchen höhere Gratifikationen aus dem Lesen ziehen und emotional stärker involviert sind.
3. Zusammenhang der Ergebnisse mit dem Deutschunterricht: (Leider fehlt der Text zu Kapitel 3, daher kann hier keine Zusammenfassung erstellt werden.)
4. Förderung schwächerer Leser durch Sachtexte: Beispiele: Dieses Kapitel befasst sich mit der Auswahl und den Beispielen von Sachtexten zur Leseförderung schwächerer Leser. Es geht um die didaktische Aufbereitung von Sachtexten, um das Interesse und die Lesekompetenz von Kindern und Jugendlichen zu fördern. Die Auswahl der Texte orientiert sich an den Interessen der Schüler und an ihren individuellen Lesekompetenzen. Konkrete Beispiele für geeignete Sachtexte (z.B. Dinosauriertexte) und deren didaktische Nutzung werden vorgestellt. Der Fokus liegt auf der Anpassung der Texte an die jeweiligen Bedürfnisse und Fähigkeiten der Lernenden.
Schlüsselwörter
Geschlechtsspezifische Unterschiede, Leseverhalten, Leseförderung, Sachtexte, Deutschunterricht, Sozialisation, Lesehäufigkeit, Lesekompetenz, Bertelsmann Stiftung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Untersuchung geschlechtsspezifischer Unterschiede im Leseverhalten"
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit untersucht geschlechtsspezifische Unterschiede im Leseverhalten von Kindern und Jugendlichen und deren Auswirkungen auf den Deutschunterricht. Sie präsentiert Ergebnisse einschlägiger Studien und zeigt Möglichkeiten der Leseförderung, insbesondere durch Sachtexte, auf.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: geschlechtsspezifische Unterschiede im Leseverhalten, Einfluss der Sozialisation auf das Leseverhalten, Zusammenhang zwischen Lesefähigkeit und Lesehäufigkeit, geeignete Sachtexte zur Leseförderung und Methoden zur Verbesserung der Lesekompetenz.
Welche Ergebnisse zu geschlechtsspezifischen Unterschieden im Leseverhalten werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert Ergebnisse, die zeigen, dass Mädchen häufiger und länger lesen als Jungen und flüssiger vorlesen können. Studien belegen signifikante Unterschiede in der Lesehäufigkeit und -freude zwischen den Geschlechtern. Diese Unterschiede werden nicht als angeboren, sondern als sozial beeinflusst betrachtet. Der Zusammenhang zwischen Lesezeit, Lesefertigkeit und Lesefreude wird ebenso beleuchtet wie der Einfluss elterlicher Aufforderungen zum Lesen. Mädchen ziehen höhere Gratifikationen aus dem Lesen und sind emotional stärker involviert.
Wie wird der Zusammenhang der Ergebnisse mit dem Deutschunterricht dargestellt?
Leider fehlt im vorliegenden Text die Zusammenfassung zu Kapitel 3, welches sich mit dem Zusammenhang der Ergebnisse zum geschlechtsspezifischen Leseverhalten mit dem Deutschunterricht befasst. Daher kann zu diesem Punkt keine Aussage getroffen werden.
Wie werden Möglichkeiten der Leseförderung, insbesondere durch Sachtexte, aufgezeigt?
Das Kapitel 4 befasst sich mit der Auswahl und Beispielen von Sachtexten zur Leseförderung schwächerer Leser. Es geht um die didaktische Aufbereitung von Sachtexten, um das Interesse und die Lesekompetenz von Kindern und Jugendlichen zu fördern. Die Auswahl der Texte orientiert sich an den Interessen der Schüler und ihren individuellen Lesekompetenzen. Konkrete Beispiele (z.B. Dinosauriertexte) und deren didaktische Nutzung werden vorgestellt. Der Fokus liegt auf der Anpassung der Texte an die Bedürfnisse und Fähigkeiten der Lernenden.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Geschlechtsspezifische Unterschiede, Leseverhalten, Leseförderung, Sachtexte, Deutschunterricht, Sozialisation, Lesehäufigkeit, Lesekompetenz, Bertelsmann Stiftung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst folgende Kapitel: Einleitung, Ergebnisse zur Untersuchung eines geschlechtsspezifischen Leseverhaltens, Zusammenhang der Ergebnisse mit dem Deutschunterricht, und Förderung schwächerer Leser durch Sachtexte: Beispiele.
- Quote paper
- Julia Koller (Author), 2002, Sachtexte - Gattungen für schwächere Leser, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/12215