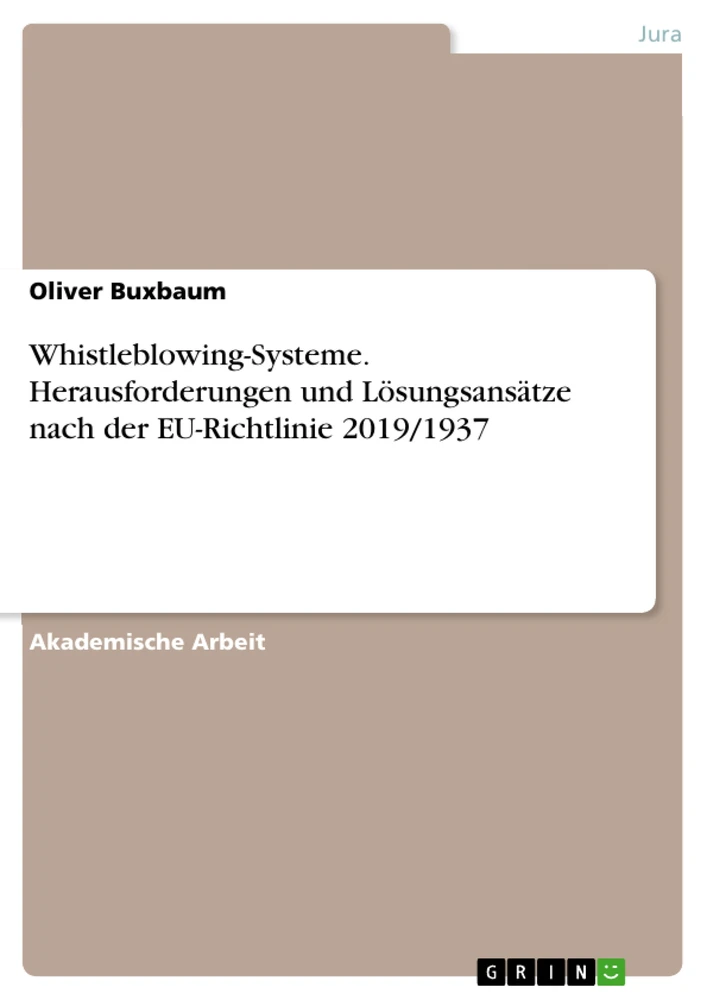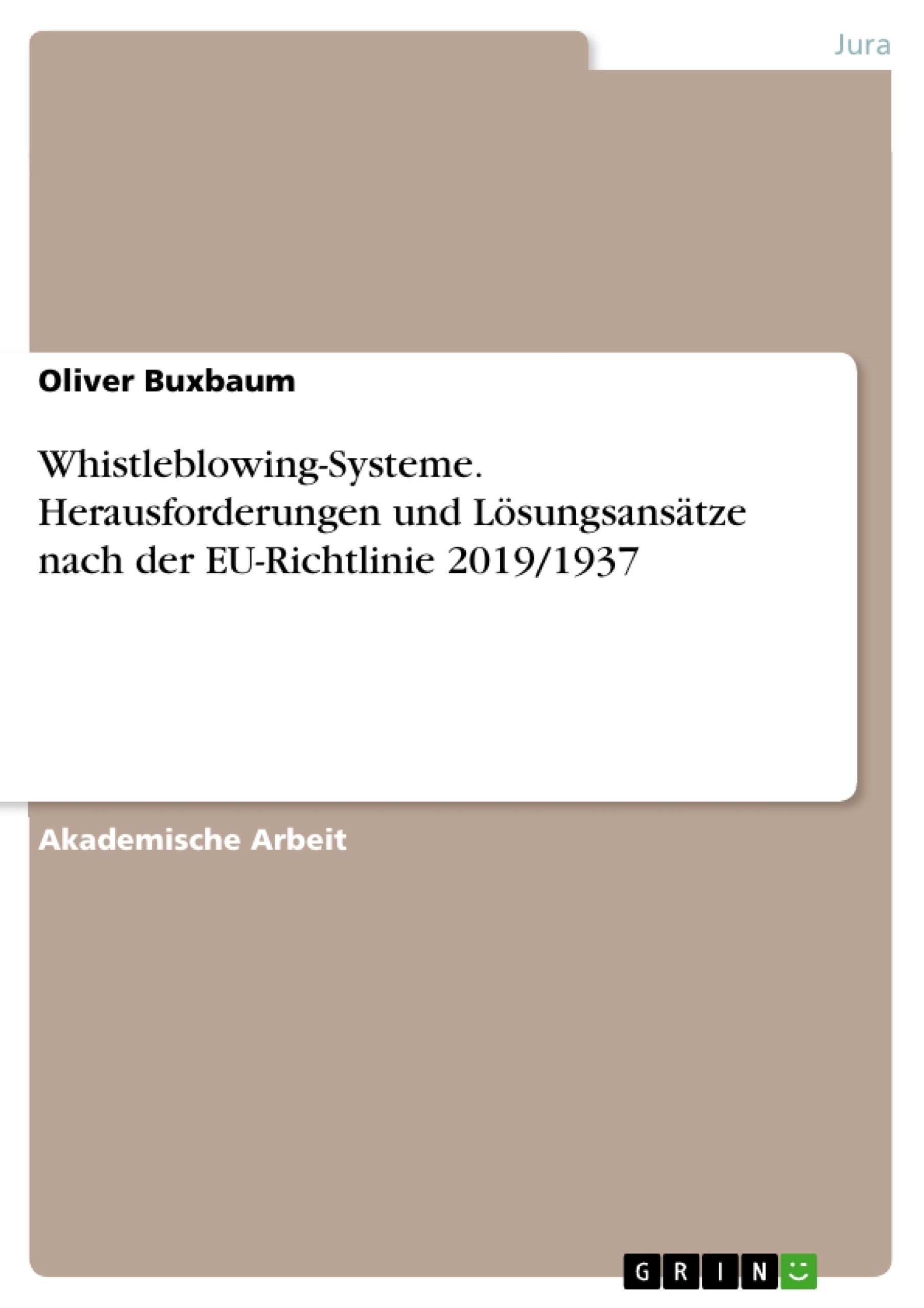In welchem Ausmaß Whistleblowern auch in Hinblick auf die deutsche Gesetzgebung Schutz genießen, ist Teil dieser wissenschaftlichen Arbeit, welche anhand einzelner gesetzlicher Bestandteile veranschaulicht und hinterfragt wird. Diese Arbeit bietet zudem einen umfassenden Einblick in die Art und Weise der einzurichtenden Meldekanäle und stellt analog zur Thematik, die Herausforderungen und Lösungsansätze, welche mit der Richtlinie einhergehen, gegenüber.
Wer symbolisch in die Trillerpfeife bläst (engl. whistleblowing), erregt Aufmerksamkeit, prangert einen Missstand an oder schlägt eventuell sogar Alarm. Whistleblower haben sowohl in jüngster als auch in zurückliegender Vergangenheit bei der Aufdeckung aller Arten von Missständen in Unternehmen eine große Rolle gespielt. Beispielhaft sind die schlagzeilenträchtigen Themen wie dem Umgang der Trump-Administration mit internen Warnungen vor der Corona-Pandemie, dem Skandalfall der Wirecard AG oder der Berliner Altenpflegerin, welche Missstände in ihrem Pflegeheim öffentlich machte und zu unrecht eine fristlose Kündigung erhielt.
Es sind Fälle wie diese, die zeigen, dass Whistleblower nicht ausreichend geschützt sind. Hierbei haben Hinweisgeber nach Medienberichten frühzeitig auf Handlungsbedarf hingewiesen, ohne dass angemessene Maßnahmen zeitnah umgesetzt wurden. Die Folgen für potenzielle Hinweisgeber sind unterschiedlich, jedoch nur selten positiv. Blickt man auf andere Rechtsordnungen wie dem GeschGehG, sind die rechtlichen Gegebenheiten zum Schutz oder gar der Förderung von Whistleblowern vielgestaltig und in verschiedenen Reifephasen. Zur Gewährleistung eines Mindestschutzes im Europäischen Wirtschaftsraum hat die europäische Gesetzgebung durch die Richtlinie zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden (Richtlinie (EU) 2019/1937 des Europäischen Parlaments und Rates vom 23. Oktober 2019; „Whistleblower-Richtlinie“) die Mitgliedstaaten zu entsprechenden legislativen Maßnahmen verpflichtet, die am 16. Dezember 2019 in Kraft getreten ist. Die Mitgliedsstaaten haben nunmehr bis zum 17. Dezember 2021 Zeit, um die Richtlinie in nationales Recht umzusetzen. Die Richtlinie dient vor allem dem Schutz der Hinweisgeber, um jene vor Vergeltungsmaßnahmen zu schützen. „Deutschland hat bereits einen Entwurf für ein „Hinweisgeberschutzgesetz“ fertiggestellt und zur Abstimmung an die anderen Ressorts versandt.“
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- 1. Ziel der Untersuchung
- II. Hinweisgeber
- III. Richtlinie (EU) 2019/1937
- 1. Anwendungsbereich der Richtlinie
- 2. Meldewege: dreigliedriges Meldesystem
- a) Wahl und Hierarchie der Meldekanäle
- b) Externe Meldekanäle
- 3. Auswirkungen für Unternehmen
- a) Anonymität der Meldewege
- IV. Herausforderungen und Lösungsansätze der EU-Richtlinie
- 1. Aktuelle Gesetzgebung der Bundesrepublik Deutschland
- a) Systematische Eingliederung der Richtlinie in das deutsche Rechtssystem
- b) Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen nach § 5 Nr. 2 GeschGehG
- V. Fazit
- 1. Rechtspolitischer Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende wissenschaftliche Arbeit befasst sich mit dem Schutz von Hinweisgebern (Whistleblowern) und analysiert die Herausforderungen und Lösungsansätze der EU-Richtlinie 2019/1937. Dabei wird die Zielsetzung verfolgt, die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Schutz von Whistleblowern im deutschen Rechtssystem zu beleuchten und die Einbindung der EU-Richtlinie in die bestehende Rechtslage zu analysieren.
- Rechtliche Rahmenbedingungen für den Schutz von Hinweisgebern
- Analyse der EU-Richtlinie 2019/1937 und ihrer Implikationen
- Herausforderungen bei der Umsetzung der Richtlinie in Deutschland
- Lösungsansätze für den Schutz von Hinweisgebern
- Rechtspolitischer Ausblick auf die zukünftige Entwicklung des Hinweisgeberschutzes
Zusammenfassung der Kapitel
- I. Einleitung: Dieses Kapitel erläutert die Bedeutung von Hinweisgebern in Unternehmen und beleuchtet die Notwendigkeit eines verbesserten Schutzes vor Repressalien. Es werden aktuelle Fälle und die Relevanz der EU-Richtlinie 2019/1937 im Kontext des Hinweisgeberschutzes dargestellt.
- II. Hinweisgeber: In diesem Kapitel wird die Rolle und der Handlungsspielraum von Hinweisgebern im Kontext von Korruption und Missständen in Unternehmen beleuchtet. Es werden die Herausforderungen und die moralischen und rechtlichen Dilemmata aufgezeigt, denen Hinweisgeber im Zuge ihres Handelns gegenüberstehen.
- III. Richtlinie (EU) 2019/1937: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Anwendungsbereich und den Kernbestimmungen der EU-Richtlinie 2019/1937. Es werden die Meldewege, die Anonymität der Meldekanäle sowie die Auswirkungen der Richtlinie auf Unternehmen und Hinweisgeber erläutert.
- IV. Herausforderungen und Lösungsansätze der EU-Richtlinie: Dieses Kapitel analysiert die Herausforderungen bei der Umsetzung der EU-Richtlinie in Deutschland. Es werden die rechtlichen Rahmenbedingungen und die notwendige Integration der Richtlinie in das deutsche Rechtssystem beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Begriffen und Themenfeldern des Hinweisgeberschutzes, insbesondere im Kontext der EU-Richtlinie 2019/1937. Die wichtigsten Schlüsselwörter umfassen: Hinweisgeber, Whistleblower, Korruption, Missstände, EU-Recht, Richtlinie (EU) 2019/1937, Meldewege, Anonymität, Unternehmen, Rechtsschutz, Geschäftsgeheimnisse, Rechtspolitischer Ausblick.
- Quote paper
- Oliver Buxbaum (Author), 2021, Whistleblowing-Systeme. Herausforderungen und Lösungsansätze nach der EU-Richtlinie 2019/1937, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1221195