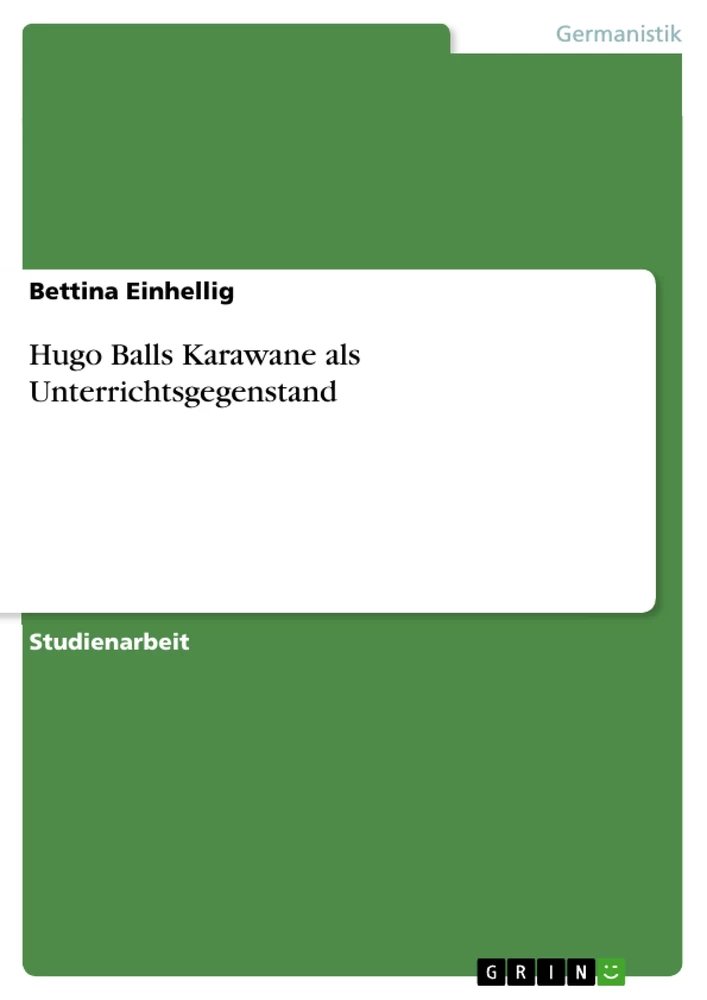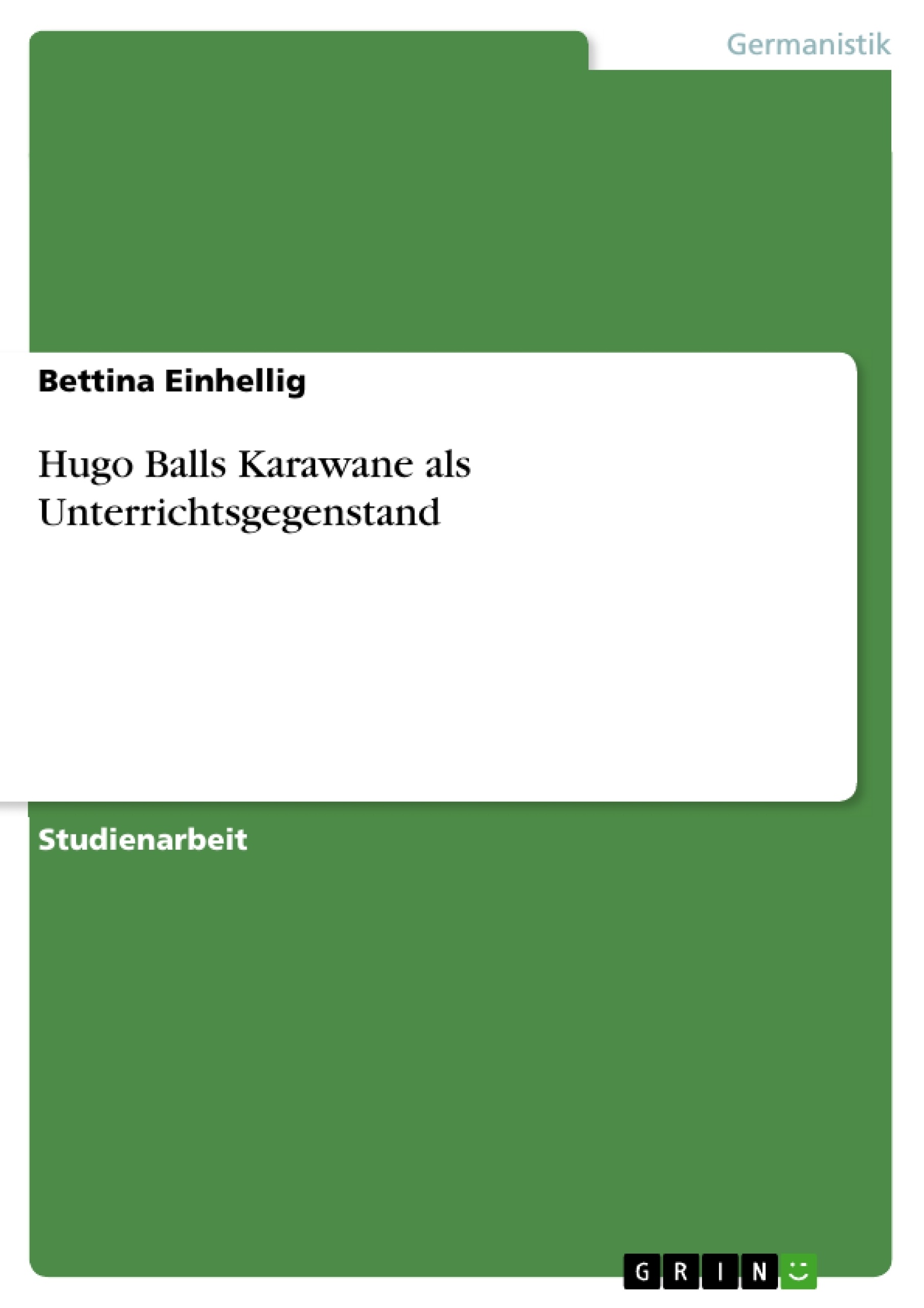Bevor man sich im Sekundarstufenbereich I und II mit Lyrik befasst, sollte man als Lehrer einige wichtige Überlegungen anstellen. Unter dem Aspekt, dass die Schüler sich wahrscheinlich zum letzten Mal mit lyrischen Texten auseinandersetzen werden, ist es besonders wichtig, die Unterrichtsplanung zukunftsorientiert im Sinne eines Unterrichts anzusetzen, von dem die Schüler auch im außerschulischen Bereich weiter zehren können. Das Wecken von längerfristigem Interesse und die Motivation zur Behandlung von Lyrik steht dabei im Vordergrund.
Da das Gedicht „Karawane“ in einer 10. Klasse unterrichtet wird, sind entwicklungspsychologische Aspekte besonders zu berücksichtigen. Während Kinder im Grundschulalter bis etwa zum 13. Lebensjahr noch eine große Freude am spielerischen Umgang mit der Lyrik haben, nimmt dieses Vergnügen und auch der geschärfte Sinn für klangliche Raffinessen mit dem Beginn der Pubertät deutlich ab. Die Schüler können in der 10. Klasse oft wenig mit Lautgedichten anfangen, weil diese für sie augenscheinlich keinen Sinn ergeben. Bedingt ist dies durch die Tatsache, dass die Jugendlichen sich während der Pubertät in einem Umbruch und auf der Suche nach neuer Orientierung befinden. Sie müssen selbständig lernen, Ihren Körper zu akzeptieren, unabhängig zu werden und sich ein eigenes Wertesystem aufzubauen.
Man sollte daher als Lehrer nicht abweisend reagieren, wenn die Schüler nicht sofort einen Zugang zu dadaistischen Lautgedichten finden. Durch Unterrichten im kontextuellen Zusammenhang ist es vielmehr wichtig, sie bei der Suche nach dem Sinn der lyrischen Texte unter Berücksichtigung der Zeitgeschichte dabei zu unterstützen.
Inhaltsverzeichnis
- Dadaistische Lyrik im Unterricht - Vorüberlegungen
- Behandlung von Lyrik im Unterricht
- Geschichtlicher Hintergrund und epochale Einordnung
- Hugo Ball und das Lautgedicht als Ausdruck des Protestes
- Berücksichtigung des Lehrplans und Beschreibung der Lernziele
- Hugo Balls „Karawane“ als Lerngegenstand
- Skizzierter Unterrichtsversuch
- Kritikpunkte und Verbesserungsvorschläge
- Exkurs: Fächerübergreifende Ansätze für den Musik- und Sportunterricht
- Schlussgedanke
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Eignung von Hugo Balls Lautgedicht „Karawane“ für den Deutschunterricht der Sekundarstufe I und II. Der Fokus liegt auf der didaktischen Aufbereitung des Gedichts unter Berücksichtigung der Schülerbedürfnisse und des Lehrplans. Dabei werden sowohl der historische Kontext des Dadaismus als auch der biographische Hintergrund Hugo Balls berücksichtigt.
- Didaktische Behandlung von Lyrik im Unterricht
- Der historische Kontext des Dadaismus und des Ersten Weltkriegs
- Hugo Ball und sein Lautgedicht als Ausdruck des künstlerischen und politischen Protestes
- Entwicklungspsychologische Aspekte des Lernprozesses im Umgang mit moderner Lyrik
- Fächerübergreifende didaktische Ansätze
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit der allgemeinen didaktischen Behandlung von Lyrik im Unterricht, insbesondere mit den Herausforderungen im Umgang mit modernen Gedichten bei Jugendlichen. Es werden entwicklungspsychologische Aspekte und die Bedeutung von Kontextualisierung berücksichtigt. Kapitel zwei skizziert einen konkreten Unterrichtsversuch zur Behandlung von Hugo Balls „Karawane“ und beinhaltet eine kritische Reflexion mit Verbesserungsvorschlägen, inklusive fächerübergreifender Ansätze.
Schlüsselwörter
Dadaismus, Hugo Ball, Lautgedicht, „Karawane“, Lyrikdidaktik, Sekundarstufe, Erster Weltkrieg, Entwicklungspsychologie, Kontextualisierung, fächerübergreifender Unterricht.
- Quote paper
- Bettina Einhellig (Author), 2007, Hugo Balls Karawane als Unterrichtsgegenstand, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/121872